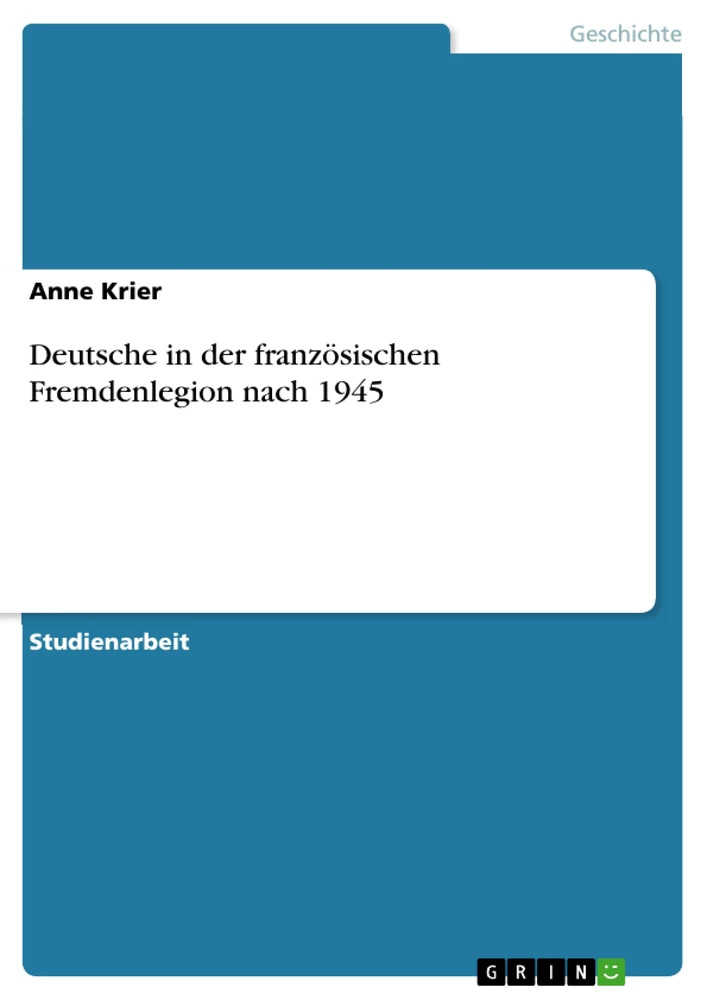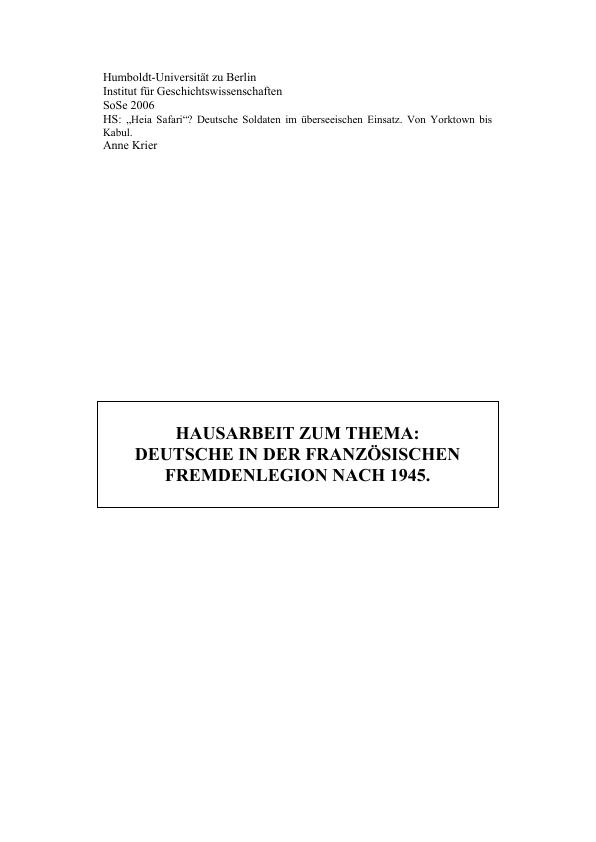„Wie mag es in diesen Legionären aussehen? Sind diese aus allen Ländern zusammengelaufenen Burschen, die bereit sind, ihr Blut für Frankreichs Größe unter fremder Sonne zu vergießen, Landsknechte oder wirkliche Soldaten? Armseliges, gepresstes Kriegsvolk? Oder ein strenger Orden, der seinen eigenen ethischen Gesetzen folgt?“1 fragte sich der deutsche Generalkonsul in Algerien, Siegfried von Nostitz, 1961 angesichts in Algerien eingesetzter Legionäre deutscher Herkunft. Im Zeitalter der Nationalarmeen war die Légion Etrangère, die französische Fremdenlegion, ein Kuriosum, das das Ausland zwar mit Respekt, aber auch mit Misstrauen beäugte. Gleiches galt für die ihr dienenden Männer – den Söldnern begegnete man mit Verwunderung, mit ein wenig Angst und ein wenig Herablassung: sie galten als Abenteurer, Kriminelle und Asoziale oder auch als Helden des ewigen Krieges, doch im Grunde wusste man wenig über sie.
Soldaten, die in Nationalarmeen kämpfen, kämpfen für ihr Land, ihre Heimat, befinden sich, wenn auch nicht zu Hause, sondern in die Welt des Krieges geworfen, doch in mehr oder weniger bekannter Umgebung, da doch wenigstens ihre Kameraden die gleiche Sprache sprechen und wenn nicht aus der selben Gegend, so doch aus dem selben Land stammen. Die Umgebung des Legionärs hingegen ist ihm fremd, auch befindet er sich fern seiner Heimat, die er während der fünf Jahre seines „engagements“ nicht wird besuchen dürfen, während er andererseits von der zivilen Welt abgeschottet und oft verachtet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Exkurs zur „Kriegserfahrung“
- Die Deutschen und die Fremdenlegion 1831 – 1954
- Von den Anfängen bis 1945
- 1945 – 1962: Indochina und Algerien
- Analyse eines Fallbeispiels: Hans E. Bauers „Verkaufte Jahre“
- Verkaufte Jahre“
- Zum Autor
- Historischer Rückblick
- Der Indochinakrieg
- Die Fremdenlegion im Indochinakrieg
- Analyse
- Der Blick nach „innen“ – Kameradschaft
- „Außen“: Zivilisten und militärischer Gegner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Erfahrungen deutscher Soldaten in der Französischen Fremdenlegion nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Erinnerungsberichts eines ehemaligen deutschen Legionärs, der in den 1940er und 1950er Jahren in Nordafrika und Indochina gedient hat. Ziel ist es, die besonderen Bedingungen und Herausforderungen des Lebens und Dienstes in der Fremdenlegion aus der Perspektive eines deutschen Veteranen heraus zu beleuchten.
- Die „Kriegserfahrung“ als Konzept in der Geschichtswissenschaft
- Die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschen und Fremdenlegion
- Die Rolle der Fremdenlegion im Indochinakrieg
- Die Bedeutung von Kameradschaft innerhalb der Truppe
- Die Beziehung zwischen Legionären und der Außenwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Konzept der Arbeit vor, indem sie auf die besonderen Lebensbedingungen von Legionären und die Herausforderungen des Umgangs mit den eigenen Kriegserfahrungen eingeht. Anschließend wird im zweiten Kapitel der Begriff „Kriegserfahrung“ kritisch beleuchtet und seine Bedeutung in der Geschichtswissenschaft analysiert. Das dritte Kapitel behandelt die historische Entwicklung der Beziehung zwischen Deutschen und Fremdenlegion vom 19. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit. Im vierten Kapitel steht das Fallbeispiel von Hans E. Bauers „Verkaufte Jahre“ im Mittelpunkt. Es wird der historische Kontext seines Lebens und Dienstes in der Fremdenlegion sowie dessen Analyse anhand der Kategorien „Innen“ und „Außen“ dargestellt.
Schlüsselwörter
Fremdenlegion, Kriegserfahrung, Indochinakrieg, Kameradschaft, Außenwelt, Erinnerung, Erfahrungsgeschichte, Deutsche, Frankreich, Militär, Geschichte, Sozialgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Warum traten Deutsche nach 1945 in die französische Fremdenlegion ein?
Viele suchten nach dem Krieg Abenteuer, eine Flucht vor der Armut oder eine neue Identität, da sie oft als "Asoziale" oder Heimatlose galten.
In welchen Kriegen wurden deutsche Legionäre eingesetzt?
Besonders prägend waren die Einsätze im Indochinakrieg (bis 1954) und im Algerienkrieg (bis 1962).
Wer war Hans E. Bauer und was beschreibt sein Buch "Verkaufte Jahre"?
Bauer war ein ehemaliger deutscher Legionär; sein Buch ist ein Erinnerungsbericht über seinen Dienst in Nordafrika und Indochina in den 1940er und 50er Jahren.
Was bedeutet der Begriff "Kriegserfahrung" in diesem Kontext?
Er beschreibt die psychologische und soziale Verarbeitung des Erlebten fern der Heimat unter den spezifischen Bedingungen einer Söldnertruppe.
Welche Rolle spielte die Kameradschaft in der Fremdenlegion?
Da die Legionäre von der zivilen Welt abgeschottet waren, bildete die Truppe einen "strengen Orden" mit eigenen Gesetzen, in dem Kameradschaft überlebenswichtig war.
Wie war das Verhältnis zwischen Legionären und Zivilisten?
Legionäre wurden von der Außenwelt oft mit Misstrauen, Angst oder Verachtung betrachtet und lebten in einer fast vollständigen sozialen Isolation.
- Arbeit zitieren
- Anne Krier (Autor:in), 2006, Deutsche in der französischen Fremdenlegion nach 1945, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71628