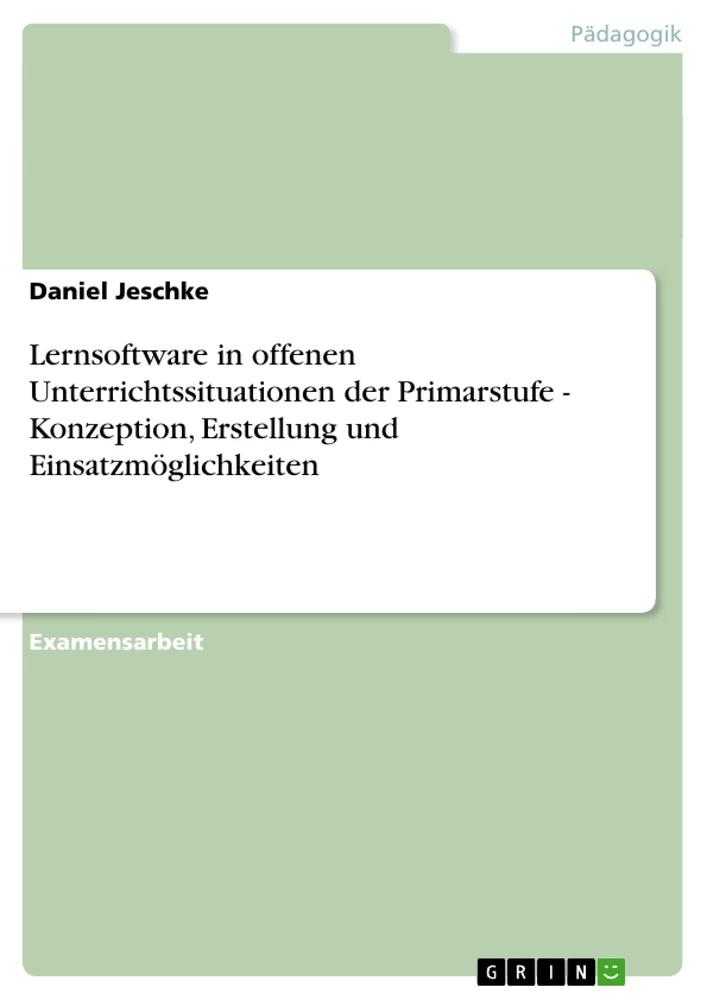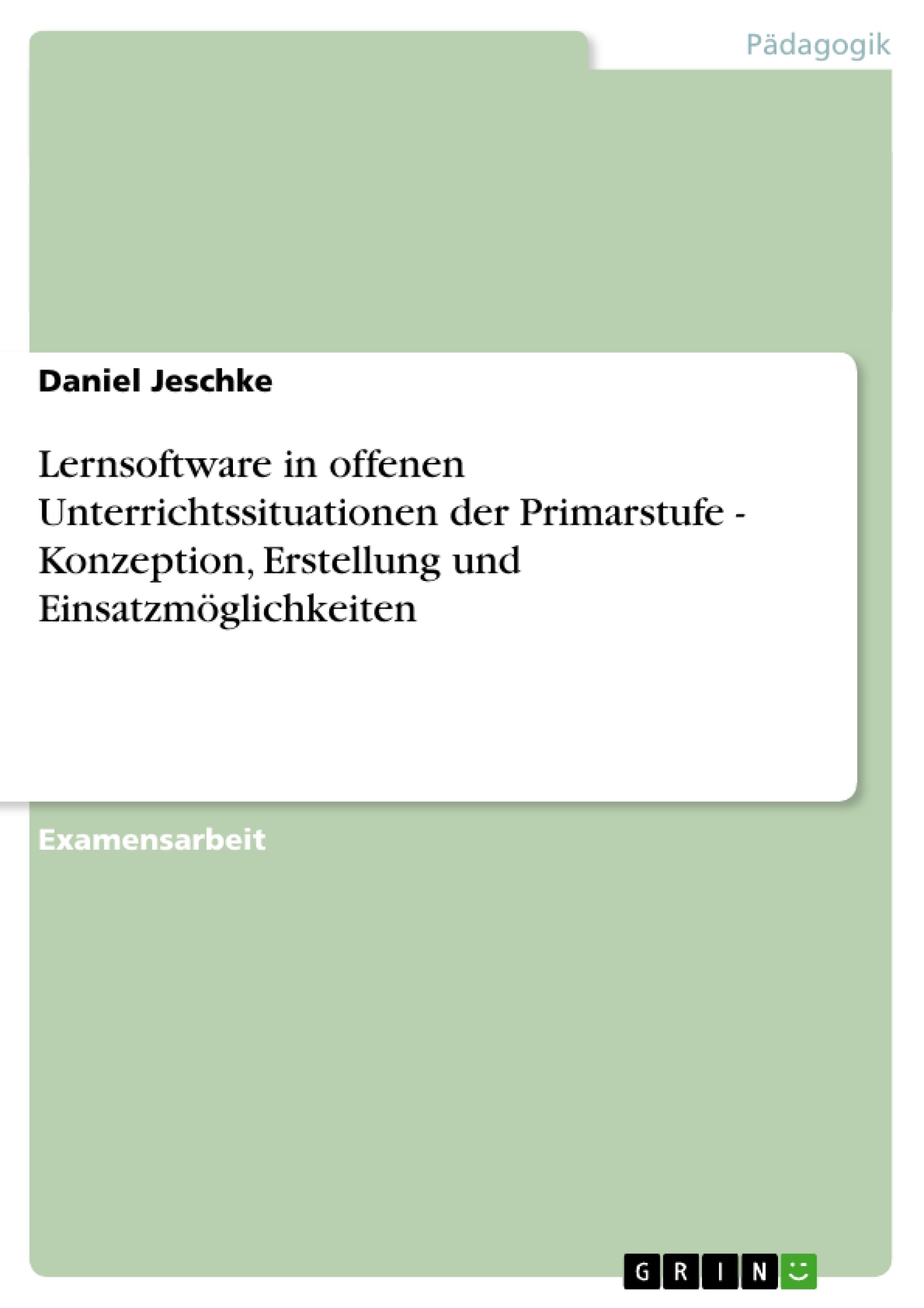Vorab möchte ich darauf hinwiesen, dass ich in dieser Arbeit, aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form von Lehrerinnen und Lehrern bzw. Schülerinnen und Schülern benutze, damit aber beide Geschlechter meine.
Der Begriff Offener Unterricht ist aus der Praxis und Theorie der Schule nicht mehr weg zu denken. Vor allem geht mit dem Begriff Öffnung ein Einwirken der Lebenswelt der Kinder auf den Schulischen Alltag einher. Der Computer ist schon seit langem Teil unserer Welt sowie der Welt der Kinder. Daher stellt sich die Frage, wie der Einsatz von Software in geöffneten Unterrichtssituationen zu gestalten ist. Meine Arbeit gliedert sich daher in zwei Hauptteile: Teil I: Offne Lernsituationen
Zunächst stelle ich die für meine Arbeit relevanten Lerntheoretischen Grundlagen vor, da auf diese im Verlauf der nächsten Kapitel immer wieder zurückgegriffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen
- Teil I: Offene Lernsituationen
- Lerntheoretische Grundlagen
- Behaviorismus
- Kognitivismus
- Konstruktivismus
- Offener Unterricht
- Historische Entwicklung
- Definitionen
- Begründungszusammenhänge für eine Öffnung des Unterrichts
- Freiarbeit als Umsetzungsform der Öffnung von Unterricht
- Teil II: Lernsoftware
- Lernsoftware
- Klassifizierung von Lernsoftware
- Anforderungen an Lernsoftware
- Konstruktion von Lernsoftware
- Softwarearrangement in der Freiarbeit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz von Lernsoftware in offenen Unterrichtssituationen der Primarstufe. Sie setzt sich zum Ziel, die Konzeption, Erstellung und Einsatzmöglichkeiten von Lernsoftware im Kontext des offenen Unterrichts zu beleuchten. Dabei werden die lerntheoretischen Grundlagen des offenen Unterrichts sowie die verschiedenen Lernsoftware-Klassen betrachtet und in Bezug auf ihre Eignung für die Freiarbeit analysiert.
- Lerntheoretische Grundlagen des offenen Unterrichts
- Konzeption und Einsatz von Lernsoftware in der Primarstufe
- Klassifizierung und Analyse verschiedener Lernsoftware-Klassen
- Anforderungen an Lernsoftware im Kontext der Freiarbeit
- Entwicklung eines Softwarearrangements für den offenen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitende Bemerkungen: Die Einleitung führt in die Thematik des offenen Unterrichts und den Einsatz von Lernsoftware ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Lerntheoretische Grundlagen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus) vor und diskutiert ihre Bedeutung für das Verständnis des offenen Unterrichts.
- Offener Unterricht: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des offenen Unterrichts, verschiedene Definitionsansätze und die Begründungszusammenhänge für eine Öffnung des Unterrichts.
- Freiarbeit als Umsetzungsform der Öffnung von Unterricht: Dieses Kapitel fokussiert auf die Freiarbeit als didaktisches Konzept, das eine konsequente Umsetzung des offenen Unterrichts darstellt. Es beschreibt die Anforderungen an Schüler, Lehrer, Arbeitsmaterial und Arbeitsraum sowie die Phasen der Freiarbeit.
- Lernsoftware: Dieses Kapitel klassifiziert verschiedene Lernsoftware-Klassen und diskutiert ihre jeweiligen Eigenschaften. Es werden auch die Anforderungen an Lernsoftware in der Freiarbeit betrachtet.
- Konstruktion von Lernsoftware: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorteile individualisierter Lernsoftware und präsentiert ein erarbeitetes Softwarearrangement-Konzept für die Freiarbeit.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Lernsoftware, Freiarbeit, Konstruktivismus, Individualisierung, Softwarearrangement, Primarstufe.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Lernsoftware im offenen Unterricht?
Lernsoftware dient als Werkzeug zur Individualisierung und Unterstützung in Freiarbeitsphasen, indem sie Schülern ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zu lernen.
Welche lerntheoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit erläutert den Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus und deren Bedeutung für das Lernen mit Software.
Was sind die Anforderungen an Lernsoftware in der Primarstufe?
Software muss für die Freiarbeit geeignet sein, klare pädagogische Ziele verfolgen und eine intuitive Bedienung für Grundschüler ermöglichen.
Wie wird "Offener Unterricht" in der Arbeit definiert?
Es wird als pädagogisches Konzept beschrieben, bei dem die Lebenswelt der Kinder einbezogen wird und die Schüler mehr Mitbestimmung über ihren Lernprozess haben.
Was ist ein "Softwarearrangement" in der Freiarbeit?
Es handelt sich um ein konzeptionelles Modell, wie verschiedene Softwareprogramme sinnvoll in den Unterrichtsalltag integriert werden können.
- Quote paper
- Daniel Jeschke (Author), 2006, Lernsoftware in offenen Unterrichtssituationen der Primarstufe - Konzeption, Erstellung und Einsatzmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71428