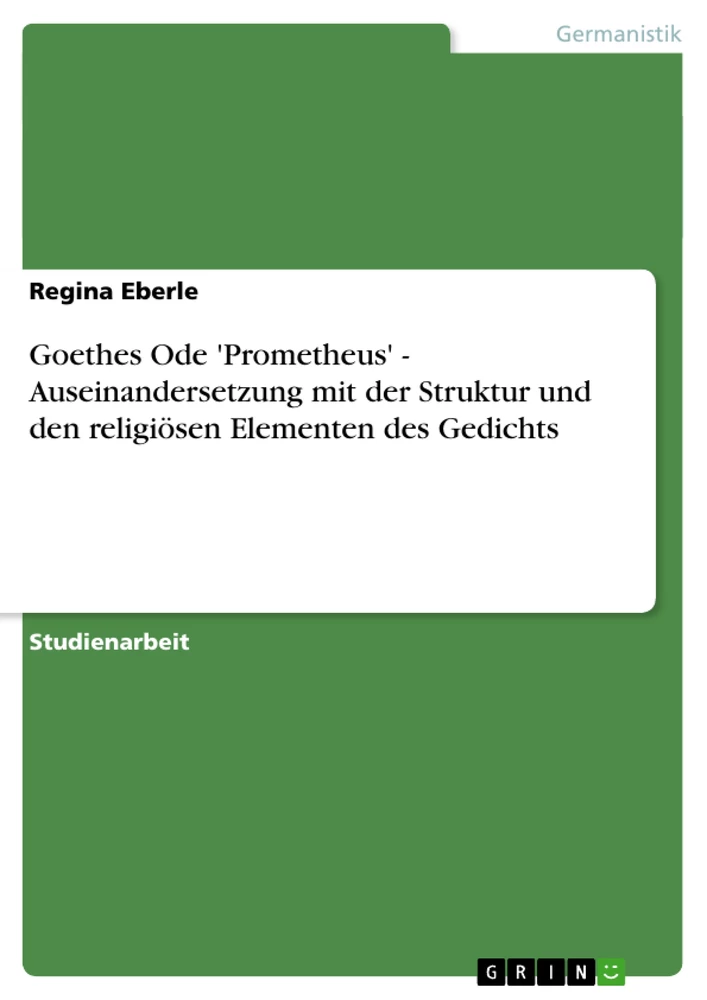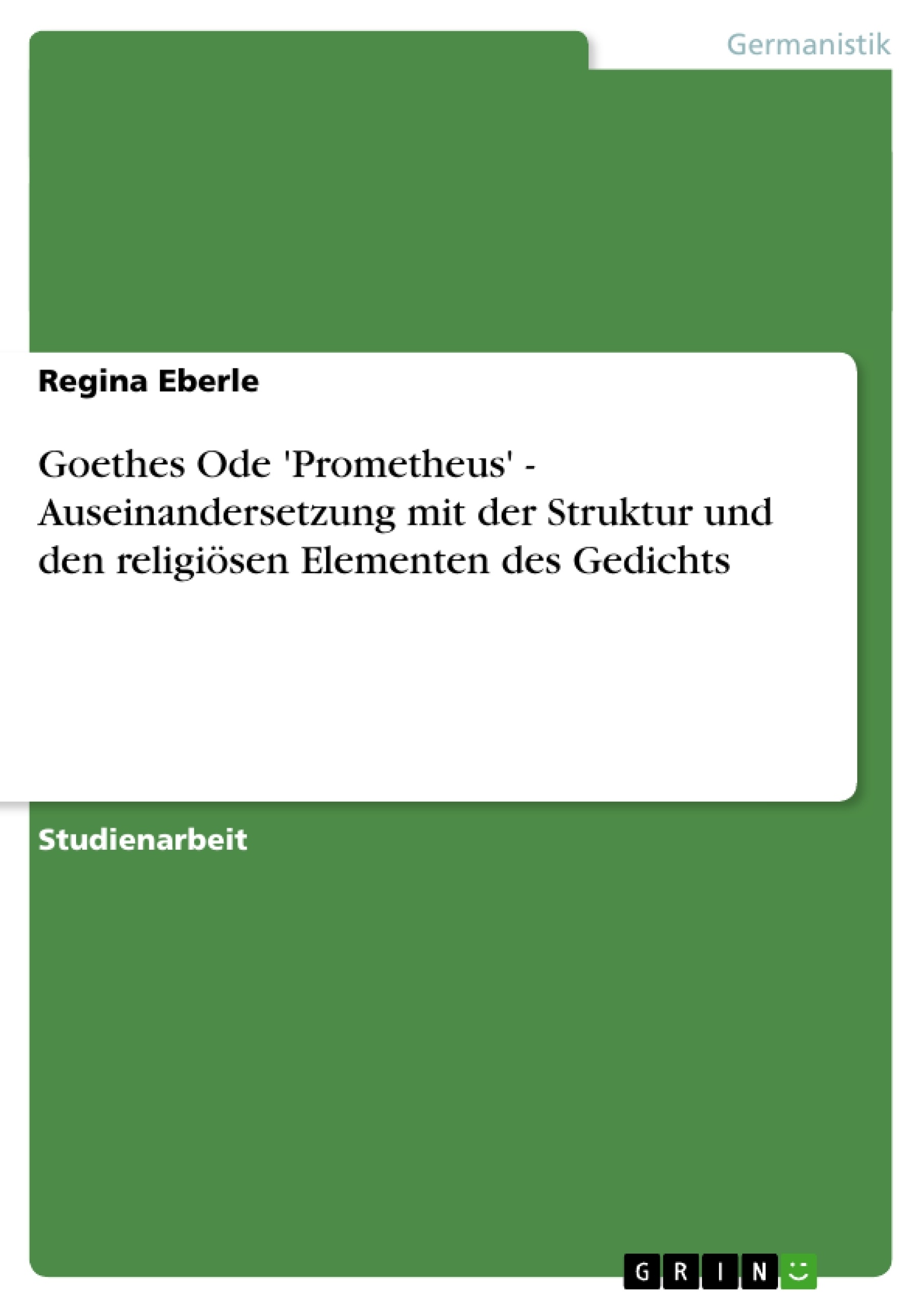Die Ode „Prometheus“ wurde zwischen 1773 und 1775 von Johann Wolfgang von Goethe verfasst, jedoch erst 1785 von Friedrich Heinrich Jacobi ohne Autorisierung Goethes veröffentlicht.
Sie gilt „als Programmgedicht der Sturm-und-Drang-Epoche“ und gehört laut Matthias Luserke zu den innovativsten lyrischen Zeugnissen der Literatur dieser Zeit .
In der Tat ist die Ode beispielhaft für die damalige Literatur, da sie das epochentypische Genie-Ideal, die Abwendung von tradierten Autoritäten, die Möglichkeit eigener Schöpfungskraft sowie das Recht auf Selbstbestimmung einhergehend mit einer Loslösung von den christlichen Gottesvorstellungen thematisiert.
Gerade der Aspekt der Religionskritik wurde und wird viel diskutiert, doch eine einheitliche Deutung ist nahezu unmöglich, da sich das Gedicht durch seine Mehrdeutigkeit einer eindeutigen Interpretation entzieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Inhaltsangabe
- 3. Formaler und sprachlicher Aufbau der Ode
- 3.1 Zur Gattungsform der Ode
- 3.2 Art des Gedichtes
- 3.3 Rhythmus
- 3.4 Wortwahl
- 4. Interpretation
- 4.1 Die Hymnen-/Gebetsform des Gedichts
- 4.2 Die Zeusfigur
- 4.3 Religiöse Elemente
- 4.3.1 Übertragung der antiken Mythologie auf christliche Glaubensbilder
- 4.3.2 Die Verwendung bzw. Kontrafraktur biblischer Psalmen
- 4.3.3 Andere religionskritische Anspielungen
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Goethes Ode „Prometheus“, indem sie die Struktur und die religiösen Elemente des Gedichts untersucht. Ziel ist es, die Bedeutung des Gedichts im Kontext der Sturm-und-Drang-Epoche zu beleuchten und verschiedene Interpretationen zu diskutieren.
- Die Abwendung von traditionellen Autoritäten und die Betonung der individuellen Schöpfungskraft
- Die Kritik an den christlichen Gottesvorstellungen und die religionskritischen Aspekte
- Das Genie-Ideal der Sturm-und-Drang-Epoche und seine Manifestation in Prometheus
- Der formale und sprachliche Aufbau der Ode und seine Bedeutung für die Interpretation
- Die Mehrdeutigkeit des Gedichts und die Herausforderungen seiner Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung präsentiert Goethes Ode „Prometheus“ als ein Schlüsselwerk der Sturm-und-Drang-Epoche, das die epochentypischen Themen wie Genie-Ideal, Selbstbestimmung und Abwendung von traditionellen Autoritäten behandelt. Besonders hervorgehoben wird die religionskritische Dimension des Gedichts und die damit verbundene Mehrdeutigkeit, die eine eindeutige Interpretation erschwert. Die Einführung legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Analyse.
2. Inhaltsangabe: Dieses Kapitel fasst den Inhalt der Ode zusammen, indem es die zentrale Anklage Prometheus gegen Zeus beschreibt. Es wird aufgezeigt, wie Prometheus die Götter verhöhnt und ihre Macht in Frage stellt, insbesondere durch die Betonung ihrer Dekadenz und Unfähigkeit, im Gegensatz zu seiner eigenen schöpferischen Kraft. Die Darstellung der Enttäuschung Prometheus' und seine anschließende Selbstbehauptung bilden den Kern der Zusammenfassung.
3. Formaler und sprachlicher Aufbau der Ode: Dieser Abschnitt analysiert den formalen und sprachlichen Aufbau des Gedichts. Es wird die Gattungsform der Ode im 18. Jahrhundert erläutert und ihr Vergleich mit griechischen Hymnen hergestellt, wobei die Umkehrung der typischen Elemente und der freie Rhythmus hervorgehoben werden. Die Charakterisierung als Rollengedicht mit Prometheus als „Experimentalfigur“ wird diskutiert, sowie der Einfluss des freien Rhythmus und der Verzicht auf ein Reimschema auf die Vermittlung von Freiheit und Emotionalität.
Schlüsselwörter
Prometheus, Sturm und Drang, Ode, Religionskritik, Genie-Ideal, Selbstbestimmung, Mythologie, christliche Glaubensbilder, sprachlicher Aufbau, Interpretation, Mehrdeutigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse von Goethes "Prometheus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Ode "Prometheus" unter Berücksichtigung ihrer Struktur, religiöser Elemente und Bedeutung im Kontext der Sturm-und-Drang-Epoche. Sie beleuchtet verschiedene Interpretationen und untersucht die Mehrdeutigkeit des Gedichts.
Welche Aspekte von Goethes "Prometheus" werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Inhaltsangabe, den formalen und sprachlichen Aufbau (Gattungsform, Rhythmus, Wortwahl), die Interpretation (Hymnen-/Gebetsform, Zeusfigur, religiöse Elemente, inklusive der Übertragung antiker Mythologie auf christliche Glaubensbilder und der Verwendung biblischer Psalmen), sowie ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Besonderes Augenmerk liegt auf der religionskritischen Dimension und dem Genie-Ideal der Sturm-und-Drang-Epoche.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Abwendung von traditionellen Autoritäten, die Betonung der individuellen Schöpfungskraft, die Kritik an christlichen Gottesvorstellungen, das Genie-Ideal der Sturm-und-Drang-Epoche und seine Manifestation in Prometheus, den formalen und sprachlichen Aufbau der Ode und dessen Bedeutung für die Interpretation, sowie die Mehrdeutigkeit des Gedichts und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Interpretation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einführung, Inhaltsangabe, Analyse des formalen und sprachlichen Aufbaus (inklusive Unterkapiteln zu Gattungsform, Gedichtart, Rhythmus und Wortwahl), Interpretation (mit Unterkapiteln zur Hymnen-/Gebetsform, der Zeusfigur und den religiösen Elementen), Fazit und Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind Prometheus, Sturm und Drang, Ode, Religionskritik, Genie-Ideal, Selbstbestimmung, Mythologie, christliche Glaubensbilder, sprachlicher Aufbau, Interpretation und Mehrdeutigkeit.
Was ist das Ziel der Analyse?
Das Ziel ist es, die Bedeutung von Goethes "Prometheus" im Kontext der Sturm-und-Drang-Epoche zu beleuchten und verschiedene Interpretationen des Gedichts zu diskutieren, wobei besonders die religionskritischen Aspekte und die Mehrdeutigkeit des Textes im Fokus stehen.
Wie wird der formale Aufbau der Ode analysiert?
Die Analyse des formalen Aufbaus umfasst die Untersuchung der Gattungsform der Ode im 18. Jahrhundert, den Vergleich mit griechischen Hymnen, die Betrachtung des freien Rhythmus und des Verzichts auf ein Reimschema, sowie die Charakterisierung als Rollengedicht mit Prometheus als "Experimentalfigur". Der Einfluss des formalen Aufbaus auf die Vermittlung von Freiheit und Emotionalität wird diskutiert.
Wie werden die religiösen Elemente in "Prometheus" behandelt?
Die Analyse der religiösen Elemente untersucht die Hymnen-/Gebetsform des Gedichts, die Darstellung der Zeusfigur und die religionskritischen Aspekte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Übertragung antiker Mythologie auf christliche Glaubensbilder und der Verwendung bzw. Kontrafraktur biblischer Psalmen.
- Quote paper
- Regina Eberle (Author), 2004, Goethes Ode 'Prometheus' - Auseinandersetzung mit der Struktur und den religiösen Elementen des Gedichts , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71376