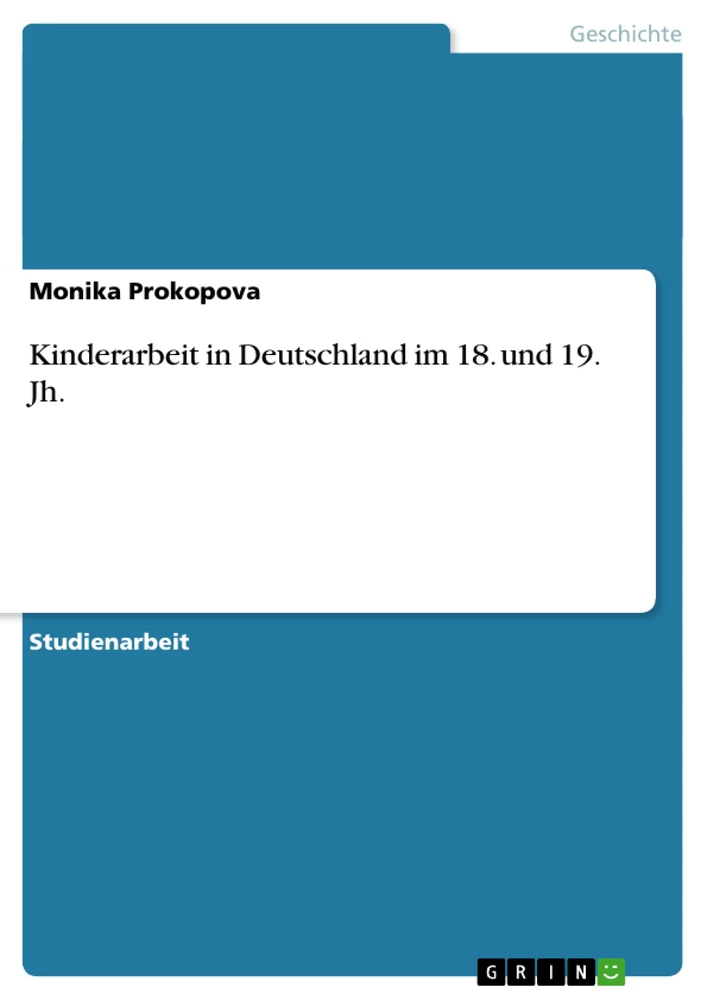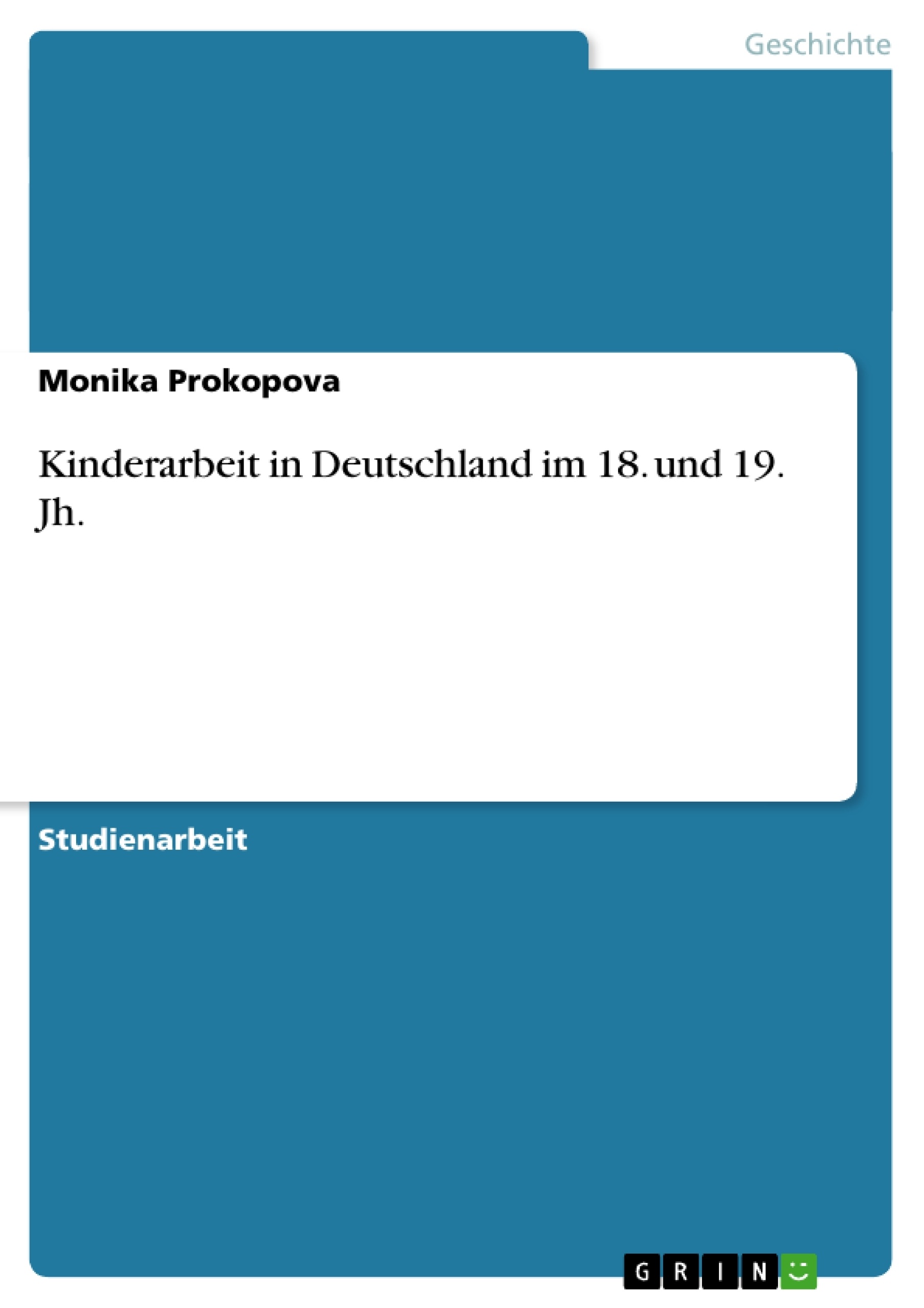Die Kinder haben immer gearbeitet. Sie mussten arbeiten. Die Agrargesellschaft wäre ohne die Kinderarbeit nicht auskommen, und niemand kam auf die Idee, dass die Kinder ihrer Zeit untätig verbringen sollten. Die ganze Geschichte von einem Jahrhundert zum anderen (1750-1870) ist voll von Kinderarbeit, langen Arbeitstagen und äußerster Anstrengung für ein Stückchen Brot.
Die Kinderarbeit gibt es bereits seit Menschengedenken, aber mit der
Industrialisierung nahm sie im 18. und 19. Jahrhundert in Europa und in den USA Ausmaße an, die die Gesundheit und Bildung der Bevölkerung massiv beeinträchtigten. Sie war die Arbeit von Kindern aller werktätigen Schichten, der Lohnarbeiter und der Bauern, der Handwerker, der kleinen Ladenbesitzer und anderer Schichten des Kleinbürgertums, wobei die einzelnen Schichten zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen starken Anteil der Kinder stellten.
In der vorliegenden Arbeit will ich darauf eingehen, warum Kinder im 18. und 19. Jahrhundert dazu gezwungen wurden, schon im jüngsten Alter Geld zu verdienen. Es sollen die Fragen nach dem Ausmaß der Kinderarbeit und warum der Staat erst so spät eingegriffen hat, beantwortet werden.
Außerdem wird zu folgender, diese Arbeit leitende Hypothese Stellung genommen.
Sie lautet: Die Kinderarbeit bewahrt ein wichtiges Merkmal der mittelalterlichen Gesellschaft, und zwar den frühzeitigen Eintritt in die Erwachsenenwelt.
Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, gehe ich zuerst in der ersten Hälfte der Arbeit auf die Kinderrechte vom 18. Jahrhundert und die Geschichte der Kindheit ein.
In der zweiten Hälfte werde ich versuchen auf die oben genannten Fragen Antworten zu finden.
Abschließen werde ich meine Ergebnisse zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kinderrechte und die Geschichte der Kindheit
- III. Kinderarbeit
- 3.1. Kinder als Bettler
- 3.2. Kinderarbeit in den Waisenhäusern
- 3.3. Kinderarbeit in der Landwirtschaft
- IV. Kinderarbeit zur Zeit der Industrialisierung
- 4.1. Gründe der industriellen Kinderarbeit
- 4.2. Die Arbeit der Kinder in den Fabriken
- 4.3. Die ersten Kinderarbeitschutzgesetze
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Kinderarbeit in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert. Ziel ist es, die Gründe für die weitverbreitete Kinderarbeit zu beleuchten und die verspätete Intervention des Staates zu erklären. Die Arbeit analysiert das Ausmaß der Kinderarbeit und befasst sich mit der Hypothese, dass die Kinderarbeit ein wichtiges Merkmal der mittelalterlichen Gesellschaft, nämlich den frühzeitigen Eintritt in die Erwachsenenwelt, bewahrt.
- Die Entwicklung des Kinderrechtsverständnisses im 18. und 19. Jahrhundert
- Das Ausmaß und die verschiedenen Formen der Kinderarbeit (Betteln, Waisenhäuser, Landwirtschaft, Fabriken)
- Die Ursachen der industriellen Kinderarbeit
- Die Rolle des Staates im Umgang mit Kinderarbeit
- Der Vergleich der Kindheitserfahrungen vergangener Epochen mit dem modernen Verständnis von Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Kinderarbeit im 18. und 19. Jahrhundert ein und betont deren weitverbreitete Existenz in der Agrargesellschaft. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für die Kinderarbeit und die späte staatliche Intervention. Die Arbeit formuliert die Hypothese, dass die Kinderarbeit den frühzeitigen Eintritt in die Erwachsenenwelt widerspiegelt, ein Merkmal mittelalterlicher Gesellschaften. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei die erste Hälfte den Kinderrechten und der Geschichte der Kindheit gewidmet ist und die zweite Hälfte die Forschungsfragen bearbeitet.
II. Kinderrechte und die Geschichte der Kindheit: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Kinderrechtsverständnisses. Es wird deutlich, dass der Begriff "Kinderrechte" in der älteren Literatur kaum vorkommt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Begriffs "Kindheit" selbst. Im Gegensatz zum modernen Verständnis, das Kindheit als eine eigenständige Phase mit spezifischen Merkmalen (Spiel, Schule, Freizeit) sieht, argumentiert das Kapitel, dass in früheren Epochen Kinder oft wie kleine Erwachsene behandelt wurden und frühzeitig in die Arbeitswelt integriert waren. Der Vergleich von Bildern und Schilderungen aus verschiedenen Epochen veranschaulicht die Unterschiede im Verständnis von Kindheit. Die Arbeit von Philippe Aries wird herangezogen, um die historische Perspektive zu beleuchten und die These zu unterstützen, dass das Verständnis von Kindheit als eigenständige Lebensphase eine relativ moderne Entwicklung ist.
Schlüsselwörter
Kinderarbeit, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Deutschland, Industrialisierung, Kinderrechte, Geschichte der Kindheit, Agrargesellschaft, Sozialisation, Arbeitsschutzgesetze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Kinderarbeit in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Kinderarbeit in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Gründe für die weitverbreitete Kinderarbeit und die verspätete Intervention des Staates. Die Arbeit analysiert das Ausmaß der Kinderarbeit und befasst sich mit der Hypothese, dass die Kinderarbeit ein wichtiges Merkmal der mittelalterlichen Gesellschaft, nämlich den frühzeitigen Eintritt in die Erwachsenenwelt, bewahrt.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Kinderrechtsverständnisses im 18. und 19. Jahrhundert, das Ausmaß und die verschiedenen Formen der Kinderarbeit (Betteln, Waisenhäuser, Landwirtschaft, Fabriken), die Ursachen der industriellen Kinderarbeit, die Rolle des Staates im Umgang mit Kinderarbeit und einen Vergleich der Kindheitserfahrungen vergangener Epochen mit dem modernen Verständnis von Kindheit.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kinderrechte und die Geschichte der Kindheit, Kinderarbeit (mit Unterkapiteln zu Bettlern, Waisenhäusern und Landwirtschaft), Kinderarbeit zur Zeit der Industrialisierung (mit Unterkapiteln zu den Gründen, der Arbeit in Fabriken und den ersten Schutzgesetzen) und Zusammenfassung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, warum Kinderarbeit so weit verbreitet war und warum der Staat so spät intervenierte.
Welche Hypothese wird in der Arbeit aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass die Kinderarbeit den frühzeitigen Eintritt in die Erwachsenenwelt widerspiegelt, ein Merkmal mittelalterlicher Gesellschaften.
Welche Quellen werden verwendet?
Die bereitgestellte Vorschau nennt explizit die Arbeit von Philippe Aries als Quelle zur Beleuchtung der historischen Perspektive des Kinderverständnisses. Weitere Quellen werden nicht explizit genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderarbeit, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Deutschland, Industrialisierung, Kinderrechte, Geschichte der Kindheit, Agrargesellschaft, Sozialisation, Arbeitsschutzgesetze.
Wie wird die Kindheit in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit vergleicht das moderne Verständnis von Kindheit als eigenständige Phase mit dem Verständnis früherer Epochen, in denen Kinder oft wie kleine Erwachsene behandelt und frühzeitig in die Arbeitswelt integriert wurden.
Welche Rolle spielt der Staat in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Staates im Umgang mit Kinderarbeit und erklärt die verspätete Intervention des Staates im Kampf gegen die Kinderarbeit.
Wo finde ich mehr Informationen?
Die bereitgestellte Vorschau ist ein Auszug. Für detailliertere Informationen muss auf die vollständige Seminararbeit zugegriffen werden.
- Quote paper
- Monika Prokopova (Author), 2006, Kinderarbeit in Deutschland im 18. und 19. Jh., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71364