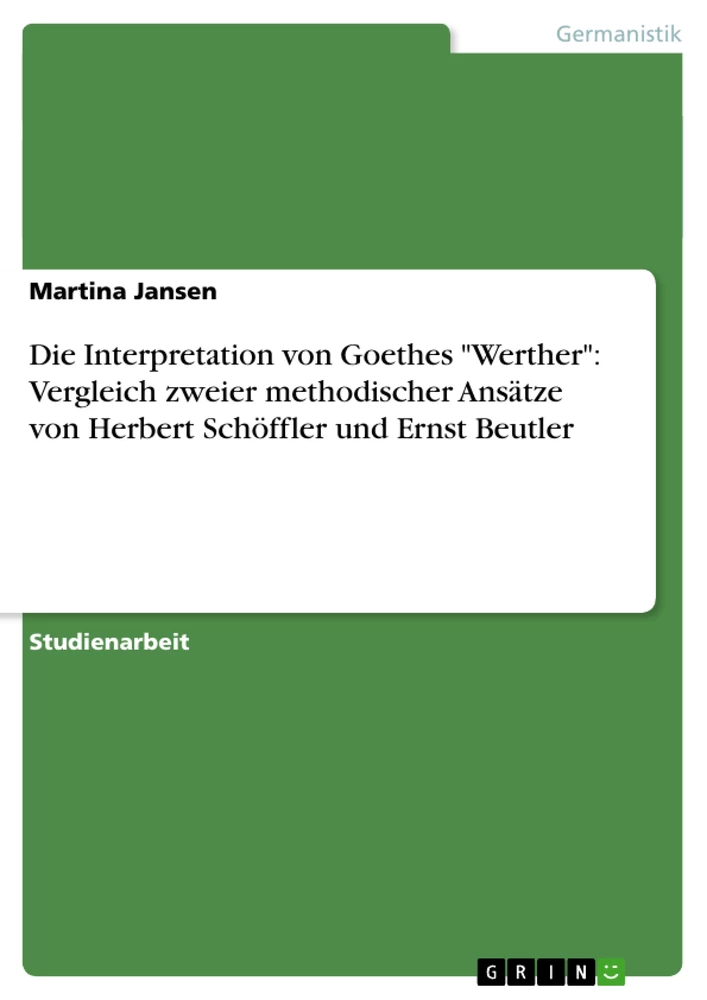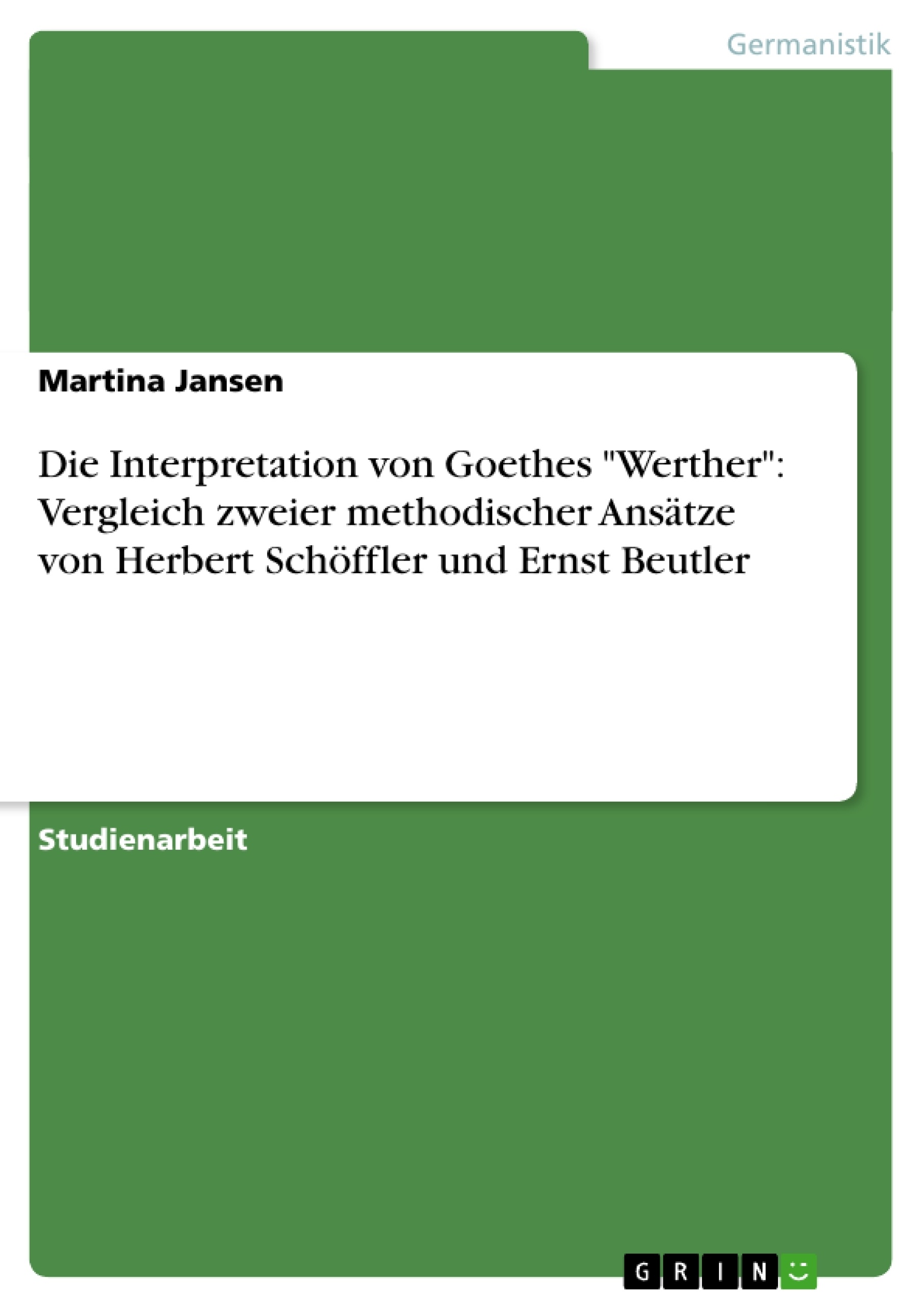1. Einleitung
Johann Wolfgang Goethe schuf mit seinem Briefroman Die Leiden des jungen Werthers, erstmals erschienen im Jahre 1774, ein Werk, das die Menschen seiner Zeit bewegte und zu vielerlei Interpretationen veranlasste. Noch heute wird es viel gelesen, im Schulunterricht behandelt und auf verschiedenste Weisen interpretiert, denn sein Stoff ist nach wie vor hochaktuell. Dies nicht zuletzt, weil der Roman nach seinem erscheinen ein regelrechtes Wertherfieber auslöste und auch zu kritischen Betrachtungen veranlasste.
Hier sollen zwei Interpretationsansätze genauer betrachtet werden, die im 20. Jahrhundert entstanden sind und die Vorgehensweise zweier methodischer Strömungen germanistischer Literaturwissenschaft veranschaulichen. Der zuerst betrachtete Ansatz von Ernst Beutler ist dem Positivismus zuzuschreiben, während die Interpretation Herbert Schöfflers Züge der geistesgeschichtlichen Methode aufweist. Wie im Folgenden zu erkennen sein wird, deuten die beiden Autoren das Werk Goethes auf unterschiedliche Weise, da sie Autor und Roman aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ihre Vorgehensweisen und die Unterschiede ihrer Deutungen sollen nun verglichen und kritisch diskutiert werden, wobei das Augenmerk auf Geistesgeschichte und Positivismus, den beiden literaturwissenschaftlichen Methoden, die in kritischem Bezug zueinander standen, liegen soll.
Im ersten Teil meiner Hausarbeit werde ich mich mit dem Interpretationsansatz Ernst Beutlers beschäftigen, sowie mit der positivistischen Methode an sich. Nachdem dann Herbert Schöfflers Interpretation in Hinblick auf die Geistesgeschichte betrachtet wurde, sollen zum Schluss noch einmal die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ernst Beutlers Interpretation: Wertherfragen
- 2.1 Inhalt und Kernaussagen der Interpretation
- 2.2 Die positivistische Interpretationsmethode
- 3. Herbert Schöfflers Interpretation: Die Leiden des jungen Werther. Ihr geistesgeschichtlicher Hintergrund.
- 3.1 Inhalt und Kernaussagen der Interpretation
- 3.2 Die geistesgeschichtliche Interpretationsmethode
- 4. Unterschiede der Deutungen Beutlers und Schöfflers
- 4.1 Methodische Unterschiede
- 4.2 Inhaltliche Unterschiede
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit vergleicht zwei Interpretationsansätze zu Goethes „Werther“: Ernst Beutlers positivistische und Herbert Schöfflers geistesgeschichtliche Lesart. Ziel ist es, die methodischen Unterschiede beider Ansätze herauszuarbeiten und ihre Auswirkungen auf die jeweilige Interpretation des Romans zu analysieren. Die Arbeit untersucht, wie die unterschiedlichen methodischen Zugänge zu unterschiedlichen Deutungen des Werkes führen.
- Positivistische vs. geistesgeschichtliche Interpretationsmethode
- Analyse der Kernaussagen beider Interpretationen
- Vergleich der methodischen Vorgehensweisen
- Untersuchung der inhaltlichen Unterschiede der Deutungen
- Bedeutung des Werther-Romans im Kontext der Epoche
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz von Goethes „Werther“ bis in die Gegenwart. Sie stellt die beiden zu vergleichenden Interpretationsansätze von Ernst Beutler (positivistisch) und Herbert Schöffler (geistesgeschichtlich) vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der methodischen Ansätze und der daraus resultierenden unterschiedlichen Deutungen des Romans. Die Einleitung begründet die Wahl der beiden Ansätze und die Relevanz des Vergleichs für das Verständnis des Werkes und der literaturwissenschaftlichen Methoden.
2. Ernst Beutlers Interpretation: Wertherfragen: Dieser Abschnitt analysiert Beutlers Interpretation, die in drei Teile gegliedert ist: das ertrunkene Mädchen, religiöse Hintergründe und die Frankfurter Szenerie. Beutler verbindet den Selbstmord des Mädchens mit Werthers Schicksal und sieht darin eine Vorwegnahme seines eigenen Untergangs. Der zweite Teil untersucht die religiösen Aspekte, indem er Goethes und Werthers Einstellungen zum Glauben beleuchtet. Beutler analysiert die Rolle der Figur der Frau des Pfarrers Griesbach und deren Einfluss auf Goethes Werk. Der dritte Teil konzentriert sich auf den Frankfurter Kontext und die realen Personen, die den Figuren im Roman zugrundeliegen. Die gesamte Interpretation zeichnet ein Bild von Werther, das stark von biographischen und historischen Details geprägt ist, die Beutler eingehend untersucht.
3. Herbert Schöfflers Interpretation: Die Leiden des jungen Werther. Ihr geistesgeschichtlicher Hintergrund.: Schöfflers Interpretation betrachtet "Werther" im Kontext der Geistesgeschichte. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung des Werkes im Lichte der zeitgenössischen philosophischen und religiösen Strömungen. Der Abschnitt analysiert wie Schöffler die geistesgeschichtlichen Einflüsse auf die Entstehung und die Bedeutung des Romans hervorhebt. Der Fokus liegt auf der Einbettung von Goethes Werk in die intellektuellen und kulturellen Entwicklungen seiner Zeit. Schöffler deutet "Werther" als Ausdruck der zeitgenössischen Sensibilität und der geistigen Umbrüche. Die Interpretation befasst sich u.a. mit der Frage nach dem Pantheismus in Werthers Gottesvorstellung - eine Sichtweise, die Beutler anders bewertet.
4. Unterschiede der Deutungen Beutlers und Schöfflers: Dieses Kapitel vergleicht die beiden vorgestellten Interpretationen. Es werden sowohl methodische als auch inhaltliche Unterschiede detailliert herausgearbeitet. Der Vergleich verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven und die Auswirkungen der gewählten Methoden auf die Interpretation. Es wird gezeigt, wie die unterschiedlichen methodischen Zugänge zu konträren Ergebnissen führen, ohne explizit auf die "richtige" Interpretation einzugehen.
Schlüsselwörter
Goethe, Werther, Interpretationsmethoden, Positivismus, Geistesgeschichte, Literaturwissenschaft, Briefroman, Selbstmord, Religion, Theismus, Pantheismus, Biographie, Frankfurt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Vergleich zweier Werther-Interpretationen"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit vergleicht zwei unterschiedliche Interpretationen von Goethes „Werther“: Ernst Beutlers positivistische und Herbert Schöfflers geistesgeschichtliche Lesart. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Methoden und der daraus resultierenden unterschiedlichen Deutungen des Romans.
Welche Interpretationsmethoden werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die positivistische Interpretationsmethode von Ernst Beutler mit der geistesgeschichtlichen Methode von Herbert Schöffler. Der Unterschied liegt im methodischen Ansatz: Beutler konzentriert sich auf biographische und historische Details, während Schöffler den Roman im Kontext der zeitgenössischen philosophischen und religiösen Strömungen betrachtet.
Welche Kernaussagen werden in den Interpretationen behandelt?
Die Arbeit analysiert die Kernaussagen beider Interpretationen. Beutler betont biographische und historische Details, die er mit dem Schicksal Werthers verbindet (z.B. das ertrunkene Mädchen, religiöse Hintergründe, die Frankfurter Szenerie). Schöffler hingegen untersucht den Roman im Kontext der Geistesgeschichte und hebt die Einflüsse zeitgenössischer philosophischer und religiöser Strömungen hervor, beispielsweise die Frage nach dem Pantheismus in Werthers Gottesvorstellung.
Wie werden die methodischen Unterschiede dargestellt?
Die methodischen Unterschiede werden detailliert herausgearbeitet und verglichen. Die Arbeit zeigt auf, wie die unterschiedlichen Ansätze zu verschiedenen Deutungen des Romans führen. Der Vergleich verdeutlicht die Auswirkungen der gewählten Methoden auf die Interpretation.
Welche inhaltlichen Unterschiede werden zwischen den Interpretationen festgestellt?
Die Arbeit identifiziert inhaltliche Unterschiede in der Deutung von Werther. Diese Unterschiede resultieren aus den unterschiedlichen methodischen Ansätzen. Beispielsweise wird die Interpretation der religiösen Aspekte bei Beutler und Schöffler unterschiedlich gewichtet und gedeutet.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Ernst Beutlers Interpretation, 3. Herbert Schöfflers Interpretation, 4. Unterschiede der Deutungen Beutlers und Schöfflers, 5. Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel konzentriert sich auf einen spezifischen Aspekt des Vergleichs der beiden Interpretationen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die methodischen Unterschiede zwischen Beutlers positivistischer und Schöfflers geistesgeschichtlicher Interpretation von Goethes „Werther“ herauszuarbeiten und die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die jeweilige Interpretation zu analysieren. Es geht darum, zu zeigen, wie unterschiedliche methodische Zugänge zu verschiedenen Deutungen des gleichen Werkes führen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Werther, Interpretationsmethoden, Positivismus, Geistesgeschichte, Literaturwissenschaft, Briefroman, Selbstmord, Religion, Theismus, Pantheismus, Biographie, Frankfurt.
- Quote paper
- Martina Jansen (Author), 2006, Die Interpretation von Goethes "Werther": Vergleich zweier methodischer Ansätze von Herbert Schöffler und Ernst Beutler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70870