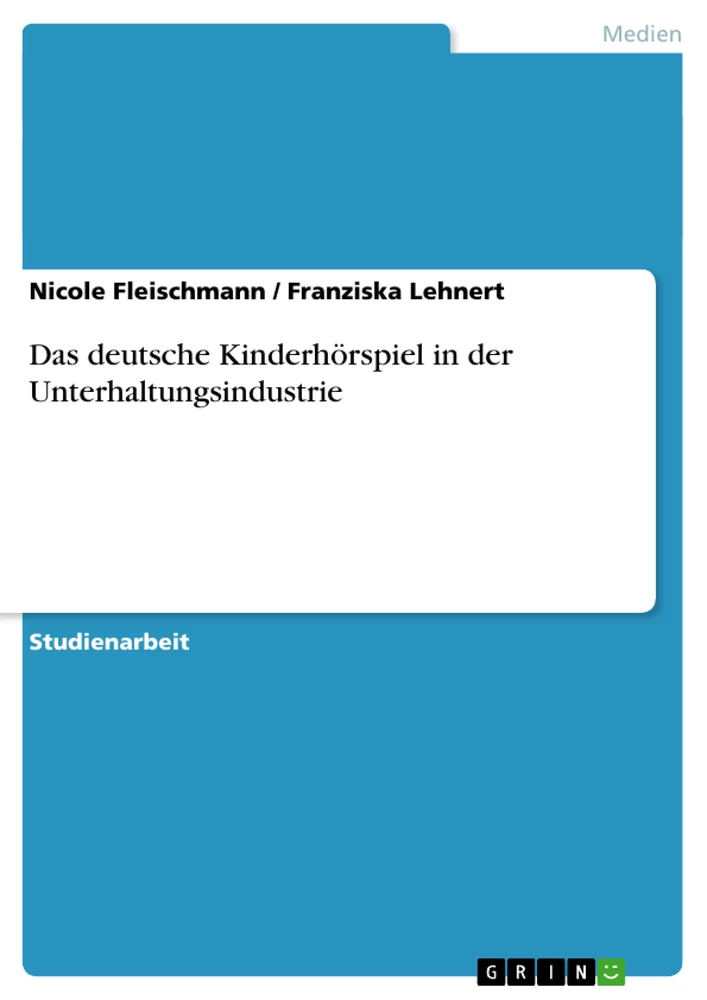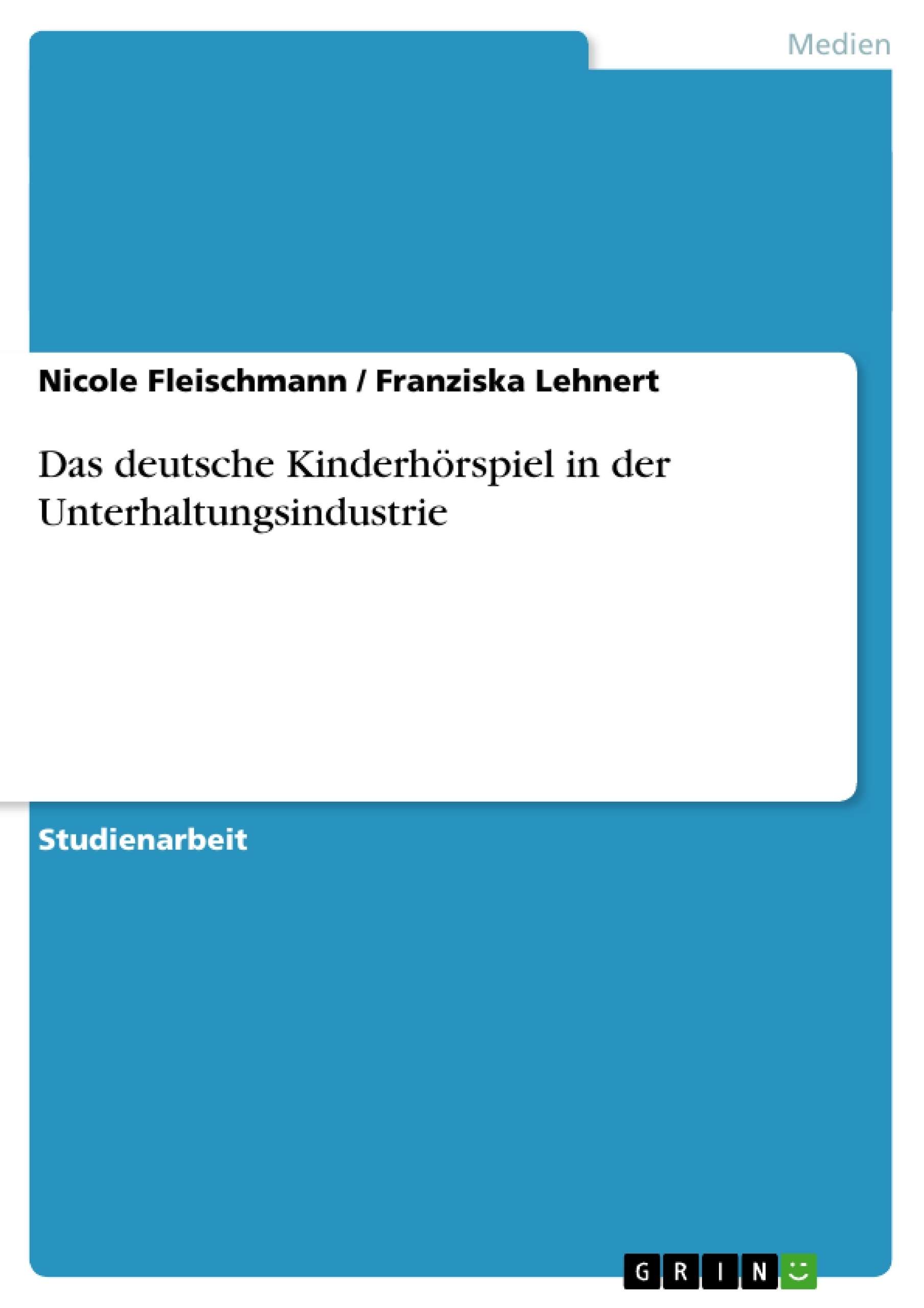Das Massenmedium Fernsehen ist mittlerweile zu einem selbstverständlichen Bestandteil im Alltag westlicher Kulturen geworden. War ein Fernsehgerät im eigenen Haushalt in den sechziger Jahren noch Luxus, so verfolgt uns die Bilderflut heute ins Kaufhaus, in den Schnellimbiss, zum Zahnarzt und auch im Flughafengebäude muss man nicht auf die „Tagesschau“ oder ähnliche Information- und Unterhaltungssendungen verzichten. Für uns Rezipienten ist diese audiovisuelle Darstellung durchaus angenehm, da der Mensch scheinbar von Natur aus Dingen eher Glauben schenkt, wenn er sie nicht nur hören, sondern vor allem auch sehen kann. Des Weiteren ist es für uns bequemer, Ereignisse anhand von Bildern präsentiert zu bekommen, da diese Form der Information keine großen Anforderungen an die Vorstellungskraft des Menschen stellt. Oder wer kann schon einen Film verfolgen ohne dabei auf das Bild zu achten? Zwar wird das Fernsehprogramm zwischenzeitlich teilweise schon so gestaltet, dass es dem Rezipienten auch ohne ständigen Blickkontakt möglich ist es zu verfolgen, dennoch ist dies eher die Ausnahme als die Regel und die Dominanz der Visualität somit ungebrochen. Die Auditivität als eigenständiges Gebilde gerät zunehmend in den Hintergrund. Möglicherweise ist dies ein Grund, weshalb das Hörspiel als rein auditives Konstrukt seine ursprünglich hohe Bedeutung mehr und mehr zu verlieren scheint und nur noch für eine begrenzte Anzahl „echter“ Liebhaber interessant ist. Anlass genug der Geschichte und aktuellen Relevanz des Hörspiels auf den Grund zu gehen. Da es auch heute noch vor allem Kinder sind, die Hörspiele rezipieren, wollen wir uns speziell damit beschäftigen: Welche Rolle spielt das Hörspiel in der Entwicklung des Kindes? Welche Besonderheiten weist das Kind als Rezipient auf? Was ist das Charakteristische am Kinderhörspiel? Diese und andere Gesichtspunkte seien hier unter dem Thema „Das deutsche Kinderhörspiel in der Unterhaltungsindustrie“ näher beleuchtet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte des Kinderhörspiels
- Das Kinderhörspiel im Rundfunk
- Von den Anfängen bis zum Dritten Reich
- Von der Nachkriegszeit bis heute
- Das Kinderhörspiel in der Unterhaltungsindustrie
- Der Markt
- Besonderheiten gegenüber dem Rundfunkhörspiel
- Das Kinderhörspiel im Rundfunk
- Das Kind als aktiver Rezipient
- Eigenschaften des Kinderhörspiels
- Länge
- Musik
- Töne/Geräusche
- Sprecher
- Technik
- Das Kinderhörspiel und seine verschiedenen Zielgruppen
- Das Hörspiel im Kindergarten (3 – 6 jährige Kinder)
- Das Hörspiel in der Grundschule (7 – 10 jährige Kinder)
- Das Hörspiel in der Sekundarstufe (13 – 16 jährige)
- Zwei Hörspiele aus unterschiedlichen Epochen im Vergleich
- Hänsel und Gretel
- Allgemeine Informationen
- Bibi Blocksberg
- Allgemeine Informationen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Übersicht
- Hänsel und Gretel
- Abschluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und die aktuelle Relevanz des deutschen Kinderhörspiels, insbesondere dessen Rolle in der Unterhaltungsindustrie. Es wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung das Hörspiel in der kindlichen Entwicklung spielt und welche spezifischen Eigenschaften das Kinderhörspiel auszeichnen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Besonderheiten des Mediums und seiner verschiedenen Zielgruppen.
- Die historische Entwicklung des Kinderhörspiels vom Rundfunk zur Unterhaltungsindustrie.
- Das Kind als aktiver Rezipient und seine spezifischen Bedürfnisse im Umgang mit dem Medium.
- Charakteristische Merkmale des Kinderhörspiels hinsichtlich Länge, Musik, Geräuschen, Sprechern und Technik.
- Unterschiede im Kinderhörspiel für verschiedene Altersgruppen (Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe).
- Vergleich verschiedener Kinderhörspiele aus unterschiedlichen Epochen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die zunehmende Dominanz der visuellen Medien im Vergleich zur Auditivität. Sie argumentiert, dass das Hörspiel, insbesondere das Kinderhörspiel, trotz seines Rückgangs im Vergleich zum Fernsehen weiterhin relevant ist und eine nähere Untersuchung verdient. Die Arbeit fokussiert sich auf die Rolle des Kinderhörspiels in der Entwicklung des Kindes und seine Besonderheiten als Medium.
Die Geschichte des Kinderhörspiels: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Kinderhörspiels, beginnend mit seinen Anfängen im Rundfunk in den 1920er Jahren. Es differenziert zwischen dem Hörspiel im Rundfunk und in der Unterhaltungsindustrie und stellt den Wandel vom Rundfunkprodukt zum Massenmarktprodukt dar. Die Bedeutung von Märchen als frühen Inhalten und die technischen Herausforderungen der frühen Hörspielproduktion werden ebenfalls thematisiert.
Das Kind als aktiver Rezipient: Dieses Kapitel (welches im Originaltext nicht weiter ausgeführt wird) würde sich mit den kognitiven und emotionalen Aspekten des kindlichen Hörerlebens befassen. Es würde die aktive Rolle des Kindes beim Rezipieren von Hörspielen hervorheben und die Besonderheiten der kindlichen Wahrnehmung und Interpretation auditiver Inhalte untersuchen. Die Einbeziehung verschiedener psychologischer und pädagogischer Ansätze wäre hier von Bedeutung.
Eigenschaften des Kinderhörspiels: Dieses Kapitel (ebenfalls ohne weitere Angaben im Originaltext) untersucht die spezifischen Merkmale von Kinderhörspielen im Vergleich zu Hörspielen für Erwachsene. Es analysiert Aspekte wie die Länge der Sendungen, die Rolle von Musik und Geräuschen, die Auswahl der Sprecher und die technische Gestaltung. Die Kapitel würden die unterschiedlichen Anforderungen an die Gestaltung von Kinderhörspielen für verschiedene Altersgruppen detailliert beleuchten.
Das Kinderhörspiel und seine verschiedenen Zielgruppen: Dieses Kapitel (ebenfalls ohne weitere Angaben im Originaltext) untersucht die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen verschiedener Altersgruppen von Kindern (Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe) in Bezug auf Kinderhörspiele. Es würde die verschiedenen inhaltlichen und formalen Gestaltungsmerkmale untersuchen, die für die jeweiligen Altersgruppen geeignet sind, um deren Entwicklung und Interessen zu berücksichtigen. Der Vergleich verschiedener Hörspielformate für unterschiedliche Zielgruppen würde das Kapitel abrunden.
Schlüsselwörter
Kinderhörspiel, Rundfunk, Unterhaltungsindustrie, Medienentwicklung, kindliche Entwicklung, Rezeption, Auditivität, Hörspielgeschichte, Zielgruppenanalyse, Altersgruppen, Märchen, Technik, Musik, Geräusche.
Häufig gestellte Fragen zum Kinderhörspiel
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Thema Kinderhörspiel?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das deutsche Kinderhörspiel. Sie untersucht die Geschichte des Mediums, von seinen Anfängen im Rundfunk bis zur heutigen Unterhaltungsindustrie. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der spezifischen Eigenschaften von Kinderhörspielen und deren Anpassung an verschiedene Altersgruppen (Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe). Die Arbeit vergleicht außerdem Hörspiele aus unterschiedlichen Epochen und beleuchtet die Rolle des Kindes als aktiven Rezipienten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Geschichte des Kinderhörspiels (inkl. Rundfunk und Unterhaltungsindustrie), Das Kind als aktiver Rezipient, Eigenschaften des Kinderhörspiels (Länge, Musik, Geräusche, Sprecher, Technik), Das Kinderhörspiel und seine verschiedenen Zielgruppen, Zwei Hörspiele aus unterschiedlichen Epochen im Vergleich (Hänsel und Gretel, Bibi Blocksberg) und Abschluss und Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Geschichte und aktuelle Relevanz des deutschen Kinderhörspiels, insbesondere dessen Rolle in der Unterhaltungsindustrie. Sie analysiert die Bedeutung des Hörspiels in der kindlichen Entwicklung und die spezifischen Eigenschaften des Mediums, mit Fokus auf die Besonderheiten und die verschiedenen Zielgruppen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Kinderhörspiels, das Kind als aktiven Rezipienten und dessen Bedürfnisse, charakteristische Merkmale des Kinderhörspiels (Länge, Musik, Geräusche etc.), Unterschiede im Kinderhörspiel für verschiedene Altersgruppen und den Vergleich verschiedener Kinderhörspiele aus unterschiedlichen Epochen.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die Relevanz des Kinderhörspiels. Das Kapitel zur Geschichte beschreibt die Entwicklung vom Rundfunk zur Unterhaltungsindustrie. Die Kapitel zum Kind als Rezipient und den Eigenschaften des Kinderhörspiels werden, da der Originaltext keine Details enthält, nur kurz angedeutet und deren Forschungsbedarf verdeutlicht. Das Kapitel zu den Zielgruppen beschreibt die verschiedenen Altersgruppen und ihre Bedürfnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderhörspiel, Rundfunk, Unterhaltungsindustrie, Medienentwicklung, kindliche Entwicklung, Rezeption, Auditivität, Hörspielgeschichte, Zielgruppenanalyse, Altersgruppen, Märchen, Technik, Musik, Geräusche.
Welche Hörspielbeispiele werden im Vergleich analysiert?
Die Arbeit vergleicht die Hörspiele "Hänsel und Gretel" und "Bibi Blocksberg" aus unterschiedlichen Epochen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Nicole Fleischmann (Autor:in), Franziska Lehnert (Autor:in), 2003, Das deutsche Kinderhörspiel in der Unterhaltungsindustrie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70812