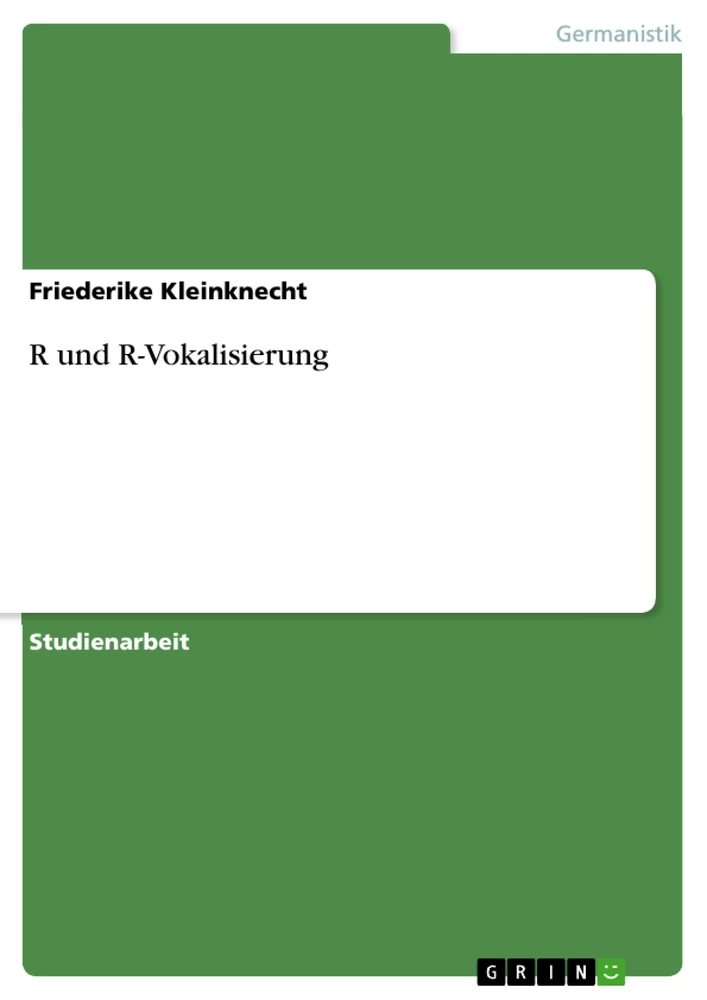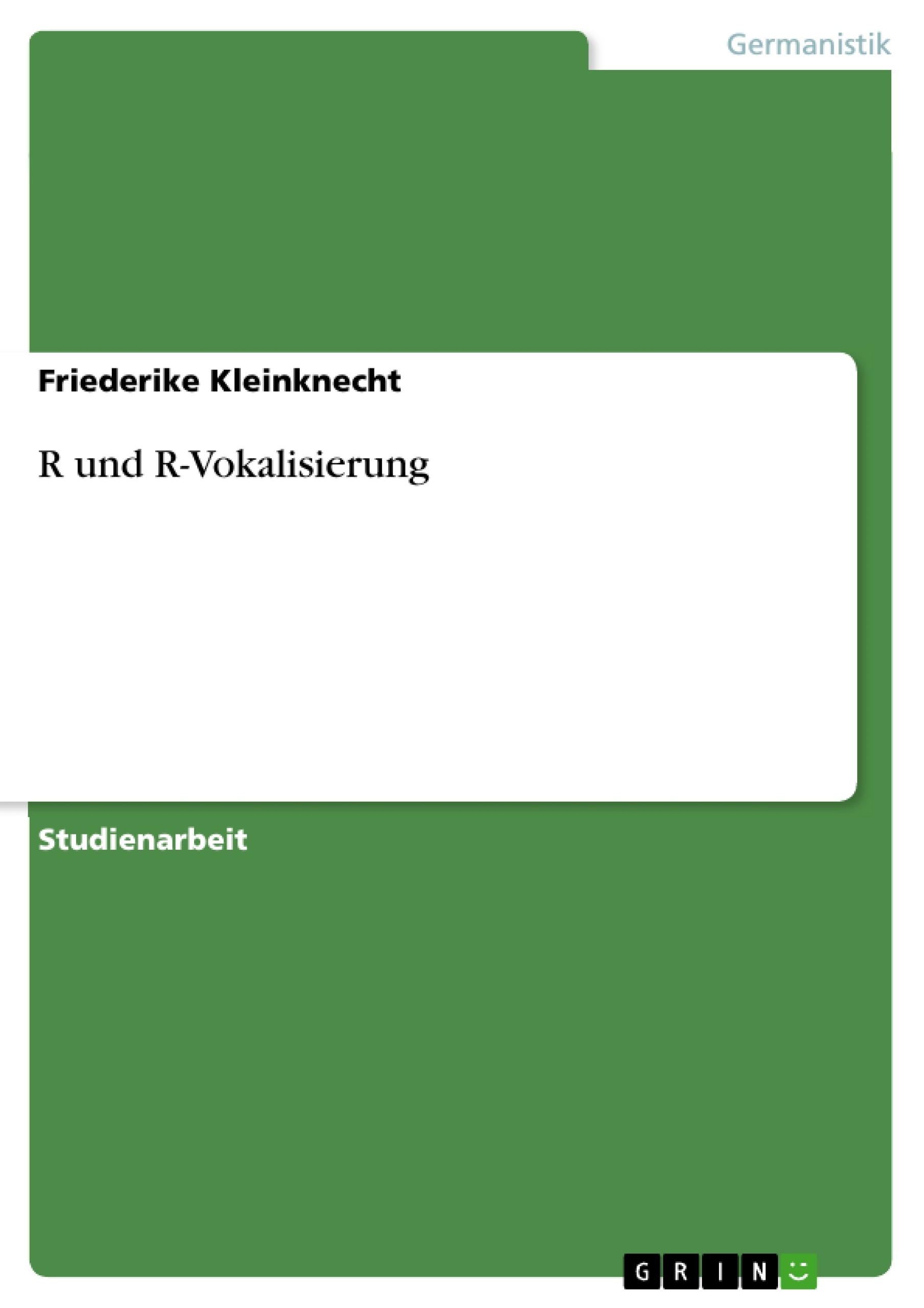Das R ist im Deutschen eines der komplexesten Phoneme und verrät in seiner Artikulation mit am leichtesten einen regionalen oder ausländischen Akzent. Es kennt eine Reihe von Allophonen, von denen einige freie (bzw. regional bedingte), andere kontextabhängige Varianten sind; ihre richtige Anwendung ist zwar nicht von bedeutungsunterscheidender Relevanz (vgl. den Begriff „System“ bei Coseriu, s.u.), doch wird eine Abweichung sofort bemerkt („Norm“ bei Coseriu).
Seit Ende des 19. Jahrhunderts finden sich in der Literatur immer wieder Anmerkungen und erste Aufsätze über die R-Aussprache im Deutschen, auffälligerweise anfänglich zumeist unter dem Aspekt der Normgerechtheit. Im 20. Jahrhundert folgen weitere Publikationen, längere Aufsätze und Monographien allerdings erst in den 1960er und 1970er Jahren. Das Spektrum der Untersuchungsschwerpunkte erweitert sich und umfasst nun phonetische, auditive, artikulatorische, silbenstrukturbezogene, vergleichende, historische, einzeldialektale und literarische Gesichtspunkte; die Frage der Normgerechtheit rückt in den Hintergrund bzw. wird anhand von statistischen Erhebungen zu beantworten versucht. Die Hauptfragestellung jedoch bleibt bestimmt von zwei für das Deutsche charakteristischen Phänomenen: dem uvularen und dem vokalisierten R (die hier getrennt behandelt werden, mit gutem Recht aber auch unter dem Begriff „Reduktionsformen“ zusammengefasst werden können).
Die vorliegende Arbeit versucht, einen Überblick über die Problematik der R-Realisation im Deutschen zu geben. Notgedrungen bleiben dabei einige Aspekte auf der Strecke bzw. werden nur am Rande behandelt , doch sollte das durch die weiterführenden Literaturhinweise wettgemacht werden.
Als erstes wird mit einer Beschreibung der verschiedenen Allophone sozusagen das Arbeitswerkzeug gegeben, mit dem zunächst dann das uvulare und das vokalisierte R unter einem eher globalen Gesichtspunkt behandelt werden. Anschließend wird die tatsächliche Gebrauchsnorm im Deutschen mit ihren regionalen und positionsbedingten Realisierungsformen beleuchtet und schließlich mit der präskriptiven Normgebung in den Aussprachewörterbüchern verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phonem /r/
- 2.1. R-Allophone
- 2.2. Zungen- vs. Zäpfchen-R
- 2.3. Vokalisiertes R
- 3. Die Norm im Deutschen
- 3.1. Regionale Unterschiede
- 3.2. R-Realisierung in verschiedenen Positionen
- 3.2.1. R im Anlaut prävokalisch
- 3.2.2. R intervokalisch
- 3.2.3. R postvokalisch nach Langvokal
- 3.2.4. R postvokalisch nach Kurzvokal
- 3.2.5. R nach /a/ und /a:
- 3.2.6. R in den Präfixen ver-, er-, her-, zer- und im Suffix -er
- 3.3. Kompensationsstrategien
- 3.3.1. Dehnung
- 3.3.2. Schließung
- 3.3.3. Zentralisierung
- 3.3.4. Diphthongierung
- 3.3.5. Senkung
- 3.3.6. Rhotazierung
- 3.4. Die präskriptive Norm
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Realisierung des Phonems /r/ im Deutschen. Die Zielsetzung besteht darin, die vielfältigen Aspekte der R-Aussprache, von den verschiedenen Allophonen bis hin zur regionalen Variation und der präskriptiven Norm, zusammenzufassen. Die Arbeit berücksichtigt phonetische, auditive und artikulatorische Aspekte sowie den Einfluss auf die Lautumgebung.
- Die verschiedenen Allophone des Phonems /r/ im Deutschen
- Regionale Unterschiede in der R-Aussprache
- Der Einfluss der Position des /r/ im Wort auf seine Realisierung
- Kompensationsstrategien bei der R-Aussprache
- Vergleich der tatsächlichen Gebrauchsnorm mit der präskriptiven Norm
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der komplexen R-Aussprache im Deutschen ein. Sie betont die Bedeutung des /r/ als Indikator für regionale oder ausländische Akzente und verweist auf die historische Entwicklung der Forschung zu diesem Thema. Von frühen Arbeiten, die sich primär auf die Normgerechtheit konzentrierten, hin zu umfassenderen Untersuchungen phonetischer, auditiver, artikulatorischer und dialektaler Aspekte. Die Arbeit selbst wird als Versuch positioniert, die verschiedenen Gesichtspunkte der R-Problematik zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.
2. Das Phonem /r/: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Allophone des Phonems /r/. Es werden konsonantische Allophone (gerollte Zungen-R, gerollte Zäpfchen-R, Tap, vorderes und hinteres Reibe-R, entstimmlichte hintere Reibe-R, retroflexes R) und vokalische Allophone differenziert. Die Beschreibung stützt sich auf bestehende Literatur und berücksichtigt Unterschiede in der Transkription und Terminologie. Die Diskussion umfasst auch weniger verbreitete Varianten wie Lippen- oder Kehlkopf-R und die Unterscheidung zwischen Enge- und Reibelauten.
3. Die Norm im Deutschen: Dieses Kapitel beleuchtet die Gebrauchsnorm des Deutschen hinsichtlich der R-Aussprache. Es analysiert regionale Unterschiede und die positionsabhängigen Realisierungsformen des /r/. Die verschiedenen Positionen (Anlaut, intervokalisch, postvokalisch nach Lang- und Kurzvokalen, nach /a/ und /a:/, in Präfixen und Suffixen) werden systematisch untersucht. Der Abschnitt zu Kompensationsstrategien (Dehnung, Schließung, Zentralisierung, Diphthongierung, Senkung, Rhotazierung) beschreibt, wie Sprecher auf Schwierigkeiten bei der R-Artikulation reagieren. Schließlich wird die tatsächliche Gebrauchsnorm mit der präskriptiven Norm in Aussprachewörterbüchern verglichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Realisierung des Phonems /r/ im Deutschen"
Was ist der allgemeine Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Realisierung des Phonems /r/ im Deutschen. Sie behandelt verschiedene Aspekte der R-Aussprache, von den Allophonen über regionale Variationen bis hin zur präskriptiven Norm. Phonetische, auditive und artikulatorische Aspekte sowie der Einfluss auf die Lautumgebung werden berücksichtigt.
Welche Aspekte der R-Aussprache werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die verschiedenen Allophone des /r/ (z.B. gerollte Zungen-R, Zäpfchen-R, Tap, Reibe-R, retroflexes R, vokalisiertes R), regionale Unterschiede in der R-Aussprache, den Einfluss der Position des /r/ im Wort (Anlaut, intervokalisch, postvokalisch etc.), Kompensationsstrategien bei der R-Artikulation (Dehnung, Schließung, Zentralisierung, Diphthongierung, Senkung, Rhotazierung) und einen Vergleich zwischen der tatsächlichen Gebrauchsnorm und der präskriptiven Norm.
Welche Arten von Allophonen des /r/ werden beschrieben?
Die Arbeit differenziert zwischen konsonantischen Allophonen (gerollte Zungen-R, gerollte Zäpfchen-R, Tap, vorderes und hinteres Reibe-R, entstimmlichte hintere Reibe-R, retroflexes R) und vokalischen Allophonen. Sie erwähnt auch weniger verbreitete Varianten wie Lippen- oder Kehlkopf-R und die Unterscheidung zwischen Enge- und Reibelauten.
Wie werden regionale Unterschiede in der R-Aussprache berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert regionale Unterschiede in der R-Aussprache und deren Auswirkungen auf die Realisierungsformen des /r/. Diese Unterschiede werden im Kontext der Gebrauchsnorm untersucht.
Wie wird der Einfluss der Wortposition auf die R-Aussprache behandelt?
Der Einfluss der Position des /r/ im Wort wird systematisch untersucht. Die Arbeit analysiert die Realisierung des /r/ in verschiedenen Positionen: Anlaut prävokalisch, intervokalisch, postvokalisch nach Lang- und Kurzvokalen, nach /a/ und /a:/, sowie in Präfixen (ver-, er-, her-, zer-) und dem Suffix -er.
Welche Kompensationsstrategien bei der R-Aussprache werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Kompensationsstrategien, die Sprecher verwenden, um Schwierigkeiten bei der R-Artikulation zu umgehen. Dazu gehören Dehnung, Schließung, Zentralisierung, Diphthongierung, Senkung und Rhotazierung.
Wie wird die präskriptive Norm behandelt?
Die Arbeit vergleicht die tatsächliche Gebrauchsnorm der R-Aussprache mit der präskriptiven Norm, wie sie in Aussprachewörterbüchern dargestellt wird.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum Phonem /r/ mit Unterkapiteln zu Allophonen und Artikulationsarten, ein Kapitel zur Norm im Deutschen mit Unterkapiteln zu regionalen Unterschieden, positionsabhängigen Realisierungen und Kompensationsstrategien, und eine Schlussbemerkung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Personen bestimmt, die sich akademisch mit der deutschen Phonetik, Phonologie und Dialektologie befassen. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Linguistik und Sprachwissenschaft.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument bietet detailliertere Informationen zu den jeweiligen Inhalten.
- Quote paper
- M.A. Friederike Kleinknecht (Author), 2006, R und R-Vokalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70667