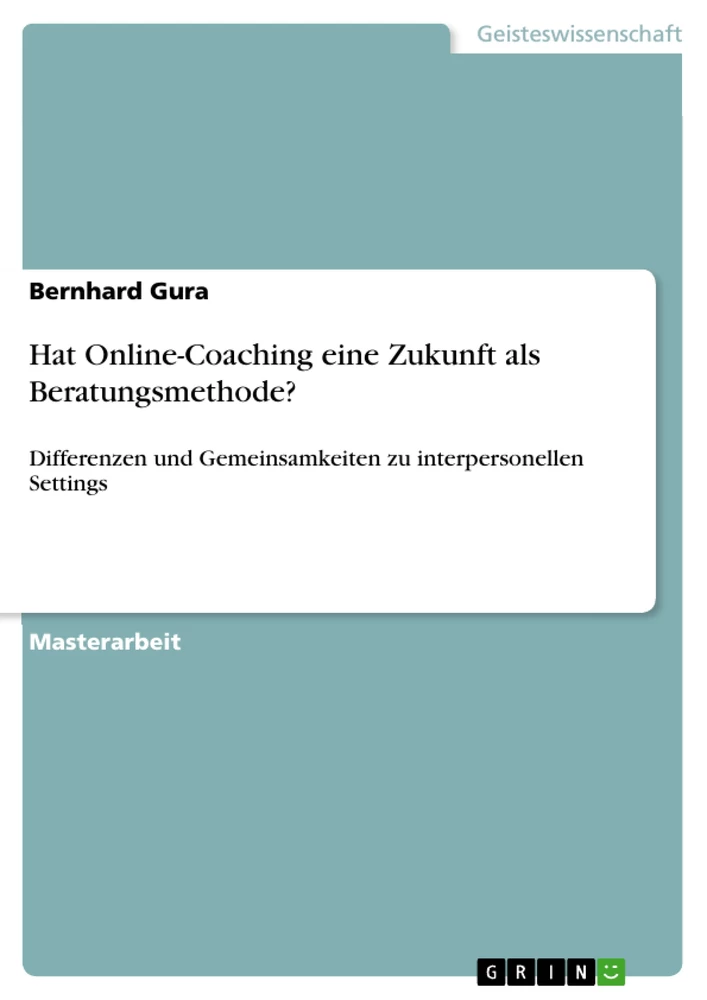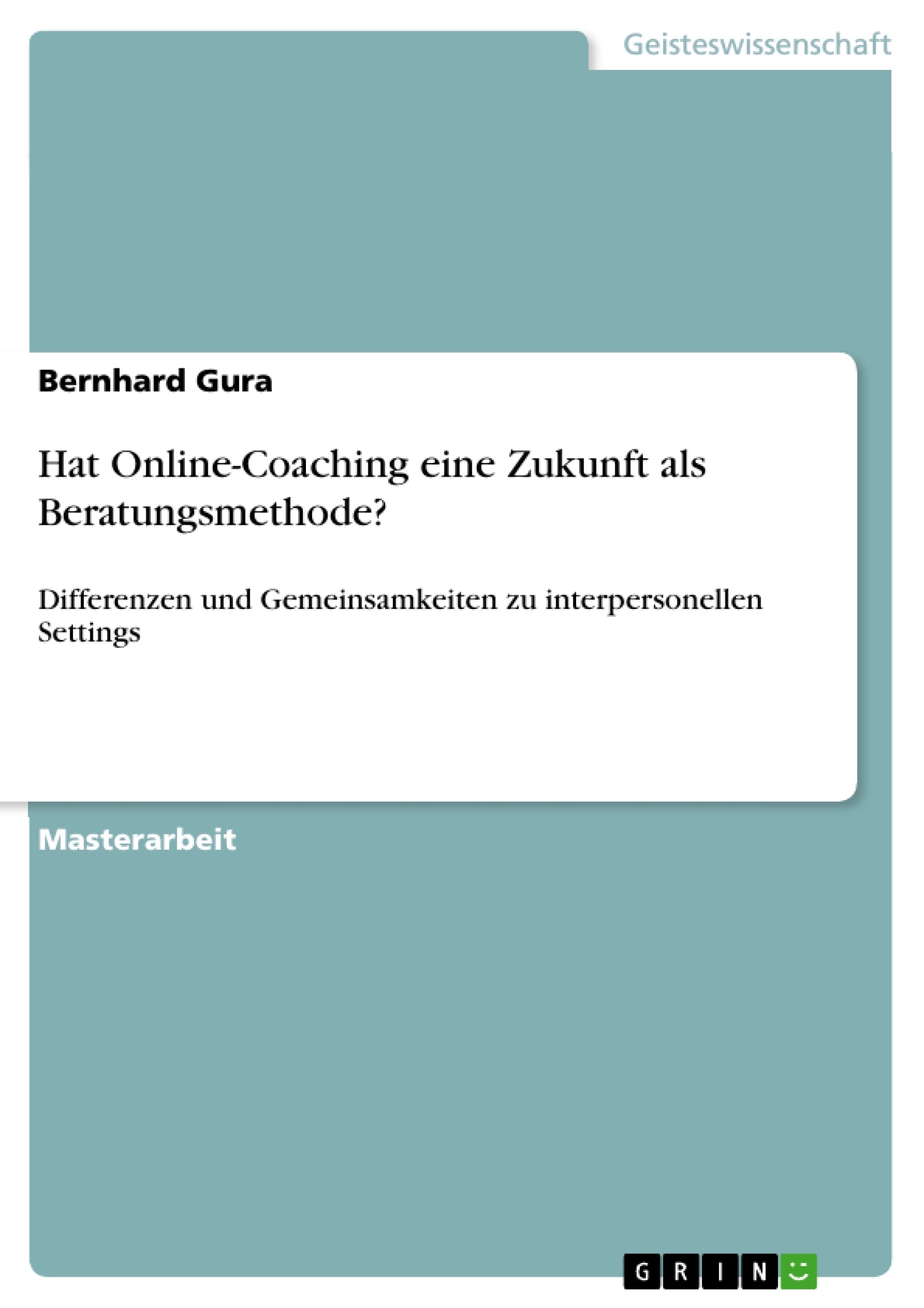Supervision und Coaching als Beratungsmethoden zur Reflexion und/oder Weiterentwicklung der beruflichen Tätigkeit und Handlungskompetenzen, haben jedenfalls ihren Ursprung in Form des persönlichen Kontaktes, bei dem sich ein/e oder mehrere KlientInnen und ein/e oder mehrere BeraterInnen im selben Raum befinden.
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, zunehmend mehr moderne Technik für Kommunikationszwecke zu nutzen, stellt sich die Frage, ob auch in der Beratung diesbezügliche Anpassungen vorzunehmen sind.
In der folgenden Arbeit werden wir als Ergebnis des ersten (theoretischen) Teils erkennen, dass die wesentlichen Elemente von interpersonellen Beratungssettings - speziell der systemischen Beratung, aber auch Elemente des humanistischen und des gestalttheoretischen Ansatzes - grundsätzlich bei der Fernberatung direkt, oder in abgewandelter Variation, realisierbar erscheinen.
Im zweiten (informativen) Teil wird durch eine Auflistung und Differenzierung einiger zur Zeit am Markt vorhandenen Formen von Fernberatung klar ersichtlich, dass die Möglichkeiten der neuen Medien noch nicht hinlänglich ausgeschöpft werden. Dabei fokussiere ich auf den Markt des Coachings und der Supervision und verzichte bewusst – zum Zweck der Übersichtlichkeit – auf den Bereich der Telefonseelsorge und parallel stattfindende Entwicklungen im sozialpädagogischen Beratungsbereich.
Im dritten (empirischen) Teil zeigt eine Stichprobenerhebung mittels Fragebogen und Auswertung der Akzeptanz diverser Beratungs- und Fernberatungsmöglichkeiten in einer gemischten KundInnen- und BeraterInnengruppe, dass bezüglich Fernberatung wegen des von vorneherein nicht zwingend erforderlichen persönlichen Kontaktes grundsätzlich Bedenken bestehen, aber dennoch Fernberatung angenommen werden würde.
Im vierten (praktischen) Teil zeigt die Darstellung eines Modells, dass die Theorie mit den Bedürfnissen der befragten Personen in Einklang gebracht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Supervision
- 2.2 Coaching
- 2.3 Systemische Beratung
- 2.4 Fernberatung
- 3 Formen der Fernberatung
- 3.1 Telefonseelsorge
- 3.2 E-Mail-Beratung
- 3.3 Video-Beratung
- 3.4 Chat-Beratung
- 3.5 Webbasierte Beratung
- 4 Empirische Untersuchung
- 4.1 Methode
- 4.2 Ergebnisse
- 4.3 Diskussion
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen von Online-Coaching als Beratungsmethode im Vergleich zu traditionellen, interpersonellen Settings. Sie untersucht die zentralen Elemente von Coaching und Supervision, insbesondere aus systemischer Perspektive, und erörtert, wie diese im Kontext der Fernberatung umgesetzt werden können.
- Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Online- und Offline-Coaching
- Bewertung der Eignung verschiedener Online-Medien für Coaching- und Supervisionsprozesse
- Bewertung der Akzeptanz von Online-Coaching durch Klienten und Berater
- Entwicklung eines Modells für effektives Online-Coaching
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Online-Coaching im Kontext der sich verändernden Arbeitswelt und der Verbreitung von digitalen Medien beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Supervision und Coaching erörtert, mit Schwerpunkt auf systemischen Ansätzen. Es wird gezeigt, wie sich die wesentlichen Elemente der Beratung in einem Online-Setting übertragen lassen.
Das dritte Kapitel beleuchtet verschiedene Formen der Fernberatung, wobei der Fokus auf Coaching und Supervision liegt. Es werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Medienformate diskutiert.
Kapitel vier präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Akzeptanz von Online-Coaching bei Klienten und Beratern.
Schlüsselwörter
Online-Coaching, Fernberatung, Supervision, Coaching, Systemische Beratung, Akzeptanz, Effizienz, Medien, digitale Medien, Kommunikationstechnologien.
- Quote paper
- MAS MSc Bernhard Gura (Author), 2006, Hat Online-Coaching eine Zukunft als Beratungsmethode?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70512