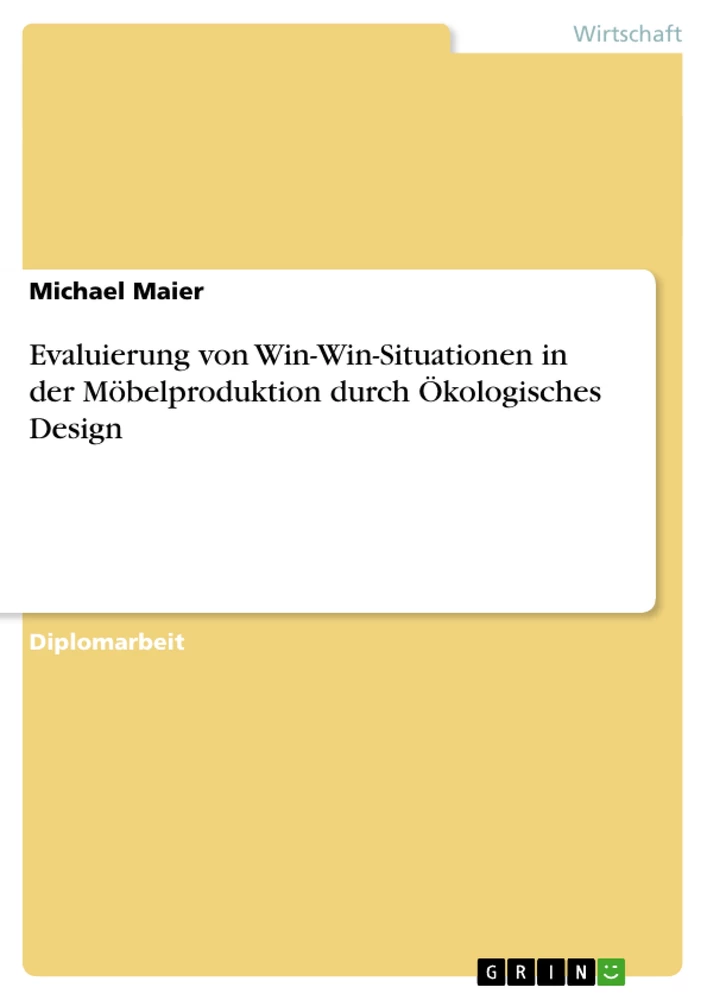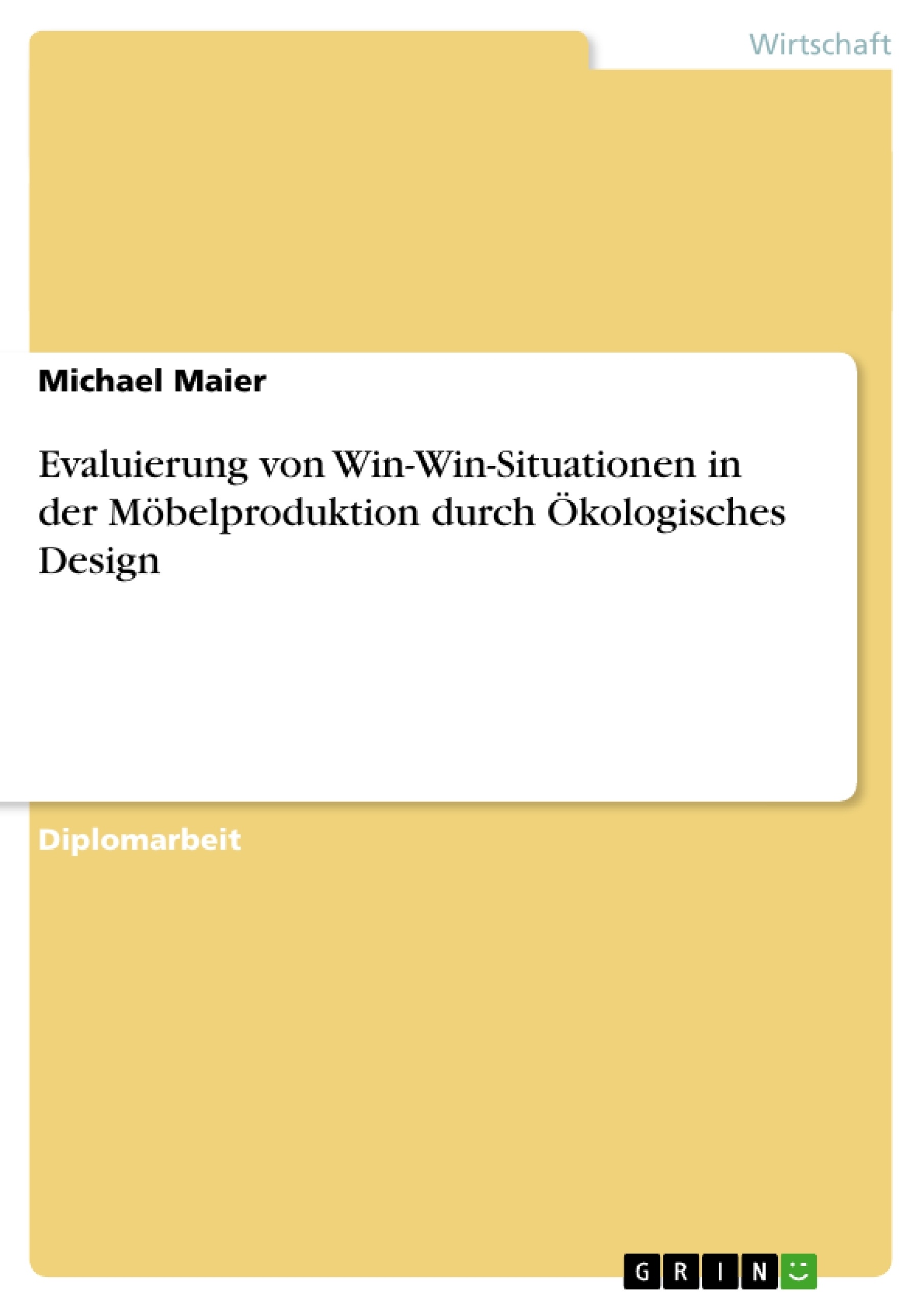Der globale Klimawandel, mit Folgen wie schmelzenden Gletschern oder der ansteigenden Zahl von Hurrikans – der dramatische Anstieg der Weltbevölkerung – der Industrialisierungsschub in den Schwellenländern, der untrennbar mit dem wachsenden Bedarf an Energie und Ressourcen verknüpft ist – der weltweite Verlust der biologischen Artenvielfalt – all das sind beängstigende Beispiele der zunehmenden umweltpolitischen Probleme, denen sich die Menschheit, das heißt der Staat, die Wirtschaft, die Gesellschaft und jeder Einzelne schnellstmöglich zu stellen hat.
Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zum Umweltbewusstsein in Deutschland hat ergeben, dass als vorrangige Aufgaben und Ziele der staatlichen Umweltpolitik der Klimaschutz, der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Senkung des Energieverbrauchs und die Steigerung der Energieeffizienz gelten. Zur Umsetzung dieser Aufgaben und Ziele stehen dem Staat unterschiedlichste Maßnahmen und Instrumente, wie der Emissionsrechtehandel oder die Öko-Steuer zur Verfügung. All diesen Mitteln gemein ist die Tatsache, dass Wirtschaft und Gesellschaft auf diese regulativen Vorgaben oftmals lediglich reagieren, anstatt freiwillig, aktiv agierend am Umweltschutz teilzunehmen. Während die Gründe hierfür in der Gesellschaft zumeist in der Bequemlichkeit des Individuums oder in der fehlenden umweltpolitischen Bildung zu suchen sind, argumentieren die gewinnorientierten Unternehmen der Wirtschaft mit den erhöhten Kosten, die mit der Einführung von Umweltschutzmaßnahmen verbunden sind. Dem entgegen stehen umweltpolitische Strategien, durch die sowohl das Unternehmen, als auch die Umwelt profitieren kann. Eine dieser Strategien, die zu einer so genannten Win-Win-Situation führen kann, ist die des Ökologischen Designs.
Im Folgenden sollen durch Ökologisches Design zustande gekommene Win-Win-Situationen in der Möbelproduktion erfasst und beschrieben werden. Zudem wird vergleichend bewertet, in welchen Phasen des Lebenszyklus das größte Potential zur Entstehung von Win-Win-Situationen liegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Win-Win-Strategie und Win-Win-Situation
- 3. Lage und Perspektiven der Möbelproduktion / -industrie
- 4. Ökologisches Design
- 4.1 Ökologie
- 4.2 Design
- 4.3 Der Begriff des Ökologischen Designs
- 4.4 Geschichte und „State of the Art\" des Ökologischen Designs
- 4.5 Grundprinzipien des Ökologischen Designs.….………………………..\n
- 4.5.1 Nachhaltige Produktentwicklung…...\n
- 4.5.2 Lebenszyklusweites Denken..\n
- 4.5.3 Mehrdimensionale Betrachtung..\n
- 4.6 Strategien des Ökologischen Designs..\n
- 4.7 Überblick über die Verfahren zur ökologischen Produktbewertung..\n
- 5. Methoden des Ökologischen Designs in der Möbelproduktion und Bewertung der\nFolgen auf Mensch, Umwelt und Unternehmen nach Lebenszyklusphasen .......\n
- 5.1 Problemstellung und Vorgehensweise........\n
- 5.2 Planung / Konzeption / Entwurf.\n
- 5.2.1 Design...\n
- 5.2.1.1 Zeitloses Design.\n
- 5.2.1.2 Bewertung\n
- 5.2.2 Materialauswahl\n
- 5.2.2.1 Erneuerbare Materialien aus nachhaltigen Quellen.\n
- 5.2.2.2 Materialien aus der Lithosphäre.\n
- 5.2.2.3 Recycelte Materialien...\n
- 5.2.2.4 Recycelbare Materialien..\n
- 5.2.2.5 Kompostierbare Materialien.\n
- 5.2.2.6 Langlebige Materialien...\n
- 5.2.2.7 Bewertung.\n
- 5.3 Produktion/Herstellung.\n
- 5.3.1 Produktionsprozesse.\n
- 5.3.1.1 Montagegerechtes Design\n
- 5.3.1.2 Selbstmontage\n
- 5.3.1.3 Demontagegerechtes Design\n
- 5.3.1.4 Effiziente Nutzung natürlicher und produzierter Materialien.\n
- 5.3.1.5 Geringer Energieaufwand bei der Herstellung\n
- 5.3.1.6 Bewertung .......\n
- 5.3.2 Verwendung von Komponenten.\n
- 5.3.2.1 Verwendung vorgefertigter Komponenten.\n
- 5.3.2.2 Wiederverwendung nicht mehr genutzter Komponenten .\n
- 5.3.2.3 Bewertung.\n
- 5.4 Vertrieb.\n
- 5.4.1 Öko-Marketing.\n
- 5.4.2 Produktzertifizierung..\n
- 5.4.2.1 Holzgütesiegel.\n
- 5.4.2.2 Textilgütesiegel\n
- 5.4.2.3 Ledergütesiegel\n
- 5.4.2.4 Übergreifende Gütesiegel.\n
- 5.4.2.5 Bewertung\n
- 5.5 Transport......\n
- 5.5.1 Leichte Produkte..\n
- 5.5.2 Verpackung in flachen Paketen\n
- 5.5.3 Minimierung des Volumens pro Verpackungseinheit\n
- 5.5.4 Bewertung\n
- 5.6 Verwendung\n
- 5.6.1 Verpackung\n
- 5.6.1.1 Ökologisch verträgliche Möbelverpackungen .\n
- 5.6.1.2 Bewertung\n
- 5.6.2 Gefahrlose Verwendung..\n
- 5.6.2.1 Vermeidung oder Reduzierung gefährlicher und giftiger Substanzen..\n
- 5.6.2.2 Bewertung\n
- 5.6.3 Verbesserte Funktionalität.\n
- 5.6.3.1 Modulares Design..\n
- 5.6.3.2 Multifunktionalität..\n
- 5.6.3.3 Bewertung\n
- 5.6.4 Langlebigkeit.....\n
- 5.6.4.1 Verlängerte Lebensdauer.\n
- 5.6.4.2 Bewertung.\n
- 5.7 Entsorgung.\n
- 5.6.1 Verpackung\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Evaluierung von Win-Win-Situationen in der Möbelproduktion durch ökologisches Design. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen des ökologischen Designs in der Möbelindustrie zu analysieren und aufzuzeigen, wie sich durch nachhaltige Produktentwicklung und ressourcenschonende Prozesse eine Win-Win-Situation für Unternehmen, Umwelt und Konsumenten schaffen lässt.
- Win-Win-Strategien in der Möbelindustrie
- Ökologisches Design als Instrument für nachhaltige Produktion
- Bewertung von ökologischen Designmethoden in verschiedenen Lebenszyklusphasen
- Vorteile und Herausforderungen des ökologischen Designs für Unternehmen, Umwelt und Konsumenten
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Möbelproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und stellt die Relevanz von Win-Win-Situationen in der Möbelproduktion dar. Sie erläutert die Problematik der Nachhaltigkeit in der Möbelindustrie und die Notwendigkeit ökologischer Ansätze.
- Kapitel 2: Win-Win-Strategie und Win-Win-Situation: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Win-Win-Strategie und Win-Win-Situation und beleuchtet die Bedeutung dieser Konzepte im Kontext der Möbelproduktion. Es werden verschiedene Ansätze und Modelle vorgestellt, die auf die Erreichung von Win-Win-Situationen abzielen.
- Kapitel 3: Lage und Perspektiven der Möbelproduktion / -industrie: Kapitel 3 analysiert die aktuelle Lage der Möbelindustrie und zeigt Herausforderungen und Chancen auf. Es werden die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Bereich der Möbelproduktion sowie die Rolle des ökologischen Designs in diesem Kontext beleuchtet.
- Kapitel 4: Ökologisches Design: Dieses Kapitel beschäftigt sich umfassend mit dem Begriff des ökologischen Designs. Es beleuchtet die Geschichte, die Grundprinzipien und die Strategien des ökologischen Designs. Außerdem werden verschiedene Verfahren zur ökologischen Produktbewertung vorgestellt.
- Kapitel 5: Methoden des Ökologischen Designs in der Möbelproduktion und Bewertung der Folgen auf Mensch, Umwelt und Unternehmen nach Lebenszyklusphasen: Das zentrale Kapitel der Diplomarbeit stellt die wichtigsten Methoden des ökologischen Designs in der Möbelproduktion vor und bewertet deren Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Unternehmen. Es werden verschiedene Lebenszyklusphasen betrachtet, von der Planung und Konzeption über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Win-Win-Situation, ökologisches Design, Möbelproduktion, Nachhaltigkeit, Lebenszyklusanalyse, Produktbewertung, Materialauswahl, Produktionsprozesse, Vertrieb, Transport, Verpackung, Entsorgung, Ressourcenschonung, Umweltfreundlichkeit und Konsumentenverhalten.
- 5.3.1 Produktionsprozesse.\n
- 5.2.1 Design...\n
- Quote paper
- Michael Maier (Author), 2007, Evaluierung von Win-Win-Situationen in der Möbelproduktion durch Ökologisches Design, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70483