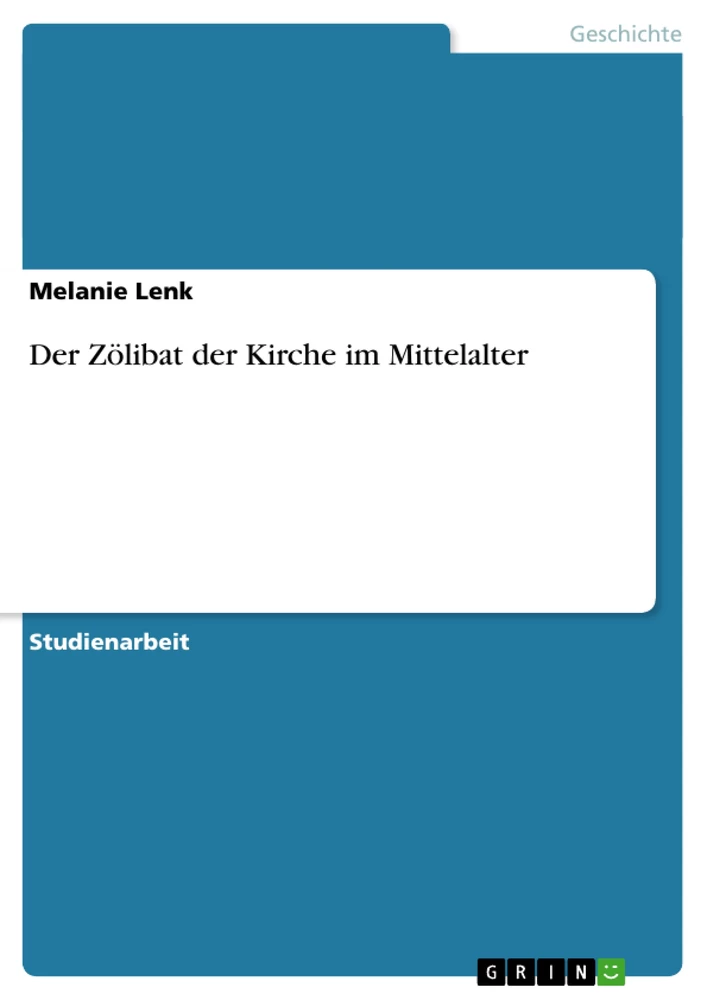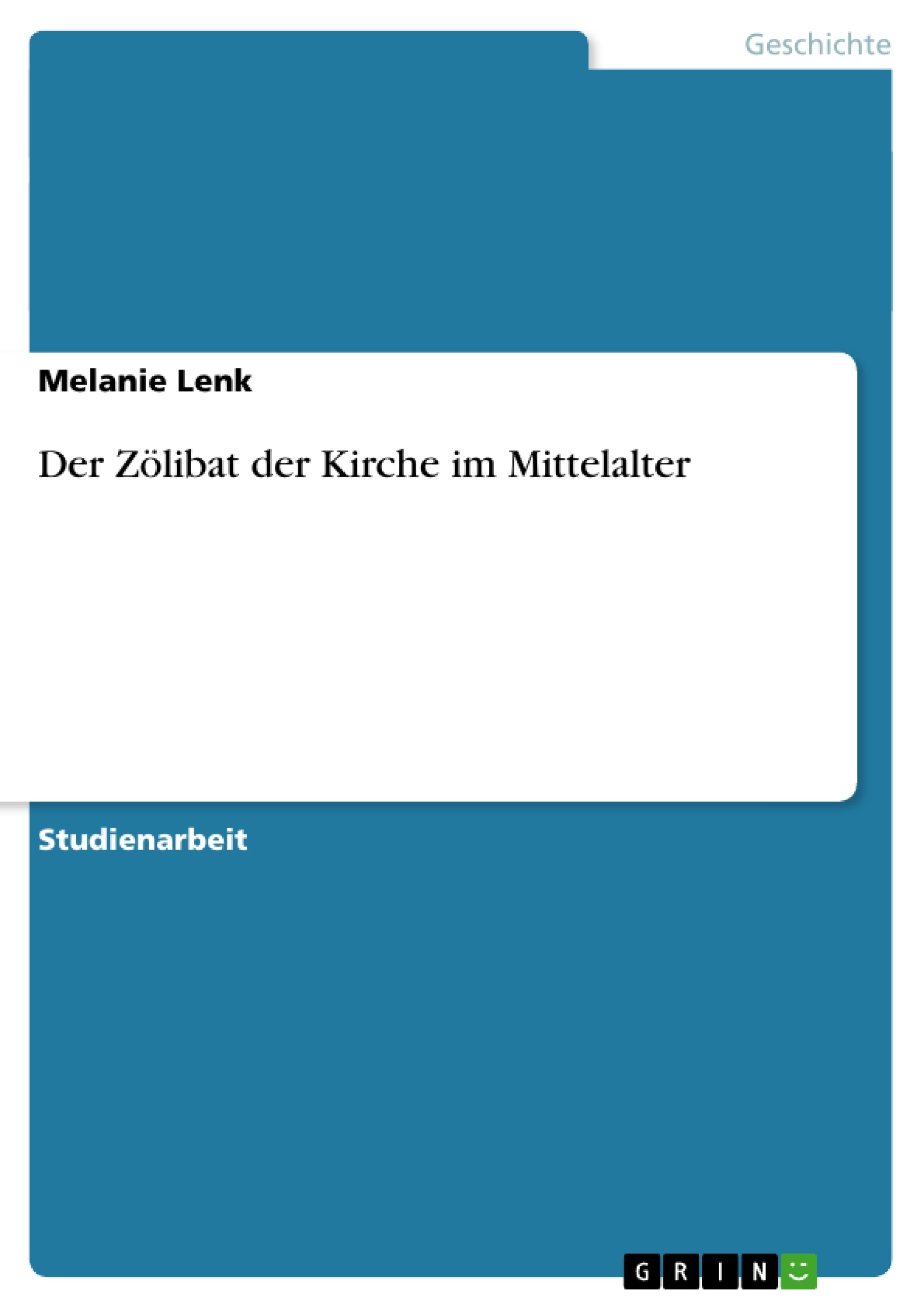Abstract
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Hausarbeit zum Proseminar „Die Kirchenstruktur des Reiches bis 1500“, das im Wintersemester 2005/06 von Herrn Dr. Thomas Lux abgehalten wurde. Sie thematisiert das Klerikerzölibat von seinen Anfängen bis zum Konzil von Trient im 16 Jahrhundert.
Einleitend wird eine genauen Definition von Klerikerzölibat geliefert, worauf folgend geklärt wird, inwiefern das Klerikerzölibat aus dem Alten oder Neuen Testament abgeleitet werden kann. Es wird festgetellt, dass der Klerikerzölibat kein in der Bibel stehendes Gesetz darstellt, sondern eine auf die Tradition der Kirche aufbauende Regelung ist. In einem kleinen Exkurs werden die Askese und das Asketentum knapp skizziert, da diese wohl die Motivation für das Einführen des Zölibats waren.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem historischen Verlauf der Einführung des Zölibats in der abendländischen Kirche des Mittelalters, beginnend mit der Synode von Elvira im Jahr 306 n. Chr. und endend mit dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert. In gesonderten Kapiteln werden das Schicksal der Frauen der Kleriker und das Schicksal ihrer Kinder beleuchtet.
In einem letzten Teil der Arbeit wird ein Fazit aus dem Vorangegangenen gezogen und ein Ausblick auf die Zeit nach dem Konzil von Trient gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist der Klerikerzölibat?
- 2.1 Definition
- 2.2 Grundlegung für den Klerikerzölibat
- 2.2.1 Das Alte Testament
- 2.2.2 Das Neue Testament
- 2.2.3 Motivation, kein Dogma
- 2.2.4 Das Asketentum
- 3. Die Geschichte des Zölibats
- 3.1 Erste förmliche Schritte zu einer Gesetzgebung
- 3.2 Einhaltung der Regelungen
- 3.2.1 Die Fastensynode und Reformbewegungen des 11. Jahrhunderts
- 3.2.2 Das zweite Laterankonzil und dessen Folgen
- 3.3 Pataria
- 3.4 Kinder von Klerikern
- 3.5 Die Frauen
- 3.6 Das Konzil von Trient
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Klerikerzölibat von seinen Anfängen bis zum Konzil von Trient. Die Zielsetzung besteht darin, die Entwicklung und Durchsetzung des Zölibats in der katholischen Kirche zu beleuchten und die theologischen und gesellschaftlichen Hintergründe zu erörtern. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Perspektiven auf den Zölibat und seine Auswirkungen auf die Kirche und die Gesellschaft.
- Definition und theologische Grundlagen des Klerikerzölibats
- Historische Entwicklung des Zölibats im Mittelalter
- Auswirkungen des Zölibats auf Frauen und Kinder von Klerikern
- Zusammenhang zwischen Asketentum und Zölibat
- Kirchliche Reformbewegungen und ihre Rolle bei der Durchsetzung des Zölibats
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema des Klerikerzölibats ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen und die wichtigsten verwendeten Quellen, darunter Werke von Stickler, Denzler und Hohmann, die als Grundlage für die folgende Analyse dienen.
2. Was ist der Klerikerzölibat?: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Klerikerzölibats, wobei verschiedene Lexikonartikel und theologische Werke herangezogen werden. Es beleuchtet die theologischen und religionsgeschichtlichen Aspekte des Zölibats, insbesondere den Zusammenhang mit Askese und der Vorstellung von „Verunreinigung“ und „Reinigung“. Der Unterschied zwischen Enthaltsamkeit und Ehelosigkeit wird geklärt, und es wird präzisiert, welche Kleriker vom Zölibat betroffen sind.
3. Die Geschichte des Zölibats: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Zölibats, von den ersten Ansätzen einer Gesetzgebung bis zum Konzil von Trient. Es analysiert die Einhaltung der Zölibatsregeln im Laufe der Jahrhunderte, beleuchtet die Rolle von Reformbewegungen wie der Pataria und thematisiert die Auswirkungen des Zölibats auf die Frauen und Kinder der Kleriker. Die Werke von Denzler und Hohmann bilden die zentrale Grundlage dieser historischen Analyse.
Schlüsselwörter
Klerikerzölibat, Mittelalter, Katholische Kirche, Asketentum, Reformbewegungen, Konzil von Trient, Theologie, Geschichtswissenschaft, Frauen, Kinder, kirchliches Recht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Klerikerzölibat
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Klerikerzölibat?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Klerikerzölibat. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Text behandelt die Definition des Klerikerzölibats, seine theologischen Grundlagen, seine historische Entwicklung vom Alten und Neuen Testament bis zum Konzil von Trient, die Einhaltung der Zölibatregeln im Laufe der Jahrhunderte, Reformbewegungen wie die Pataria und die Auswirkungen des Zölibats auf Frauen und Kinder von Klerikern.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und theologischen Grundlagen des Klerikerzölibats, seine historische Entwicklung im Mittelalter, die Auswirkungen auf Frauen und Kinder von Klerikern, den Zusammenhang zwischen Asketentum und Zölibat sowie die Rolle kirchlicher Reformbewegungen bei der Durchsetzung des Zölibats.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Lexikonartikel und theologische Werke. Die Kapitelzusammenfassung nennt explizit die Werke von Stickler, Denzler und Hohmann als wichtige Quellen für die Analyse.
Wie wird der Klerikerzölibat definiert?
Das Dokument liefert eine umfassende Definition des Klerikerzölibats, die verschiedene Lexikonartikel und theologische Werke heranzieht. Es beleuchtet die theologischen und religionsgeschichtlichen Aspekte, den Zusammenhang mit Askese, die Vorstellung von „Verunreinigung“ und „Reinigung“ und präzisiert, welche Kleriker vom Zölibat betroffen sind. Der Unterschied zwischen Enthaltsamkeit und Ehelosigkeit wird ebenfalls geklärt.
Welche historische Entwicklung wird im Text beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die historische Entwicklung des Zölibats von den ersten Ansätzen einer Gesetzgebung bis zum Konzil von Trient. Sie analysiert die Einhaltung der Regeln über die Jahrhunderte, beleuchtet die Rolle von Reformbewegungen wie der Pataria und thematisiert die Auswirkungen des Zölibats auf Frauen und Kinder von Klerikern. Die Werke von Denzler und Hohmann bilden die Grundlage der historischen Analyse.
Welche Rolle spielt das Asketentum im Kontext des Klerikerzölibats?
Der Text untersucht den Zusammenhang zwischen Asketentum und Zölibat. Er beleuchtet die theologischen und religionsgeschichtlichen Aspekte, insbesondere den Zusammenhang mit Askese und der Vorstellung von „Verunreinigung“ und „Reinigung“ im Hinblick auf den Zölibat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Klerikerzölibat, Mittelalter, Katholische Kirche, Asketentum, Reformbewegungen, Konzil von Trient, Theologie, Geschichtswissenschaft, Frauen, Kinder, kirchliches Recht.
- Citar trabajo
- Melanie Lenk (Autor), 2006, Der Zölibat der Kirche im Mittelalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69491