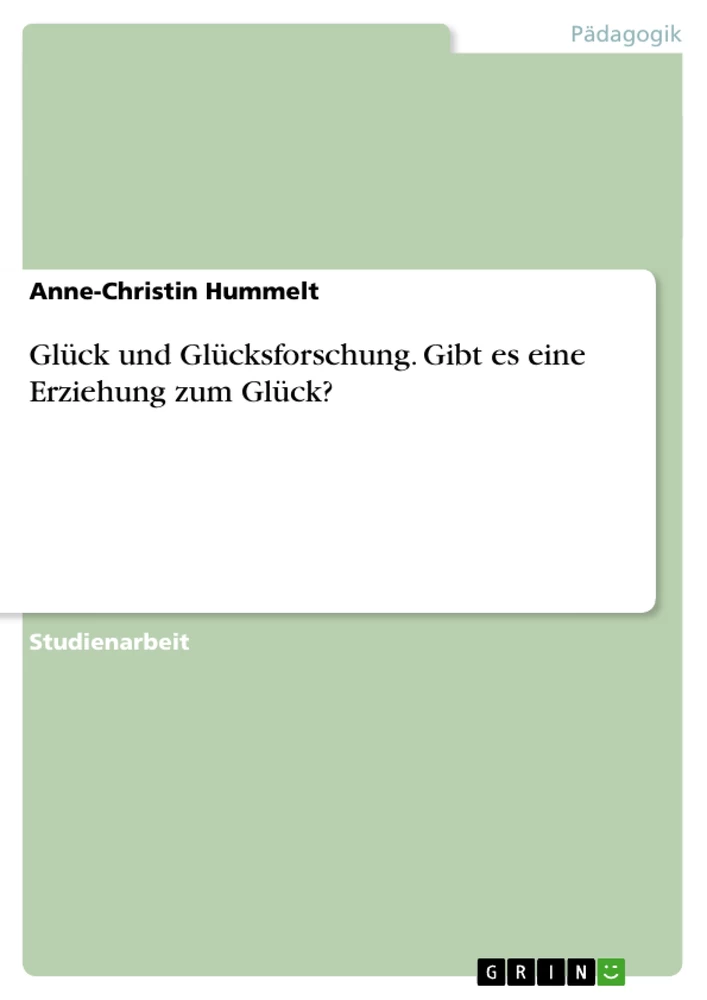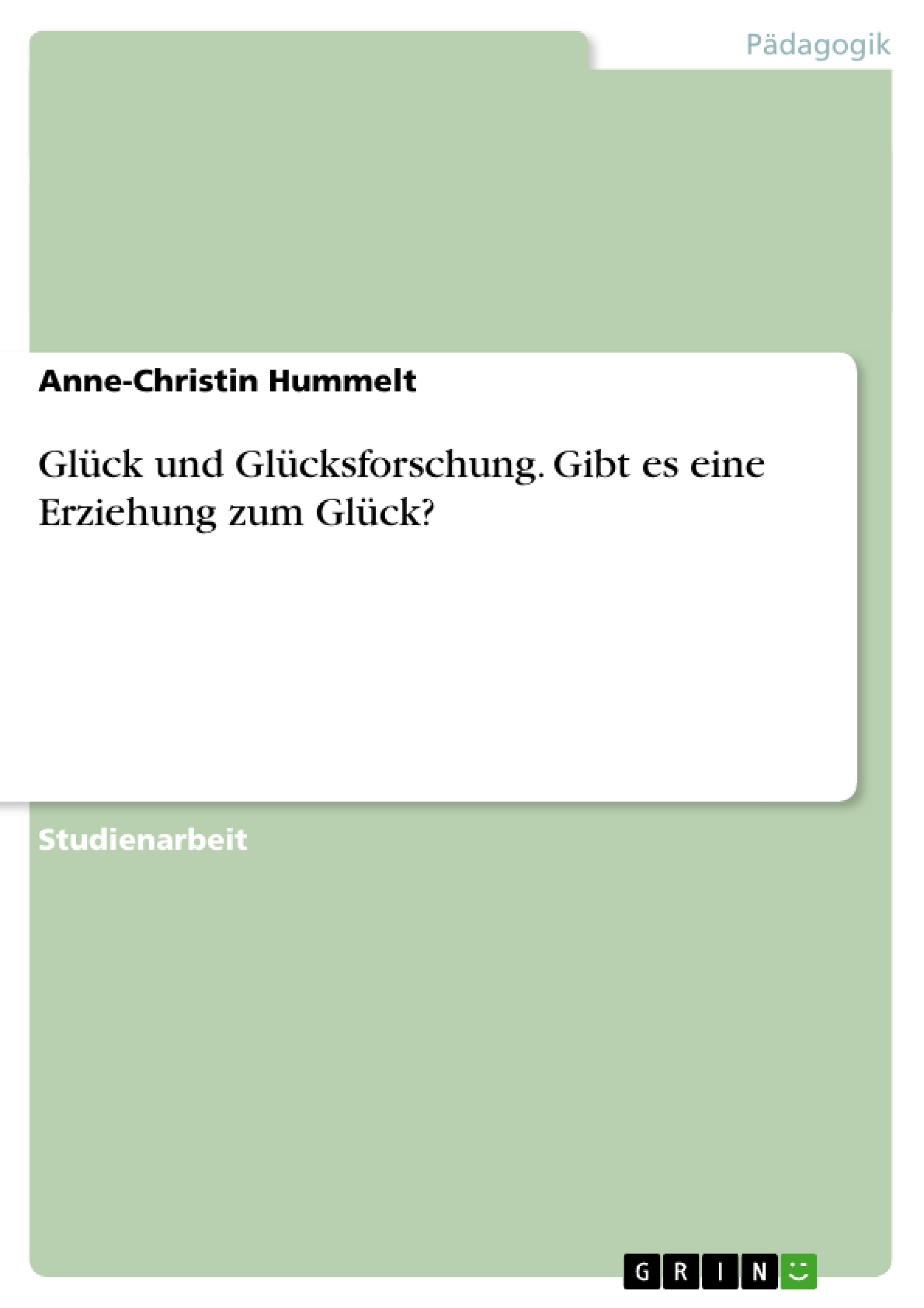In seinem Buch „Der Glücks-Faktor: Warum Optimisten länger leben“ von 2003 befasst sich Martin E. P. Seligman mit dem menschlichen Glücksempfinden. Martin E. P. Seligman ist als Professor für Psychologie Vertreter der Positiven Psychologie, die sich mit der Erforschung positiver Emotionen und den Bedingungen für Glück beschäftigt. Damit grenzt sie sich ab von der allgemein geläufigen Psychologie und Psychiatrie, bei der es hauptsächlich um die Untersuchung von psychischen Störungen, deren Ursachenforschung und Behandlung bzw. Prävention geht. Die Ausführungen Seligmans sind in drei Teile gegliedert. Zunächst gibt er einen Überblick über die Bedeutung von positiven Emotionen für die Lebenszufriedenheit in Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Im zweiten Teil stellt er den Zusammenhang zwischen Glück und dem Aufbau von Stärken und Tugenden her, um dann abschließend seine Erkenntnisse auf die alltäglichen Situationen Arbeit, Liebe und Kindererziehung zu transferieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Pädagogische Relevanz im Bezug auf nachhaltiges Glück
- 2.1 Empirische Glücksforschung
- 2.2 Bedingungen für Glück
- 2.2.1 Summe der positiven Emotionen / Ende von Erlebnissen
- 2.2.2 Einsatz von Tugenden und Stärken
- 2.2.3 Kontrolle
- 2.2.4 Bindungsqualität
- 2.3 Erziehung
- 2.3.1 Drei Erziehungsprinzipien aus der Positiven Psychologie
- 2.3.2 Acht Techniken, um positive Emotionen aufzubauen
- 3. Resümee
- 3.1 Kritik
- 3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.3 Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob und inwiefern Erziehung einen entscheidenden Einfluss auf das spätere Lebensglück hat. Sie beleuchtet die empirische Glücksforschung, insbesondere die Erkenntnisse der Positiven Psychologie, und setzt diese in Beziehung zu pädagogischen Konzepten und Zielen. Der Fokus liegt auf der Erforschung von Bedingungen für Glück und der Frage, wie diese durch Erziehung gefördert werden können.
- Der Einfluss der Erziehung auf das nachhaltige Glück.
- Die Rolle positiver Emotionen und deren Förderung.
- Die Bedeutung von Stärken und Tugenden für das Glücksempfinden.
- Die empirischen Befunde der Glücksforschung und ihre Relevanz für die Pädagogik.
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der „Erziehung zum Glück“.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Glück und Glücksforschung ein und erläutert die Relevanz der Frage nach dem Einfluss von Erziehung auf das Lebensglück. Sie stellt die unterschiedlichen Erziehungsziele gegenüber, wobei das Streben nach einem „glücklichen Kind“ im Kontrast zu anderen, auf Autonomie und Mündigkeit ausgerichteten Zielen steht. Die Arbeit betont den ressourcenorientierten Blickwinkel der Positiven Psychologie und deren Potential für die Prävention psychischer Störungen. Die Autorin beschreibt den Aufbau ihrer Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz.
2. Pädagogische Relevanz im Bezug auf nachhaltiges Glück: Dieses Kapitel befasst sich mit der empirischen Glücksforschung. Es werden Studien vorgestellt, die einen Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und Langlebigkeit aufzeigen. Insbesondere werden zwei Studien detailliert beschrieben: eine Untersuchung an Ordensschwestern, die einen starken Zusammenhang zwischen positiver Einstellung im jungen Alter und Langlebigkeit belegt, und eine Langzeitstudie, die die Korrelation zwischen Optimismus und Lebenserwartung bestätigt. Diese Studien dienen als Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit den Bedingungen für Glück und deren pädagogische Implikationen.
Schlüsselwörter
Glück, Glücksforschung, Positive Psychologie, Erziehung, Lebenszufriedenheit, positive Emotionen, Stärken, Tugenden, Optimismus, Langlebigkeit, Pädagogik, nachhaltiges Glück, Ressourcenorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss der Erziehung auf nachhaltiges Glück
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Erziehung auf das spätere Lebensglück. Sie betrachtet dabei Erkenntnisse der empirischen Glücksforschung, insbesondere der Positiven Psychologie, und setzt diese in Beziehung zu pädagogischen Konzepten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die empirische Glücksforschung, Bedingungen für Glück (positive Emotionen, Stärken, Tugenden, Bindungsqualität), pädagogische Prinzipien zur Förderung von Glück, und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der „Erziehung zum Glück“.
Welche Forschungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf empirische Glücksforschung, insbesondere Studien, die den Zusammenhang zwischen positiven Emotionen, Optimismus und Langlebigkeit belegen (z.B. Studien zu Ordensschwestern und Langzeitstudien zur Korrelation von Optimismus und Lebenserwartung). Der Fokus liegt auf einem ressourcenorientierten Ansatz der Positiven Psychologie.
Welche konkreten Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse der Glücksforschung, die einen Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und Langlebigkeit aufzeigen. Sie diskutiert pädagogische Implikationen dieser Ergebnisse und beschreibt Techniken zur Förderung positiver Emotionen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Glück, Glücksforschung, Positive Psychologie, Erziehung, Lebenszufriedenheit, positive Emotionen, Stärken, Tugenden, Optimismus, Langlebigkeit, Pädagogik und nachhaltiges Glück.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur pädagogischen Relevanz von nachhaltigem Glück, und ein Resümee mit Kritik, Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas, den Aufbau der Arbeit und den methodischen Ansatz. Das Hauptkapitel behandelt die empirische Glücksforschung und deren pädagogische Implikationen. Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert kritische Aspekte.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Resümee präsentiert und beinhalten eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der „Erziehung zum Glück“ sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse und deren Konsequenzen für die Pädagogik. Genaueres wird im Text erläutert.
- Citation du texte
- Anne-Christin Hummelt (Auteur), 2004, Glück und Glücksforschung. Gibt es eine Erziehung zum Glück?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68519