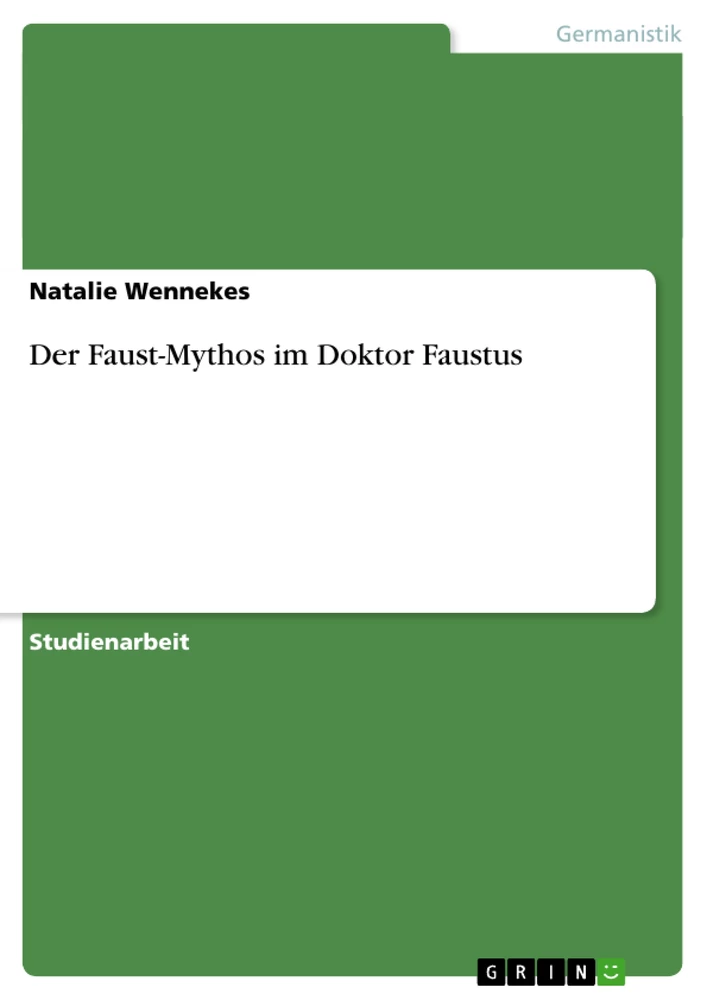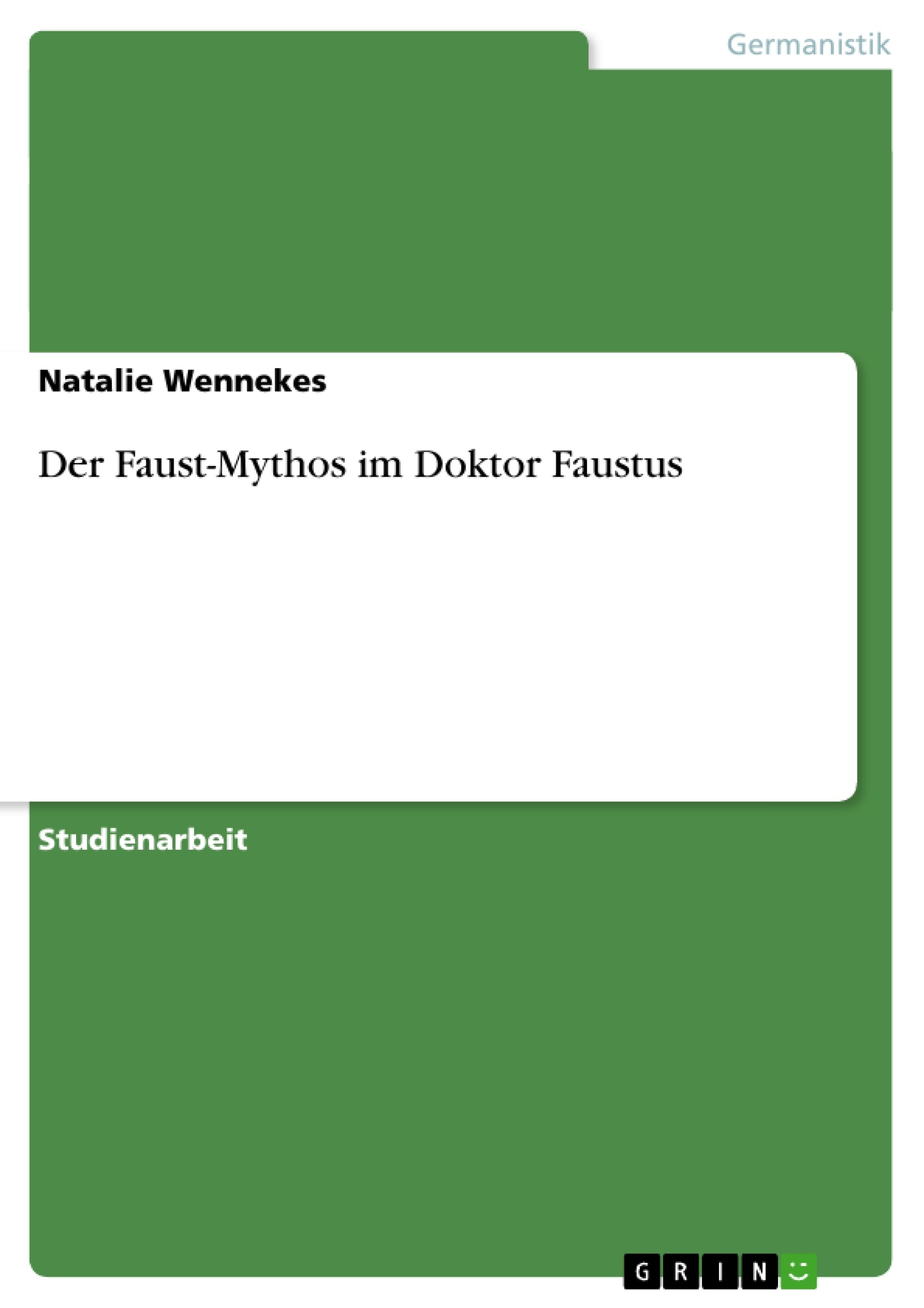Thomas Mann verfolgte schon seit längerem den Plan eine Künstler-Novelle zu verfassen:
„[…] meine Gedanken gehen […] manchmal über den nur noch aufzuarbeitenden Joseph hinaus zu einer Künstler-Novelle, dievielleicht mein gewagtestes und unheimlichstes Werk werden wird.“
Dieser Plan wird 1905, im so genannten 3-Zeilen Plan aufgegriffen:
„Der syphilitische Künstler nähert sich von Sehnsucht getrieben einem reinen, süßen jungen Mädchen, betreibt die Verlobung mit der Ahnungslosen und erschießt sich dicht vor der Hochzeit.“
Nachdem Thomas Mann das Volksbuch, auf welches später noch ausführlich eingegangen wird, mit „dem Bleistift studiert hat“ , modifiziert er sein Vorhaben und erweitert es um den Faust-Mythos:
„[…] Figur des syphilitischen Künstlers: als Dr. Faust und dem Teufel Verschriebener. Das Gift wirkt als Rausch, Stimulans, Inspiration; er darf in entzückender Begeisterung geniale, wunderbare Werke schaffen, der Teufel führt ihm die Hand. Schließlich aber holt ihn der Teufel: Paralyse. Die Sache mit dem reinen jungen Mädchen, mit der er es bis zur Hochzeit treibt, geht vorher.“
Der paralytische Zusammenbruch rekurriert auf das Geholtwerden auf das Versinken in den Wahnsinn und spiegelt die ewige Verdammnis des alten Faust wieder.
Die folgende Arbeit soll Aufschluss über die von Thomas Mann verwendeten literarischen Vorlagen und Quellen bezüglich des Faust-Mythos geben. Einleitend wird das Volksbuch von 1587, die Historia von D. Johann Fausten, vorgestellt. Es folgen einige Eckdaten des Werks, die eine Vorstellung des Protagonisten und dessen Verschreibung mit dem Teufel einschließen. In einem weiteren Schritt werden Parallelen und Differenzen der Historia und des Doktor Faustus aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Literarische Vorlagen
- 2.1. Die Historia von D. Johann Fausten
- 2.2. Goethes Faust
- 2.3 Weitere Vorlagen
- 3. Diabolische Elemente
- 3.1. Romanfiguren
- 3.2. Orte dämonischer Aktivitäten
- 4. Mythisches Erzählen
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarischen Vorlagen und Quellen, die Thomas Mann für seinen Roman "Doktor Faustus" im Bezug auf den Faust-Mythos verwendete. Sie beleuchtet die Bedeutung der "Historia von D. Johann Fausten", Goethes Faust und weiterer Einflüsse. Der Fokus liegt auf der Analyse der diabolischen Elemente im Roman, der Rolle der Figuren und Orte, sowie der Verwendung mythischer Erzählstrukturen.
- Die literarischen Vorlagen des Doktor Faustus im Bezug auf den Faust-Mythos
- Die Darstellung diabolischer Elemente im Roman
- Die Analyse der Romanfiguren im Kontext des Dämonischen
- Die Untersuchung der mythischen Erzählweise in Doktor Faustus
- Der Vergleich zwischen Manns Doktor Faustus und Goethes Faust
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert Thomas Manns langjährige Absicht, eine Künstlernovelle zu schreiben, und seine Entwicklung des Konzepts, das schließlich in "Doktor Faustus" mündete. Sie zeigt die Verknüpfung des ursprünglichen Plans einer Künstlernovelle mit dem Faust-Mythos und dem Bild des syphilitischen Künstlers, dessen genialität durch den Teufel angetrieben und letztendlich von ihm zerstört wird. Die Einleitung deutet die bevorstehende Analyse der literarischen Vorlagen und den Fokus auf diabolische Elemente und mythische Erzählstrukturen an, die im Roman eine zentrale Rolle spielen. Die Arbeit verspricht eine detaillierte Untersuchung der Quellen und ihrer Auswirkung auf Manns Werk.
2. Literarische Vorlagen: Dieses Kapitel analysiert die literarischen Quellen, die Thomas Mann für seine Darstellung des Faust-Mythos in "Doktor Faustus" nutzte. Es beginnt mit einer detaillierten Untersuchung des Volksbuchs "Historia von D. Johann Fausten" aus dem Jahr 1587, wobei die reale Macht des Teufels, der Abwendung Faustens von der Theologie und seine Verstrickung in die Zauberei beleuchtet werden. Das Kapitel vergleicht und kontrastiert die "Historia" mit Manns Roman und hebt Parallelen und Unterschiede hervor. Es untersucht ebenfalls den Einfluss Goethes Fausts auf Manns Werk, obwohl Mann selbst eine Abgrenzung zu Goethe betont. Schließlich werden weitere, weniger prominent erwähnte Quellen und Einflüsse diskutiert, die Manns schöpferischen Prozess beeinflusst haben.
Doktor Faustus: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Themen werden in dieser Arbeit behandelt?
Diese Arbeit analysiert Thomas Manns Roman "Doktor Faustus" mit Fokus auf die literarischen Vorlagen im Kontext des Faust-Mythos. Sie untersucht die Bedeutung der "Historia von D. Johann Fausten", Goethes Faust und weiterer Quellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der diabolischen Elemente im Roman, der Rolle der Figuren und Orte, sowie der Verwendung mythischer Erzählstrukturen. Die Arbeit vergleicht auch Manns "Doktor Faustus" mit Goethes "Faust".
Welche literarischen Vorlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die "Historia von D. Johann Fausten" (1587) und Goethes Faust als zentrale Quellen für Manns Roman. Zusätzlich werden weitere, weniger bekannte Einflüsse und Vorlagen diskutiert, die Manns schöpferischen Prozess beeinflusst haben. Der Vergleich zwischen diesen Vorlagen und Manns Werk wird hervorgehoben, inklusive der Parallelen und Unterschiede.
Wie werden die diabolischen Elemente im Roman analysiert?
Die Analyse der diabolischen Elemente konzentriert sich auf die Romanfiguren und die Orte dämonischer Aktivitäten. Es wird untersucht, wie Mann diese Elemente in seine Erzählung integriert und wie sie die Handlung und die Charakterentwicklung beeinflussen. Die Rolle des Teufels und seine Macht werden im Kontext der "Historia von D. Johann Fausten" und im Vergleich zu Manns Darstellung beleuchtet.
Welche Rolle spielt die mythische Erzählweise in "Doktor Faustus"?
Die Arbeit untersucht die Verwendung mythischer Erzählstrukturen in Manns Roman. Es wird analysiert, wie Mann mythische Elemente einsetzt, um die Geschichte und ihre Figuren zu gestalten und welche Wirkung dies auf den Leser hat. Der Zusammenhang zwischen der mythischen Erzählweise und den anderen analysierten Aspekten (literarische Vorlagen, diabolische Elemente) wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die den Kontext und die Zielsetzung der Arbeit beschreibt; ein Kapitel über die literarischen Vorlagen; ein Kapitel über die diabolischen Elemente; ein Kapitel über die mythische Erzählweise; und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel befasst sich detailliert mit den entsprechenden Aspekten des Romans "Doktor Faustus".
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die literarischen Quellen und Einflüsse auf Thomas Manns "Doktor Faustus" zu untersuchen und zu analysieren, wie diese den Roman prägen. Sie möchte ein umfassendes Verständnis des Romans im Kontext des Faust-Mythos liefern, indem sie die verschiedenen Aspekte des Werkes (literarische Vorlagen, diabolische Elemente, mythische Erzählweise) in Beziehung zueinander setzt.
- Quote paper
- Natalie Wennekes (Author), 2007, Der Faust-Mythos im Doktor Faustus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68473