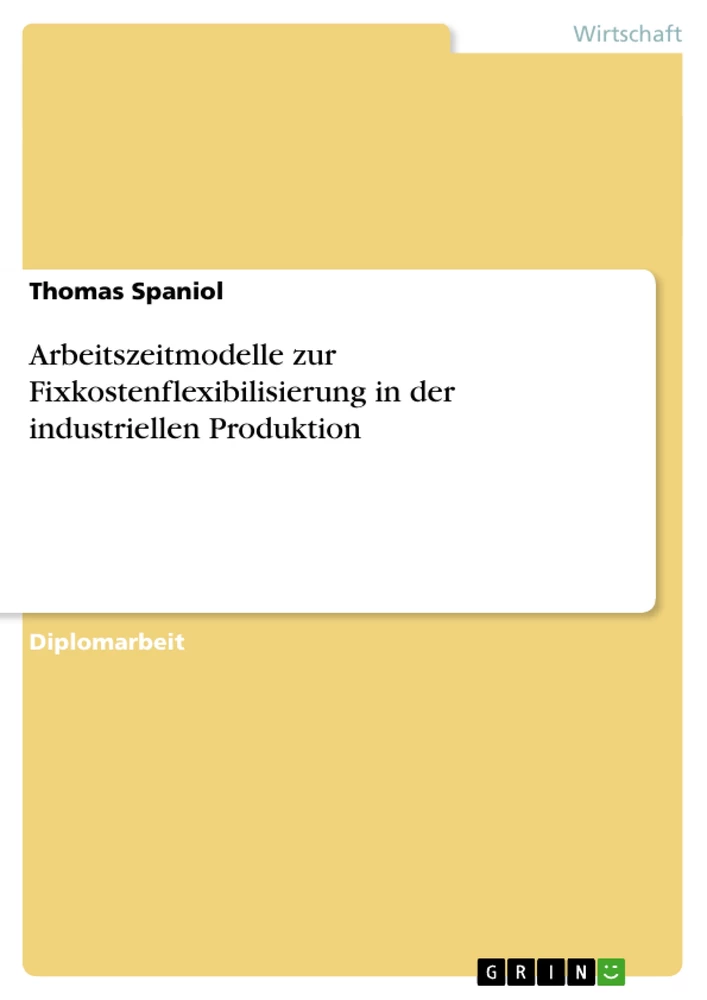In Zeiten einer zunehmend differenzierten und dynamischen Umwelt sowie daraus resultierender, sich schnell ändernder Marktverhältnisse wird in wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen und arbeitsmarktpolitischen Diskussionen immer wieder der Ruf nach flexibleren Unternehmen laut.
Ein in diesem Zusammenhang oft herausgestelltes Problem ist die starre Kostenposition vieler Unternehmen, die durch eine Zunahme der Fixkostenintensität hervorgerufen wird und die ein Unternehmen bei einem Beschäftigungsrückgang langfristig in seiner Existenz gefährden kann.
Zudem kommt der Verbesserung der Kostenposition und somit der Steigerung der Kostenflexibilität eines Unternehmens als Teil einer umfassenden Kostenpolitik, die auf die Umsetzung wettbewerbsorientierter Strategien abstellt, eine besondere Bedeutung zu.
Bei der Analyse der Kostenstruktur eines Industrieunternehmens zeigt sich, dass in der industriellen Produktion zum einen Personalkosten trotz Rationalisierungsmaßnahmen nach wie vor einen bedeutenden Kostenfaktor darstellen. Zum anderen spielt bei der Bewältigung der Fixkostenproblematik die effiziente Auslastung kapitalintensiver Leistungspotentiale eine entscheidende Rolle. Beide Größen lassen sich über die Gestaltung der Arbeits- bzw. der Betriebszeit eines Unterehmens beeinflussen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Auswirkungen verschiedener Arbeitszeitmodelle auf die Kostenstruktur eines Unternehmens zu analysieren und diese bezüglich ihrer Eignung zur Flexibilisierung fixer Kosten zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Arbeitszeitflexibilisierung in der arbeitsmarktpolitischen Diskussion
- Forschungsschwerpunkte in der Wissenschaft
- Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- Fixkostenproblematik im Produktionsbereich
- Typische Kostenstrukturen im Produktionsbereich
- Fixkostenblock und Beschäftigungsrisiko
- Ansatzpunkte der Fixkostenpolitik
- Zurechenbarkeit von Fixkosten
- Disponierbarkeit von Fixkosten
- Fixkosten als Zeitquanten
- Fixkosten als Sachquanten
- Kapazitätsorientierte Nutzung der Leistungspotential
- Entstehung von Nutz- & Leerkosten
- Verfügbarkeitsverlust
- Grenzen des Fixkostenabbaus bei sich ändernden Marktverhältnissen
- Notwendigkeit der Fixkostenflexibilisierung
- Grundlagen der Arbeitszeitflexibilisierung
- Grundlegende Gestaltungsansätze
- Entkopplung von Arbeits- und Betriebszeit
- Dispositionsspielräume für Arbeitnehmer
- Offene und geschlossene Arbeitszeitsysteme
- Ziele der Arbeitszeitflexibilisierung
- Ausdehnung der Betriebszeit
- Vermeidung personeller Über- und Unterkapazitäten
- Anreiz- und Motivationseffekte
- Allgemeine Problemfelder der Arbeitszeitflexibilisierung
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Betriebliche Einsatzbedingungen
- Personelle Einsatzbedingungen
- Organisatorische Einsatzbedingungen
- Produktionstechnische Einsatzbedingungen
- Sonstige Anforderungen
- Analyse und Bewertung der Grundmodelle flexibler Arbeitszeitgestaltung
- Herleitung des Analyse- und Bewertungsschemas
- Betriebszeitausdehnung
- Anpassung an Marktschwankungen
- Sonstige Effekte
- Analyse- und Bewertungsschema
- Dimensionen der Arbeitszeitgestaltung
- Die chronologische Gestaltung
- Die chronometrische Gestaltung
- Formen chronologischer Arbeitszeitflexibilisierung
- Schichtarbeit
- Konzept der Schichtarbeit
- Spezielle Problemfelder bei Einführung der Schichtarbeit
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Einfache Gleitzeitarbeit
- Konzept der einfachen Gleitzeitarbeit
- Spezielle Problemfelder bei Einführung der Gleitzeitarbeit
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Formen chronometrischer Arbeitszeitflexibilisierung
- Kurz- und Überarbeit
- Konzepte der Kurz- und Überarbeit
- Spezielle Problemfelder bei Einführung der Kurz- und Überarbeit
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Teilzeitarbeit
- Konzept der Teilzeitarbeit
- Spezielle Problemfelder bei Einführung der Teilzeitarbeit
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Sonstige Formen chronometrischer Arbeitszeitgestaltung
- Gleitender Übergang in den Ruhestand
- Sabbaticals
- Formen chronologischer und chronometrischer Arbeitszeitflexibilisierung
- Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPOVAZ)
- Konzept der KAPOVAZ
- Spezielle Problemfelder bei Einführung der KAPOVAZ
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Amorphe Arbeitszeit, insbesondere Jahresarbeitszeit
- Konzept der amorphen Arbeitszeit
- Spezielle Problemfelder bei Einführung der amorphen Arbeitszeit
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Arbeitszeitkonten, insbesondere Arbeitszeitkorridore
- Konzept der Arbeitszeitkonten
- Spezielle Problemfelder bei Einführung von Arbeitszeitkonten
- Eignung zur Fixkostenflexibilisierung
- Sonstige Modelle chronologischer und chronometrischer Arbeitszeitflexibilisierung
- Job-Sharing
- Die selbstbestimmte Arbeitszeit bei Trennung von Betriebs- und Arbeitstätte
- Zusammenfassung und Bewertung
- Fallstudie: Die BMW-Werke Regensburg und Leipzig
- Ausgangssituation
- Das Arbeitszeitmodell
- Das Grundprinzip: Das 99-Stunden-Schichtmodell
- Die Weiterentwicklung: Der Arbeitszeitkorridor
- Ergebnis und Bewertung
- Fazit und Ausblick
- Analyse der Fixkostenproblematik im Produktionsbereich
- Behandlung verschiedener Modelle der Arbeitszeitflexibilisierung
- Bewertung der Eignung der Modelle zur Fixkostenflexibilisierung
- Analyse der rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen
- Fallstudie zur Anwendung von Arbeitszeitmodellen in der Praxis
- Das erste Kapitel führt in die Thematik der Fixkostenflexibilisierung durch Arbeitszeitmodelle ein und beleuchtet die Problemstellung, die Relevanz der Thematik sowie die wissenschaftlichen Schwerpunkte.
- Kapitel 2 beleuchtet die Fixkostenproblematik im Produktionsbereich und erläutert verschiedene Ansätze zur Fixkostenpolitik, insbesondere die Disponierbarkeit und Zurechenbarkeit von Fixkosten.
- Kapitel 3 erläutert die grundlegenden Gestaltungsansätze der Arbeitszeitflexibilisierung, die Ziele dieser Flexibilisierung sowie die damit verbundenen Problemfelder, insbesondere rechtliche Rahmenbedingungen und betriebliche Einsatzbedingungen.
- Kapitel 4 analysiert und bewertet verschiedene Grundmodelle flexibler Arbeitszeitgestaltung, wie Schichtarbeit, Gleitzeitarbeit, Kurz- und Überarbeit, Teilzeitarbeit sowie andere Formen chronologischer und chronometrischer Arbeitszeitflexibilisierung.
- Kapitel 5 stellt eine Fallstudie zu den BMW-Werken Regensburg und Leipzig vor, die das Arbeitszeitmodell des 99-Stunden-Schichtmodells und den Arbeitszeitkorridor im Detail beschreibt und bewertet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten der Fixkostenflexibilisierung durch die Einführung verschiedener Arbeitszeitmodelle in der industriellen Produktion. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise und die Eignung dieser Modelle im Kontext der Kostensenkung und der Optimierung des Produktionsprozesses zu gewinnen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Fixkostenflexibilisierung durch Arbeitszeitmodelle in der industriellen Produktion. Wichtige Schlüsselbegriffe sind dabei: Fixkosten, Produktionsbereich, Arbeitszeitflexibilisierung, Schichtarbeit, Gleitzeitarbeit, Kurz- und Überarbeit, Teilzeitarbeit, Jahresarbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Fallstudie, BMW-Werke, Kostenoptimierung, Produktionsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Fixkostenflexibilisierung" in der Produktion?
Es bezeichnet Strategien, um starre Kostenblöcke (wie Personalkosten oder Anlagenabschreibungen) besser an Beschäftigungsschwankungen anzupassen.
Welche Arbeitszeitmodelle werden zur Flexibilisierung untersucht?
Die Arbeit analysiert Schichtarbeit, Gleitzeit, Teilzeit, Kurz- und Überarbeit sowie moderne Konzepte wie Jahresarbeitszeit und Arbeitszeitkonten.
Was ist das Ziel einer Entkopplung von Arbeits- und Betriebszeit?
Dadurch können teure Maschinen länger laufen (Betriebszeit), während die Mitarbeiter flexiblere Arbeitszeiten haben, was die Fixkosten pro Stück senkt.
Was versteht man unter KAPOVAZ?
KAPOVAZ steht für kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit, bei der die Arbeitszeit flexibel nach dem aktuellen Arbeitsanfall im Betrieb festgelegt wird.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit detailliert beschrieben?
Die Arbeit enthält eine Fallstudie zu den BMW-Werken Regensburg und Leipzig, insbesondere zum 99-Stunden-Schichtmodell und zum Arbeitszeitkorridor.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen beachtet werden?
Bei der Gestaltung müssen Gesetze wie das Arbeitszeitgesetz, Tarifverträge und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats berücksichtigt werden.
- Quote paper
- Thomas Spaniol (Author), 2004, Arbeitszeitmodelle zur Fixkostenflexibilisierung in der industriellen Produktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68455