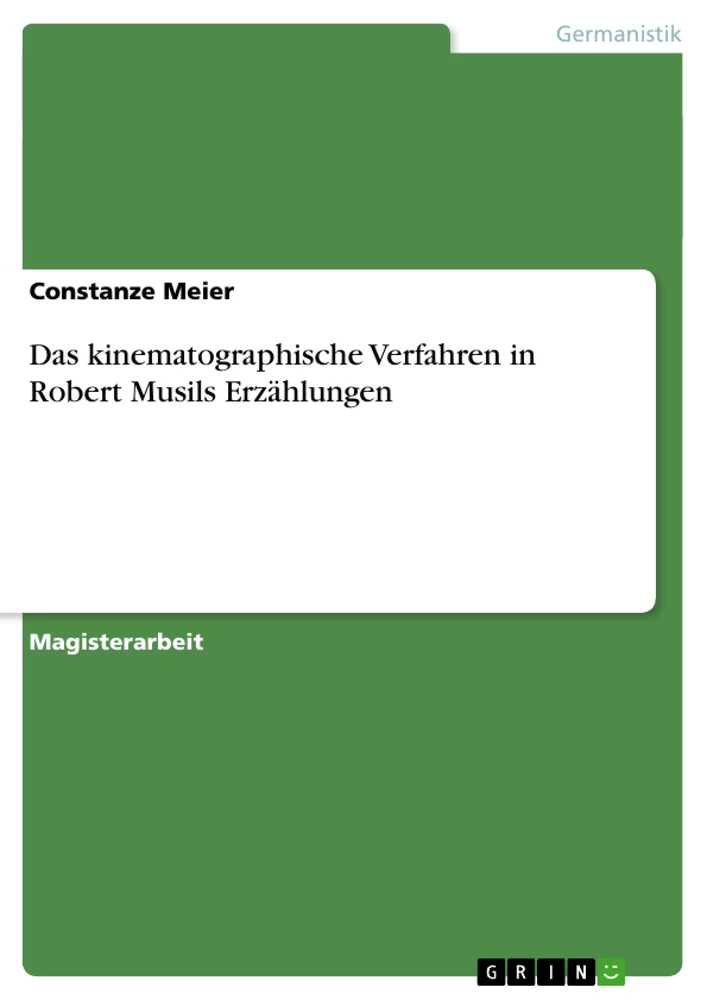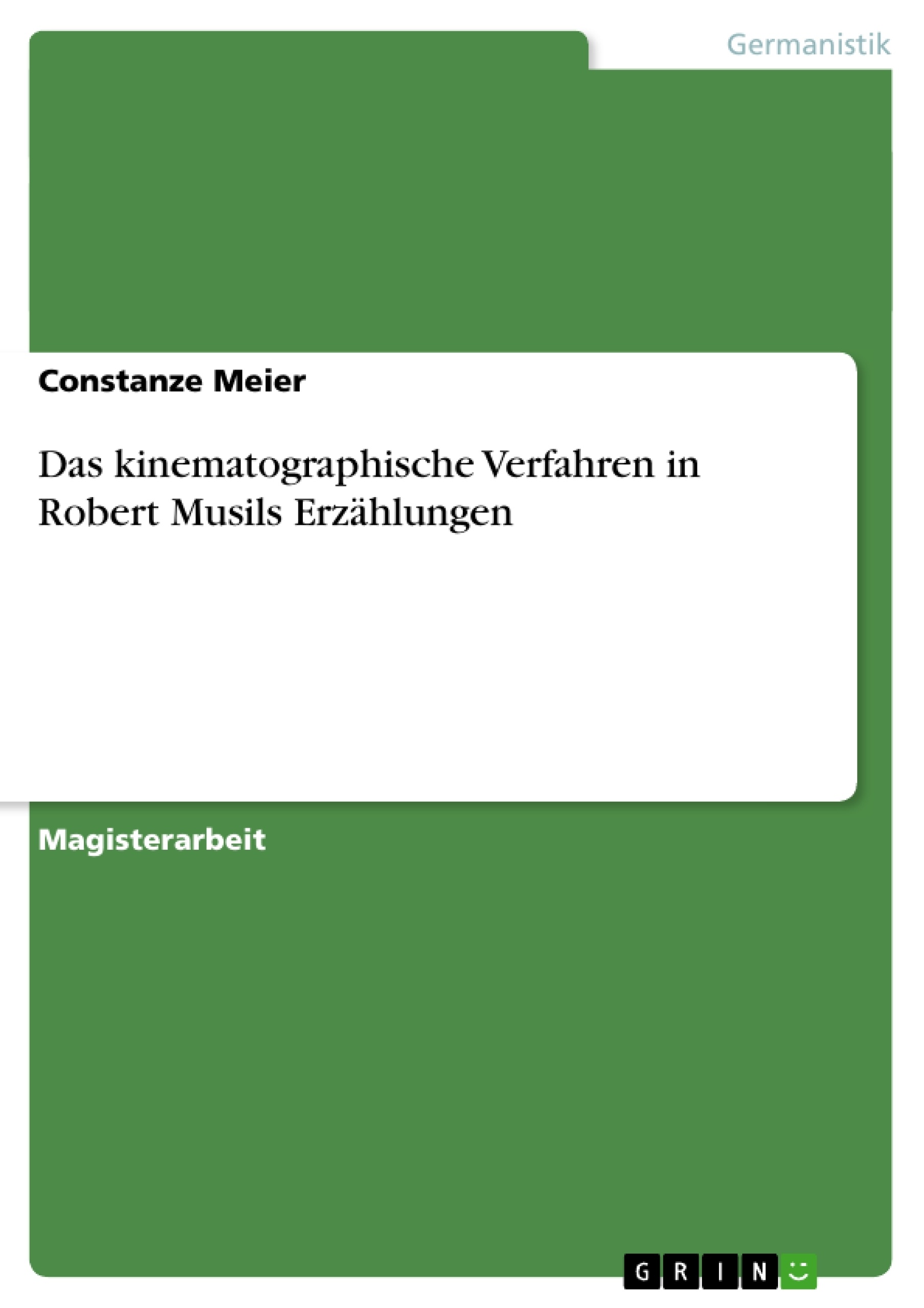Die Zielsetzung dieser Untersuchung besteht in der Herausstellung kinematographischer Verfahrensweisen
in ausgewählten Texten Robert Musils (1880-1942). Dies setzt zunächst die Klärung der
Frage voraus, auf welche Weise Musil dem Kino begegnete und welche Aspekte ihn dazu veranlassten,
theoretische Überlegungen über das neue Medium anzustellen, denen er Einlass in sein dichterisches
Schaffen gewährte.
Die perzeptionsorientierte Umwälzung entlang des Entwicklungsprozesses der neuen, kulturellen Institution
um 1900 ermöglicht eine Wahrnehmung anderer Wirklichkeiten, die sich im visuellen Bewusstsein
manifestieren. Das hat zur Folge, dass innerhalb der zeitgenössischen Literatur mit dem
,neuen Sehen‘ Interessengebiete berührt werden, die angesichts des zur Verfügung stehenden
Sprachmaterials eine Umgestaltung des gewohnten Sehraumes beinhalten.
Der erste Teil dieser Arbeit gibt Einsicht in die Besonderheiten der mechanischen Errungenschaft des
Kinematographen, da die schrittweise Angleichung der Apparatur an das optische Bewegungssehen
einerseits und die Verfremdungsmöglichkeiten der aufgenommenen Wirklichkeit andererseits Ausgangspunkte
für Musils Infragestellung menschlicher Wahrnehmung darstellen.
Diesem Einblick werden seine dichtungstheoretischen und ästhetikorientierten Überlegungen gegenübergestellt,
wobei hier überwiegend auf die beiden Essays „Skizze der Erkenntnis des Dichters“
(1918; 8; 1025) und „Ansätze zu neuer Ästhetik - Bemerkungen über eine Dramaturgie des Films“
(1925; 8; 1137) zur Herausstellung seines Interesses an der Übertragung von Wahrnehmungsdaten
zurückgegriffen wird. Musils Auseinandersetzung mit der Gestalttheorie und der experimentellen Psychologie
bilden hierbei die Vorbedingung zum Verständnis des ,anderen Zustandes‘, dessen
Konzeption seinen filmtheoretischen Erwägungen zugrunde liegt.
Die Kombination von technischen Grundlagen des Kinematographen und erlebnisverarbeitenden
Prozessen in der Perzeption bilden Ansatzpunkte, mit denen sich eine ,kinematographische Erzähltechnik‘
in Musils Texten feststellen lässt. Entsprechend wird im zweiten Kapitel das
,kinematographische Erzählen‘ allgemein definiert und auf Musils erzähltechnisches Verfahren übertragen.
Die für den Nachlaß zu Lebzeiten von ihm ausgearbeiteten Prosaskizzen „Triedere“, „Die
Maus“ und „Das Fliegenpapier“ werden im zweiten Kapitel, die Erzählung „Grigia“ aus dem Novellenband [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 ROBERT MUSIL UND DIE BEDEUTUNG DES KINEMATOGRAPHEN IN SEINER ZEIT
- 1.1 ABRISS DER ENTWICKLUNG DES KINEMATOGRAPHEN
- 1.2 ROBERT MUSILS VERHÄLTNIS ZUR KINEMATOGRAPHIE
- 1.3 DICHTUNGSTHEORETISCHE REFLEXIONEN
- 1.4 ÄSTHETISCHE REFLEXIONEN ÜBER DEN FILM
- 1.4.1 Gestalttheorie
- 1.4.2 „Ansätze zu neuer Ästhetik - Bemerkungen über eine Dramaturgie des Films“
- 1.4.3 Nachbildwirkung
- 2 DAS KINEMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN AUSGEWÄHLTEN SKIZZEN AUS DEM NACHLAß ZU LEBZEITEN
- 2.1 KINEMATOGRAPHISCHES VERFAHREN - EINORDNUNG UND DEFINITION
- 2.2 DIE SKIZZEN NACHLAß ZU LEBZEITEN
- 2.2.1 Triedere (1926)
- 2.2.1.1 Physiognomie der Dinge
- 2.2.1.2 Raum
- 2.2.1.3 Zeit
- 2.2.2 Die Maus (1918); Das Fliegenpapier (1914)
- 3 DAS KINEMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DREI FRAUEN AM BEISPIEL DER NOVELLE „GRIGIA“
- 3.1 VORBEMERKUNG
- 3.2 FUNKTION DER ERZÄHLPERSPEKTIVEN
- 3.3 WAHRNEHMUNGSWELT
- 3.4 RAUM
- 3.5 ZEIT
- 4 ZUSAMMENFASSENDES FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Robert Musil kinematographische Verfahren in seinen Texten verwendet. Es wird geklärt, wie Musil auf das Kino reagierte und welche Aspekte ihn zu theoretischen Überlegungen über dieses neue Medium inspirierten, die er in sein literarisches Schaffen integrierte. Die Arbeit beleuchtet die perzeptionsorientierte Umwälzung um 1900 und die damit verbundene Veränderung des Sehens in der Literatur.
- Musils Verhältnis zum Kinematographen und seine theoretischen Reflexionen darüber.
- Die Anwendung kinematographischer Erzähltechniken in Musils Texten.
- Analyse ausgewählter Texte im Hinblick auf kinematographische Verfahren.
- Die Rolle von Wahrnehmung, Raum und Zeit in Musils Erzählweise.
- Der Einfluss der Gestalttheorie und experimenteller Psychologie auf Musils Werk.
Zusammenfassung der Kapitel
1 ROBERT MUSIL UND DIE BEDEUTUNG DES KINEMATOGRAPHEN IN SEINER ZEIT: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Kinematographen und Musils Verhältnis zu diesem neuen Medium. Es analysiert seine dichtungstheoretischen und ästhetischen Reflexionen über den Film, insbesondere seine Auseinandersetzung mit der Gestalttheorie und experimenteller Psychologie. Der Fokus liegt auf Musils Essays „Skizze der Erkenntnis des Dichters“ und „Ansätze zu neuer Ästhetik“, um sein Interesse an der Übertragung von Wahrnehmungsdaten zu beleuchten und den Grundstein für die Analyse seiner kinematographischen Erzählweise zu legen. Die technologische Entwicklung des Kinematographen und die damit einhergehende Veränderung der Wahrnehmung bilden den Ausgangspunkt für die Betrachtung von Musils Werk.
2 DAS KINEMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN AUSGEWÄHLTEN SKIZZEN AUS DEM NACHLAß ZU LEBZEITEN: Dieses Kapitel definiert zunächst das „kinematographische Erzählen“ und wendet diese Definition auf Musils Erzählverfahren an. Es analysiert die Prosaskizzen „Triedere“, „Die Maus“ und „Das Fliegenpapier“ aus Musils Nachlass, um die im ersten Kapitel erarbeiteten Ergebnisse zu veranschaulichen. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Physiognomie der Dinge, Raum und Zeit in den Skizzen und wie diese Elemente die kinematographischen Aspekte der Erzählweise unterstützen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Wahrnehmung und der Darstellung von Wirklichkeit durch die Kamera-Perspektive in Musils Werken.
3 DAS KINEMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DREI FRAUEN AM BEISPIEL DER NOVELLE „GRIGIA“: Dieses Kapitel untersucht die Novelle „Grigia“ aus dem Band „Drei Frauen“ auf kinematographische Erzähltechniken. Im Gegensatz zu den vorherigen Kapiteln, die sich auf Skizzen konzentrierten, wird hier die Anwendung kinematographischer Verfahren in einer längeren Erzählung analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Erzählperspektiven, die Wahrnehmungswelt, die Darstellung von Raum und Zeit und wie diese Elemente zur kinematographischen Struktur der Novelle beitragen. Es werden Erzähltechniken untersucht, die in den vorherigen Kapiteln nicht behandelt wurden.
Schlüsselwörter
Robert Musil, Kinematograph, Film, Erzähltechnik, Wahrnehmung, Raum, Zeit, Gestalttheorie, Experimentalpsychologie, „Ansätze zu neuer Ästhetik“, „Skizze der Erkenntnis des Dichters“, „Triedere“, „Die Maus“, „Das Fliegenpapier“, „Grigia“, Wirklichkeit, Verfremdung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Robert Musil und das kinematographische Verfahren
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Robert Musil kinematographische Verfahren in seinen Texten verwendet. Sie analysiert Musils Reaktion auf das Kino und die daraus resultierenden theoretischen Überlegungen, die er in sein literarisches Schaffen integrierte. Ein Schwerpunkt liegt auf der perzeptionsorientierten Umwälzung um 1900 und der damit verbundenen Veränderung des Sehens in der Literatur.
Welche Aspekte von Musils Werk werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet Musils Verhältnis zum Kinematographen und seine theoretischen Reflexionen. Sie analysiert die Anwendung kinematographischer Erzähltechniken in seinen Texten, untersucht ausgewählte Texte auf kinematographische Verfahren und analysiert die Rolle von Wahrnehmung, Raum und Zeit in Musils Erzählweise. Der Einfluss der Gestalttheorie und experimentellen Psychologie auf Musils Werk wird ebenfalls betrachtet.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Texte von Robert Musil, darunter die Prosaskizzen „Triedere“, „Die Maus“ und „Das Fliegenpapier“ aus seinem Nachlass sowie die Novelle „Grigia“ aus dem Band „Drei Frauen“. Zusätzlich werden Musils Essays „Skizze der Erkenntnis des Dichters“ und „Ansätze zu neuer Ästhetik“ herangezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Kapitel 1 untersucht die Entwicklung des Kinematographen und Musils Verhältnis dazu, inklusive seiner theoretischen Reflexionen. Kapitel 2 definiert das „kinematographische Erzählen“ und wendet es auf ausgewählte Skizzen an. Kapitel 3 analysiert die Novelle „Grigia“ im Hinblick auf kinematographische Erzähltechniken. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist unter „kinematographischem Erzählen“ zu verstehen?
Die Arbeit definiert „kinematographisches Erzählen“ als ein Erzählverfahren, das sich an den Techniken und der Ästhetik des Films orientiert. Dies beinhaltet Aspekte wie die Darstellung von Wahrnehmung, Raum und Zeit, die Verwendung verschiedener Perspektiven und die Inszenierung von Wirklichkeit.
Welche Rolle spielen Wahrnehmung, Raum und Zeit in der Analyse?
Wahrnehmung, Raum und Zeit sind zentrale analytische Kategorien. Die Arbeit untersucht, wie diese Elemente in Musils Texten dargestellt werden und wie sie zur kinematographischen Struktur der Erzählungen beitragen. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Wirklichkeit und der Veränderung der Wahrnehmung durch die neue Technologie des Kinos.
Welche Bedeutung hat die Gestalttheorie?
Die Gestalttheorie spielt eine wichtige Rolle, da Musils ästhetische und dichtungstheoretische Reflexionen zum Film stark von ihr beeinflusst sind. Die Arbeit untersucht, wie die Prinzipien der Gestalttheorie in Musils kinematographischem Erzählen zum Ausdruck kommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Robert Musil, Kinematograph, Film, Erzähltechnik, Wahrnehmung, Raum, Zeit, Gestalttheorie, Experimentalpsychologie, „Ansätze zu neuer Ästhetik“, „Skizze der Erkenntnis des Dichters“, „Triedere“, „Die Maus“, „Das Fliegenpapier“, „Grigia“, Wirklichkeit, Verfremdung.
- Quote paper
- Constanze Meier (Author), 2001, Das kinematographische Verfahren in Robert Musils Erzählungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6794