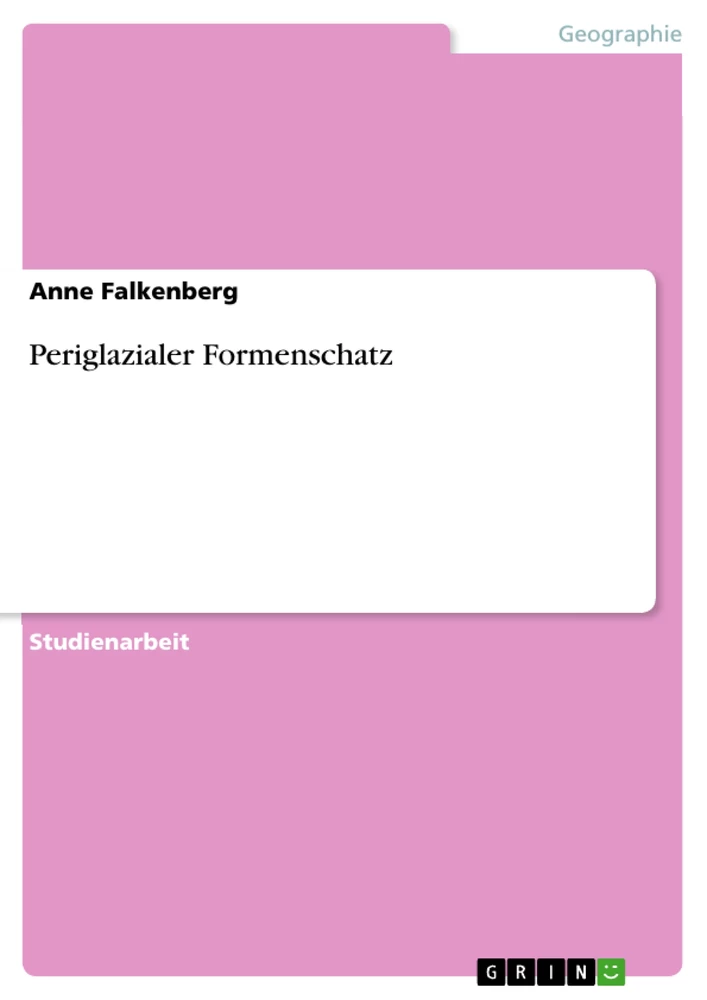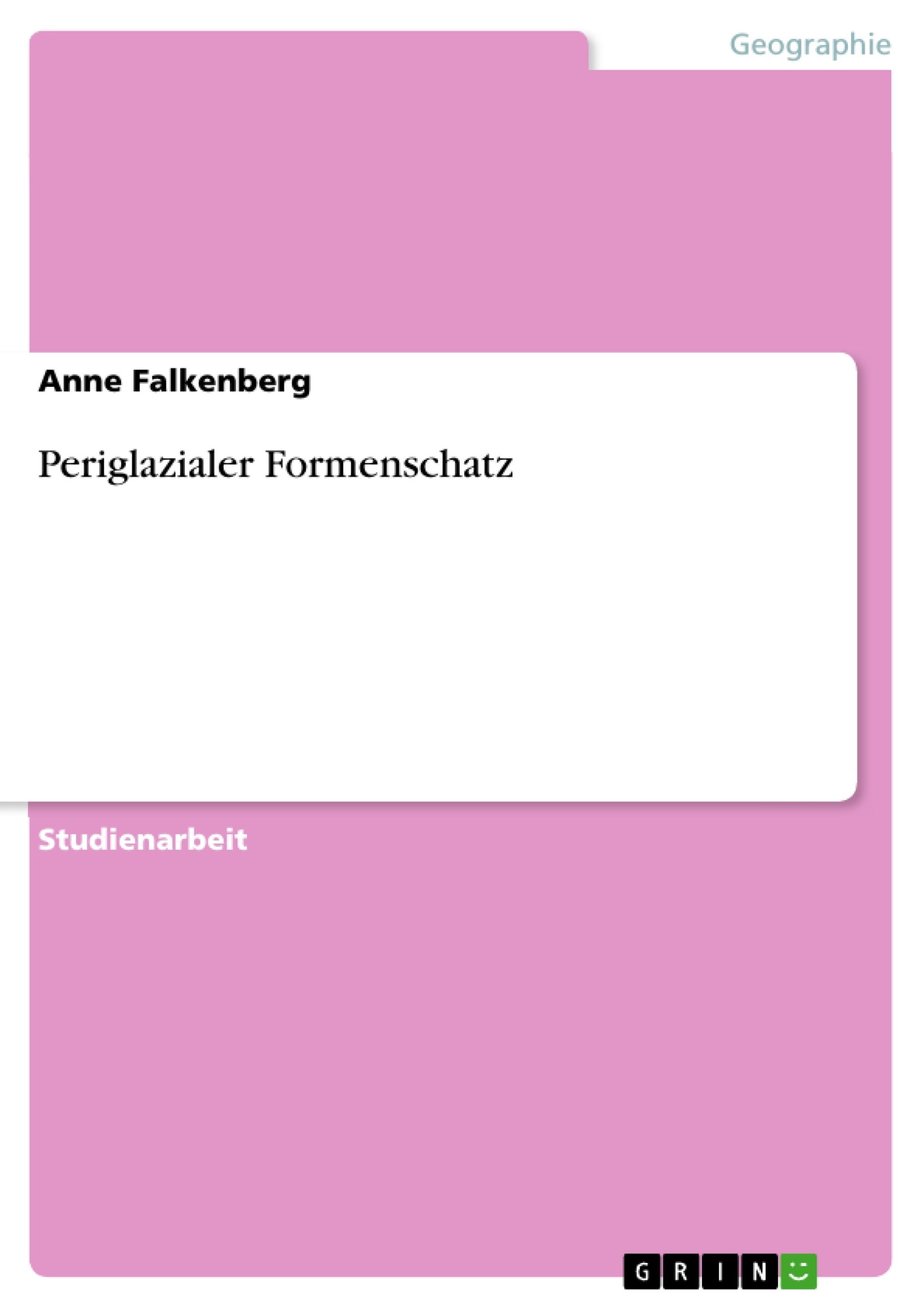Periglazial ist „ein Zeit-, Klima-, Ökosystemzustands-, Sediment- und Georelief-formbegriff der allgemein im Eis- bzw. Gletscherumland gebildet oder entstanden“ bedeutet.“ (aus Leser 1998, S. 611) Eine genaue Übersetzung von periglazial ist „das Eis umgebend“. Voraussetzung dafür sind jahres- und tageszeitlicher Frostwechsel und ein ganzjährig ge-frorener Untergrund. Der wichtigste Prozess dieser Erscheinung ist die Solifluktion (vgl. Zepp. 2004, S. 205). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition Periglazial
- 2. Periglazialgebiete
- 2.1 Subpolare Periglazialzone
- 2.2 Periglaziale Höhenstufen in Hochgebirgen
- 3. Frostboden
- 3.1 Definition
- 3.2 Gliederung des Permafrostbodens
- 3.3 Gliederung des Dauerfrostbodens
- 3.3.1 Auftauboden (Mollisol, active Layer)
- 4. Formen des Periglazialen Formenschatzes
- 4.1 Formen
- 4.2 Arten der Hangsolifluktion
- 4.3 Formen der Hangsolifluktion
- 4.4 Solifluktionsformen der außerpolaren Klimabereiche
- 5. Vorzeitliche Periglazialformen
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem periglazialen Formenschatz, seinen Gebieten und den damit verbundenen Prozessen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Definition, Ausprägung und der verschiedenen Formen des Periglazialraumes zu vermitteln.
- Definition und Charakteristika des Periglazialraumes
- Klassifizierung und Verbreitung periglazialer Gebiete (subpolare Zonen und Hochgebirge)
- Eigenschaften und Prozesse im Frostboden (Permafrost)
- Vielfalt periglazialer Formen und Prozesse (Solifluktion)
- Relevanz von vorzeitlichen Periglazialformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition Periglazial: Der Begriff "Periglazial" beschreibt ein geomorphologisches System, das durch jahreszeitlichen Frostwechsel und ganzjährig gefrorenen Untergrund charakterisiert ist. Die Solifluktion ist der wichtigste Prozess in diesem Umfeld. Die Definition betont die Zusammenhänge zwischen Klima, Zeit, Ökosystem, Sediment und Georelief.
2. Periglazialgebiete: Dieses Kapitel unterteilt periglaziale Gebiete in subpolare Zonen und Hochgebirge. Die subpolare Zone wird weiter in Frostschuttzone (mit freier Solifluktion), Tundrenzone (mit gebundener Solifluktion) und den borealen Waldgürtel (mit sporadischem Permafrost und Thermokarst) untergliedert. In Hochgebirgen werden subnivale, alpine und subalpine Stufen unterschieden, jede mit spezifischer Vegetation und Frostwechselintensität. Die unterschiedliche Vegetation beeinflusst maßgeblich die Solifluktionsprozesse.
3. Frostboden: Dieses Kapitel definiert Frostboden als Boden, der mindestens zwei Winter und einen Sommer mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufweist. Schwerpunkt ist der Dauerfrostboden (Permafrost), der etwa 20% der Erdoberfläche bedeckt. Der Permafrost wird in "frozen ground", reliktischen Permafrost (glazial bedingt) und rezenten Permafrost (klimabedingt) unterteilt. Der rezente Permafrost ist trockener und weniger mächtig als der eishaltige Permafrost und kommt in Gebieten mit weniger als 100 mm Jahresniederschlag vor. Der Auftauboden als oberste, im Sommer auftauende Schicht des Permafrostes wird ebenfalls beschrieben.
Schlüsselwörter
Periglazial, Permafrost, Solifluktion, Frostboden, Subpolare Periglazialzone, Hochgebirge, Tundrenzone, Frostschuttzone, Thermokarst, Auftauboden, Klima, Geomorphologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Periglazialer Formenschatz"
Was ist der Inhalt des Textes "Periglazialer Formenschatz"?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den periglazialen Formenschatz. Er beinhaltet eine Definition des Periglaziars, eine Beschreibung periglazialer Gebiete (subpolare Zonen und Hochgebirge), eine detaillierte Erläuterung von Frostböden (inkl. Permafrost und Auftauboden), eine Darstellung verschiedener periglazialer Formen (mit Schwerpunkt auf Solifluktion) und einen Ausblick auf vorzeitliche Periglazialformen. Zusätzlich enthält der Text ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird unter "Periglazial" verstanden?
Der Begriff "Periglazial" beschreibt ein geomorphologisches System, das durch jahreszeitlichen Frostwechsel und ganzjährig gefrorenen Untergrund (Permafrost) charakterisiert ist. Solifluktion ist der wichtigste Prozess in diesem Umfeld. Die Definition betont die Interaktion von Klima, Zeit, Ökosystem, Sediment und Georelief.
Welche Gebiete werden als periglazial bezeichnet?
Periglaziale Gebiete werden in subpolare Zonen und Hochgebirge unterteilt. Die subpolare Zone wird weiter in Frostschuttzone, Tundrenzone und borealen Waldgürtel untergliedert, jeweils mit unterschiedlichen Merkmalen bezüglich Permafrost und Solifluktion. In Hochgebirgen werden subnivale, alpine und subalpine Stufen unterschieden, die sich in Vegetation und Frostwechselintensität unterscheiden.
Was ist Frostboden und wie wird er unterteilt?
Frostboden ist Boden, der mindestens zwei Winter und einen Sommer Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufweist. Der Dauerfrostboden (Permafrost), der etwa 20% der Erdoberfläche bedeckt, spielt eine zentrale Rolle. Der Permafrost wird in "frozen ground", reliktischen Permafrost (glazial bedingt) und rezenten Permafrost (klimabedingt) unterteilt. Der Auftauboden ist die oberste, im Sommer auftauende Schicht des Permafrostes.
Welche Bedeutung hat Solifluktion im periglazialen Formenschatz?
Solifluktion ist ein wichtiger Prozess im periglazialen Umfeld und wird im Text ausführlich behandelt, inklusive verschiedener Arten und Formen, die sich je nach Gebiet und Klima unterscheiden (z.B. freie und gebundene Solifluktion).
Welche Rolle spielen vorzeitliche Periglazialformen?
Der Text erwähnt die Relevanz von vorzeitlichen Periglazialformen, geht aber nicht detailliert darauf ein. Es wird lediglich auf deren Bedeutung hingewiesen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Periglazial, Permafrost, Solifluktion, Frostboden, Subpolare Periglazialzone, Hochgebirge, Tundrenzone, Frostschuttzone, Thermokarst, Auftauboden, Klima, Geomorphologie.
- Citar trabajo
- Anne Falkenberg (Autor), 2004, Periglazialer Formenschatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67504