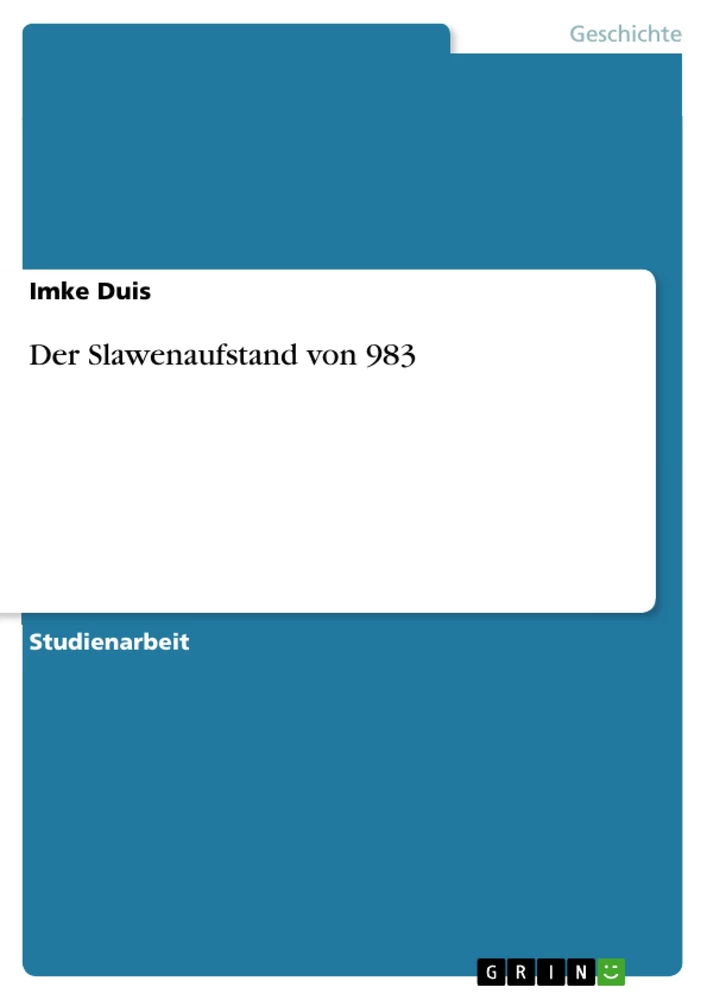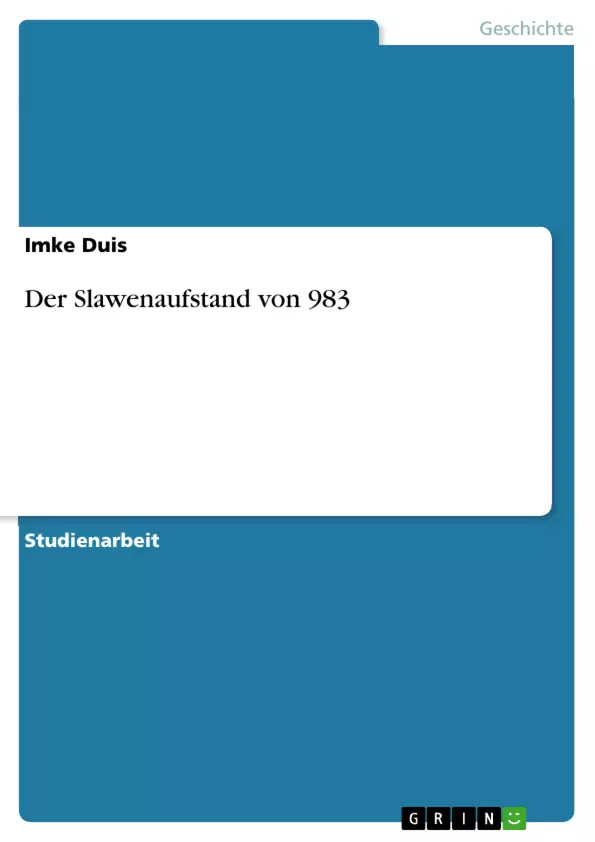1 Einleitung
Der Aufstand der Slawen im Jahre 983 war in erster Linie ein Aufstand gegen das Christentum (Ludat 1995: 4). Seine politischen Folgen waren jedoch zumindest ebenso weitreichend wie seine religiösen. In den 940er Jahren wurden im Gebiet zwischen Elbe und Oder erste Bistümer errichtet, um die Christianisierung des elbslawischen Raums einzuläuten. Die Taufe des Piastenherrschers Mieszko I. und die nachfolgende Christianisierung des piastischen Staates östlich der elbslawischen Region ist als erste Phase eines weitreichenden Missionierungsvorgangs zu nennen. In der Zeit um das Jahr 1000 wurden nämlich weite, zusammenhängende Teile des slawischen Siedlungsgebietes christianisiert (Ludat 1995: 5). Der Aufstand vom Sommer 983 brach aus den Kerngebieten des Lutizenbundes gegen die deutsche und christliche Herrschaft los. Der Lutizenbund bildete sich im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts aus verschiedenen Stämmen der Wilzen (Ludat 1995: 9). Der Name der Wilzen wird für die nachfolgende Zeit in Quellen nicht mehr genannt. Das Zentrum des Lutizenbundes mag um die Tempelburg Rethra gelegen haben, deren genaue Lage uns jedoch heute nicht mehr bekannt ist (Angermann et al. 1995: 763). In erster Linie scheint die Burg eine kultische Funktion gehabt zu haben und als eine Art Olymp für slawische Gottheiten gedient zu haben.
Durch den Aufstand von 983 bildete sich zunächst ein militärischer und politischer Bund all jener christlichen Mächte, die von den Ereignissen betroffen waren und Interesse am elbslawischen Gebiet hatten (Ludat 1995: 5). Die christlichen Mächte waren das Deutsche Reich, das piastische Polen sowie zeitweise die böhmische Premyslidenmacht. Sie versuchten die alte Ordnung in jahrzehntelangen Kämpfen wiederherzustellen. Außerdem lag ihnen die Befriedung und Christianisierung der Völker in den entsprechenden Gebieten nahe (Ludat 1995: 6).
Um die Jahrtausendwende brach dann aber ein innerimperischer Konflikt zwischen Boleslaw Chrobry, der mittlerweile seinen 992 verstorbenen Vater Mieszko I. als Herrscher Polens beerbt hatte, und dem neu gewählten deutschen König Heinrich II., aus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zeit vor dem Aufstand
- Der Ablauf des Aufstandes
- Gründe für den Aufstand
- Der Lutizenbund
- Die Zeit nach dem Aufstand
- Das Lutizenbündnis von 1003 und die Jahre danach
- Das Ende der Lutizen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den slawischen Aufstand von 983, seine Ursachen, seinen Verlauf und seine langfristigen Folgen für die Region zwischen Elbe und Oder. Der Fokus liegt auf der politischen und religiösen Dimension des Aufstandes und seiner Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den slawischen Stämmen und ihren christlichen Nachbarn (Deutsches Reich, Polen, Böhmen).
- Der slawische Widerstand gegen die Christianisierung
- Die politische Organisation der Lutizen und anderer slawischer Stämme
- Die Rolle des Deutschen Reiches, Polens und Böhmens im Konflikt
- Die langfristigen Folgen des Aufstandes für die regionale Entwicklung
- Der Einfluss religiöser und politischer Faktoren auf den Verlauf des Aufstandes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den slawischen Aufstand von 983 als einen Aufstand gegen die Christianisierung, der weitreichende politische Folgen hatte. Sie skizziert die Christianisierung des Gebiets zwischen Elbe und Oder im 10. Jahrhundert und den Kontext des Aufstandes im Lutizenbund.
Die Zeit vor dem Aufstand: Dieses Kapitel beschreibt die politische und religiöse Situation vor dem Aufstand. Es schildert die Politik des Deutschen Reiches gegenüber seinen östlichen Nachbarn im 10. Jahrhundert, die Bemühungen um die Eingliederung der slawischen Stämme und die Einführung christlicher Strukturen. Der Widerstand der Slawen gegen diese Politik wird hervorgehoben, sowie die Rolle von Königen wie Heinrich I. und Otto I. bei der Unterwerfung der slawischen Stämme. Die zersplitterte Organisation der slawischen Stämme wird als ein Faktor im Kampf gegen das Deutsche Reich dargestellt.
Der Ablauf des Aufstandes: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf des Aufstandes von 983. Es schildert die Beteiligung der Lutizen, Obodriten und Heveller und die Geschwindigkeit, mit der sie die christliche Herrschaft in der Region zusammenbrechen ließen. Das Kapitel hebt den Erfolg der Slawen im Erkämpfen ihrer Autonomie hervor und bezeichnet die Dauer dieser Freiheit als bemerkenswert. Es nennt den 29. Juni 983 als den ersten Tag des Aufstandes, an dem Lutizen in Havelberg eindrangen und den Bischofssitz zerstörten.
Gründe für den Aufstand: [Da der Originaltext keinen Abschnitt "Gründe für den Aufstand" enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
Der Lutizenbund: Dieses Kapitel beschreibt den Lutizenbund, einen slawischen Stammesverband, der eine bedeutende Rolle im Aufstand spielte. Der Abschnitt befasst sich mit der Entstehung, der Organisation und den Zielen des Bundes. Es wird der Einfluss des Bundes auf die weitere Entwicklung der Region zwischen Elbe und Oder im Kontext des Aufstandes von 983 und der darauffolgenden politischen Entwicklung, insbesondere im Bezug auf die Beziehungen zum Deutschen Reich, erörtert. Die Bedeutung des Bündnisses von 1003 zwischen dem Deutschen Reich und den Lutizen sowie die damit verbundenen Konsequenzen für Polen werden umfassend erklärt.
Schlüsselwörter
Slawenaufstand 983, Lutizenbund, Christianisierung, Deutsches Reich, Polen, Böhmen, Wilzen, Obodriten, Heveller, Missionierung, regionale Entwicklung, politische Organisation, religiöser Widerstand, Stammesverbände.
Häufig gestellte Fragen zum Slawischen Aufstand von 983
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den slawischen Aufstand von 983 zwischen Elbe und Oder. Sie analysiert die Ursachen, den Verlauf und die langfristigen Folgen des Aufstandes, mit besonderem Fokus auf die politische und religiöse Dimension und die Beziehungen zwischen den slawischen Stämmen und ihren christlichen Nachbarn (Deutsches Reich, Polen, Böhmen).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den slawischen Widerstand gegen die Christianisierung, die politische Organisation der Lutizen und anderer slawischer Stämme, die Rolle des Deutschen Reiches, Polens und Böhmens im Konflikt, die langfristigen Folgen des Aufstandes für die regionale Entwicklung und den Einfluss religiöser und politischer Faktoren auf den Verlauf des Aufstandes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, der Zeit vor dem Aufstand, dem Ablauf des Aufstandes, den Gründen für den Aufstand (obwohl im Originaltext fehlend), dem Lutizenbund (inklusive der Zeit nach dem Aufstand, dem Bündnis von 1003 und dem Ende der Lutizen) und eine Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den slawischen Aufstand von 983 als Aufstand gegen die Christianisierung mit weitreichenden politischen Folgen. Sie skizziert die Christianisierung des Gebiets zwischen Elbe und Oder im 10. Jahrhundert und den Kontext des Aufstandes im Lutizenbund.
Was wird im Kapitel "Die Zeit vor dem Aufstand" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die politische und religiöse Situation vor dem Aufstand, die Politik des Deutschen Reiches gegenüber seinen östlichen Nachbarn, die Bemühungen um die Eingliederung der slawischen Stämme und die Einführung christlicher Strukturen. Der slawische Widerstand und die Rolle von Königen wie Heinrich I. und Otto I. werden hervorgehoben, ebenso wie die zersplitterte Organisation der slawischen Stämme.
Was wird im Kapitel "Der Ablauf des Aufstandes" beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf des Aufstandes von 983, die Beteiligung der Lutizen, Obodriten und Heveller und ihren Erfolg im Zusammenbruch der christlichen Herrschaft. Der 29. Juni 983 wird als erster Tag des Aufstandes genannt, an dem Lutizen in Havelberg eindrangen und den Bischofssitz zerstörten.
Was wird im Kapitel "Gründe für den Aufstand" behandelt?
Der Originaltext enthält keinen Abschnitt zu den Gründen des Aufstandes. Daher kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.
Was wird im Kapitel "Der Lutizenbund" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Lutizenbund, seine Entstehung, Organisation und Ziele. Es erörtert den Einfluss des Bundes auf die Entwicklung der Region zwischen Elbe und Oder im Kontext des Aufstandes von 983 und die Beziehungen zum Deutschen Reich. Die Bedeutung des Bündnisses von 1003 und die Konsequenzen für Polen werden erklärt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Slawenaufstand 983, Lutizenbund, Christianisierung, Deutsches Reich, Polen, Böhmen, Wilzen, Obodriten, Heveller, Missionierung, regionale Entwicklung, politische Organisation, religiöser Widerstand, Stammesverbände.
- Arbeit zitieren
- Imke Duis (Autor:in), 2003, Der Slawenaufstand von 983, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67370