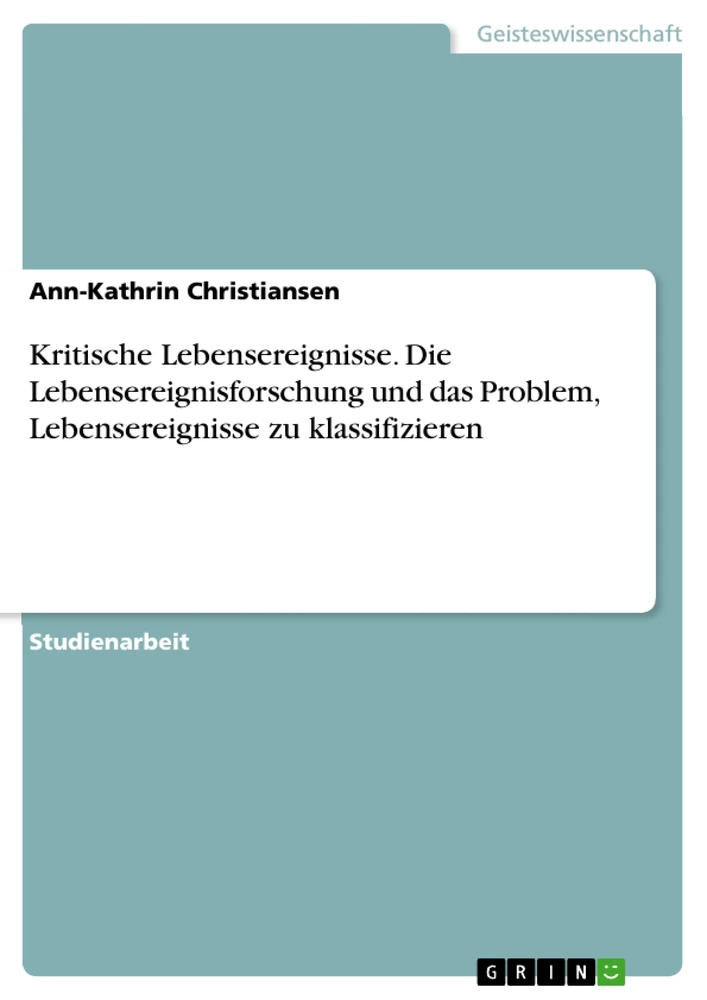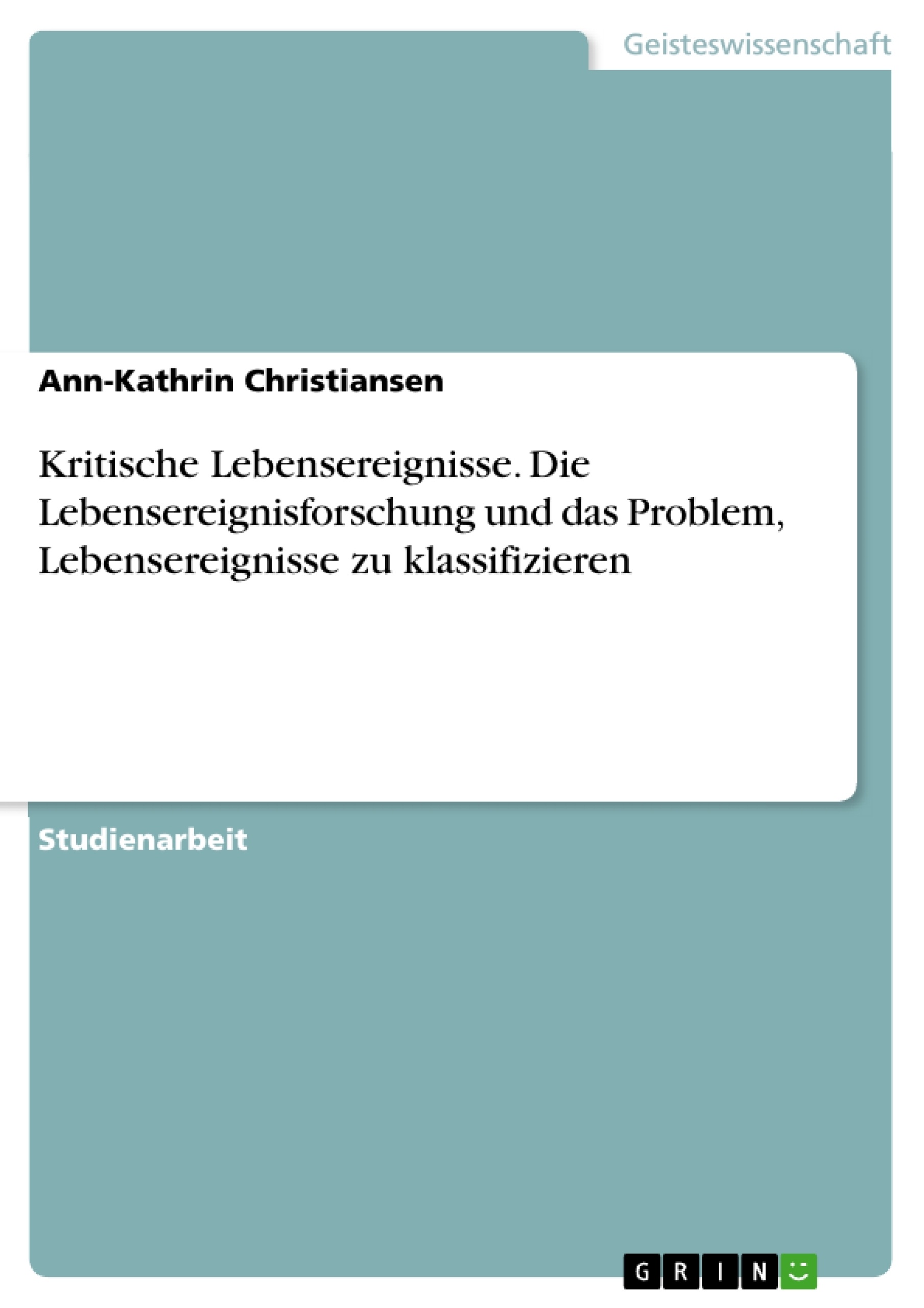Ein Elternteil eines Kindes stirbt. Dieses Erlebnis ist wohl eines der schlimmsten, das man sich für einen Menschen vorstellen kann. Das Geschehene wird für das Kind zu einem kritischen Lebensereignis. Es erfordert eine unendlich schmerzliche Bewältigung. Schlägt die Bewältigung fehl, so kann es womöglich auch noch zu weiteren psychischen Krankheiten kommen.
Die Lebensereignisforschung widmet sich diesen Ereignissen. Schon eine Definition für Lebensereignisse zu finden, war nicht leicht. Ich habe die Definition von Filipp (1995a) verwendet, die den Begriff „kritische Lebensereignisse“ gebraucht.
Die Lebensereignisforschung stand vor dem Problem, Lebensereignisse zu klassifizieren. Dies wurde versucht, indem man ihnen Merkmale zuordnete.
Im Weiteren gehe ich auf die unterschiedlichen Forschungsperspektiven ein, die die Lebensereignisforschung bietet. In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf zu achten, mit welchen Methoden die Forschung arbeitet, ob es Kritik zu den Methoden gibt und zu welchen Ergebnissen die Untersuchungen kommen.
Eine große Frage der Lebensereignisforschung ist: Warum kommen einige Menschen mit Lebensereignissen schlechter zurecht als andere? Die Antwort ist nicht leicht zu finden, weil viele Einflüsse beachtet werden müssen. Ich habe mich hier auf die Bewältigung von Lebensereignissen und auf die „Ressourcen“ von Menschen konzentriert. Die möglichen Folgen von Lebensereignissen konnte ich natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen.
Im Anschluss an diesen allgemeinen Theorieteil folgen zwei Beispiele. Ich habe mich für das nicht-normative Lebensereignis „Scheidung der Eltern“ entschieden.
Als Beispiel für ein normatives Lebensereignis habe ich den „Schulwechsel nach der 4. Klasse“ gewählt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Lebensereignissen
- Merkmale kritischer Lebensereignisse
- Forschungsperspektiven
- Klinisch-psychologische Forschung
- Entwicklungspsychologie
- Stressforschung
- Methoden
- Fragebogenansatz
- Kritik am Fragebogenansatz
- Interviewansatz
- Kritik am Interviewansatz
- Münchner Ereignisliste (MEL)
- Kategoriensystem frei generierter Lebensereignisse
- Vergessenseffekt
- Fragebogenansatz
- Bewältigung
- Coping
- Ressourcen
- Das soziale Umfeld als Hilfe zur Bewältigung von kritischen Lebensereignissen
- „Vulnerabilitätsfaktor“ als Erschwernis der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen
- Mögliche Folgen von kritischen Lebensereignissen
- Depressionen als Folge von kritischen Lebensereignissen
- Beispiel für ein nicht-normatives kritisches Lebensereignis: Eine Scheidung der Eltern
- Mögliche Konsequenzen einer Scheidung
- Kurzzeitwirkungen
- Langzeitfolgen
- Mögliche Konsequenzen einer Scheidung
- Ein Beispiel für ein normatives kritisches Lebensereignis: Schulwechsel nach der 4. Klasse
- Einschätzungen vor dem Schulwechsel
- Einschätzungen nach dem Schulwechsel
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit kritischen Lebensereignissen und deren Auswirkungen auf Individuen. Ziel ist es, verschiedene Forschungsperspektiven, Methoden und Bewältigungsstrategien im Umgang mit solchen Ereignissen zu beleuchten. Die Arbeit untersucht sowohl die objektiven als auch subjektiven Merkmale kritischer Lebensereignisse und analysiert mögliche Folgen, anhand von Beispielen wie Scheidung der Eltern und Schulwechsel.
- Definition und Merkmale kritischer Lebensereignisse
- Forschungsmethoden und -perspektiven in der Lebensereignisforschung
- Bewältigungsstrategien und verfügbare Ressourcen
- Mögliche Folgen kritischer Lebensereignisse (z.B. Depressionen)
- Unterschiede zwischen normativen und nicht-normativen kritischen Lebensereignissen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der kritischen Lebensereignisse ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie beginnt mit dem Beispiel des Todes eines Elternteils als besonders schwerwiegendes Ereignis und erläutert die Bedeutung der Lebensereignisforschung für das Verständnis der Bewältigung solcher Erfahrungen und die möglichen Folgen, wie etwa psychische Erkrankungen. Die Arbeit nutzt die Definition von Filipp (1995a) für "kritische Lebensereignisse" und kündigt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Forschungsperspektiven, Methoden und der Frage nach individuellen Unterschieden im Umgang mit solchen Ereignissen an. Abschließend werden die beiden Beispielfälle, Scheidung der Eltern und Schulwechsel, vorgestellt.
Definition von Lebensereignissen: Dieses Kapitel definiert kritische Lebensereignisse nach Filipp (1995a) als reale Lebenserfahrungen, die eine Zäsur im Lebenslauf darstellen und von Betroffenen oft retrospektiv als Einschnitte und Übergänge wahrgenommen werden. Kritische Lebensereignisse werden als systemimmanente Widersprüche in der Person-Umwelt-Beziehung beschrieben, die eine Lösung oder ein neues Gleichgewicht erfordern. Der Begriff "kritisch" charakterisiert das Ereignis als Wendepunkt. Die Definition betont die Veränderungen der Lebenssituation und die damit verbundenen Anpassungsleistungen, die oft als stressreich erlebt werden, unabhängig davon, ob das Ereignis vermeintlich positiv oder negativ ist. Die Ereignisse treten meist schlagartig und massiv auf, auch wenn die Folgen lang anhaltend sein können.
Merkmale kritischer Lebensereignisse: Dieses Kapitel befasst sich mit der Klassifizierung kritischer Lebensereignisse und den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewertung eines Ereignisses als kritisch von kulturellen, gesellschaftlichen und zeitlichen Faktoren abhängt. Die Klassifizierung versucht, kritische Lebensereignisse anhand objektiver und subjektiver Merkmale zu differenzieren. Ein Beispiel für ein objektives Merkmal ist der Grad der Universalität, der angibt, wie viele Personen von einem Ereignis betroffen sind.
Schlüsselwörter
Kritische Lebensereignisse, Lebensereignisforschung, Bewältigung, Coping, Ressourcen, Stress, Depressionen, Scheidung, Schulwechsel, normative und nicht-normative Lebensereignisse, Person-Umwelt-Beziehung, Anpassungsleistungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Kritische Lebensereignisse - Eine Forschungsübersicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit kritischen Lebensereignissen und deren Auswirkungen auf Individuen. Sie beleuchtet verschiedene Forschungsperspektiven, Methoden und Bewältigungsstrategien im Umgang mit solchen Ereignissen. Die Arbeit untersucht sowohl die objektiven als auch subjektiven Merkmale kritischer Lebensereignisse und analysiert mögliche Folgen anhand von Beispielen wie Scheidung der Eltern und Schulwechsel.
Wie werden kritische Lebensereignisse definiert?
Kritische Lebensereignisse werden als reale Lebenserfahrungen definiert, die eine Zäsur im Lebenslauf darstellen und von Betroffenen oft retrospektiv als Einschnitte und Übergänge wahrgenommen werden. Sie stellen systemimmanente Widersprüche in der Person-Umwelt-Beziehung dar, die eine Lösung oder ein neues Gleichgewicht erfordern. Die Definition betont die Veränderungen der Lebenssituation und die damit verbundenen Anpassungsleistungen, die oft als stressreich erlebt werden, unabhängig von der vermeintlich positiven oder negativen Bewertung des Ereignisses.
Welche Merkmale haben kritische Lebensereignisse?
Kritische Lebensereignisse lassen sich anhand objektiver und subjektiver Merkmale klassifizieren. Die Bewertung eines Ereignisses als kritisch hängt von kulturellen, gesellschaftlichen und zeitlichen Faktoren ab. Objektive Merkmale können z.B. den Grad der Universalität (wie viele Personen sind betroffen?) umfassen. Subjektive Merkmale berücksichtigen die individuelle Wahrnehmung und Bewertung des Ereignisses.
Welche Forschungsperspektiven werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Forschungsperspektiven, darunter die klinisch-psychologische Forschung, die Entwicklungspsychologie und die Stressforschung. Diese Perspektiven liefern unterschiedliche Einblicke in die Entstehung, Bewältigung und Folgen kritischer Lebensereignisse.
Welche Methoden werden in der Lebensereignisforschung eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Forschungsmethoden, darunter den Fragebogenansatz (mit Kritikpunkten), den Interviewansatz (ebenfalls mit Kritikpunkten), die Münchner Ereignisliste (MEL) und ein Kategoriensystem für frei generierte Lebensereignisse. Der Vergessen-Effekt bei der Erhebung von Daten wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Bewältigung (Coping)?
Die Arbeit untersucht verschiedene Bewältigungsstrategien (Coping) im Umgang mit kritischen Lebensereignissen. Dabei wird die Bedeutung des sozialen Umfelds als Hilfe und der "Vulnerabilitätsfaktor" als Erschwernis der Bewältigung beleuchtet.
Welche Folgen können kritische Lebensereignisse haben?
Mögliche Folgen kritischer Lebensereignisse werden diskutiert, insbesondere Depressionen als eine mögliche Konsequenz. Die Arbeit unterscheidet zwischen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen, insbesondere anhand des Beispiels einer Trennung der Eltern.
Wie werden normative und nicht-normative Lebensereignisse unterschieden?
Die Arbeit illustriert den Unterschied anhand von Beispielen: Die Scheidung der Eltern als nicht-normatives und der Schulwechsel nach der 4. Klasse als normatives kritisches Lebensereignis. Die jeweiligen Einschätzungen vor und nach dem Ereignis werden verglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kritische Lebensereignisse, Lebensereignisforschung, Bewältigung, Coping, Ressourcen, Stress, Depressionen, Scheidung, Schulwechsel, normative und nicht-normative Lebensereignisse, Person-Umwelt-Beziehung, Anpassungsleistungen.
- Quote paper
- Ann-Kathrin Christiansen (Author), 2006, Kritische Lebensereignisse. Die Lebensereignisforschung und das Problem, Lebensereignisse zu klassifizieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67361