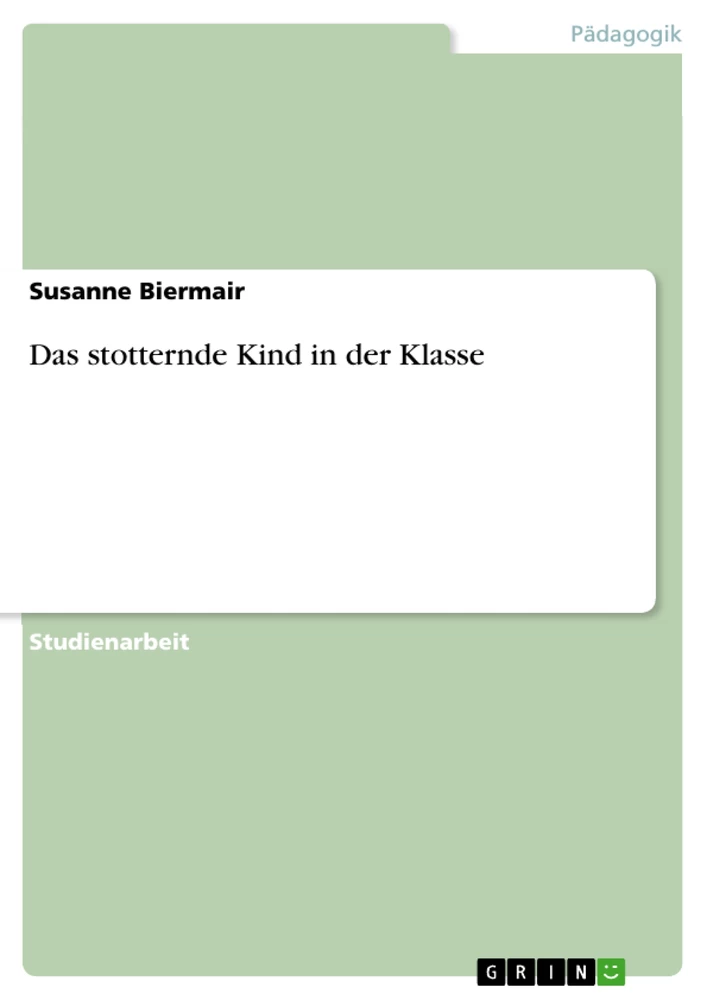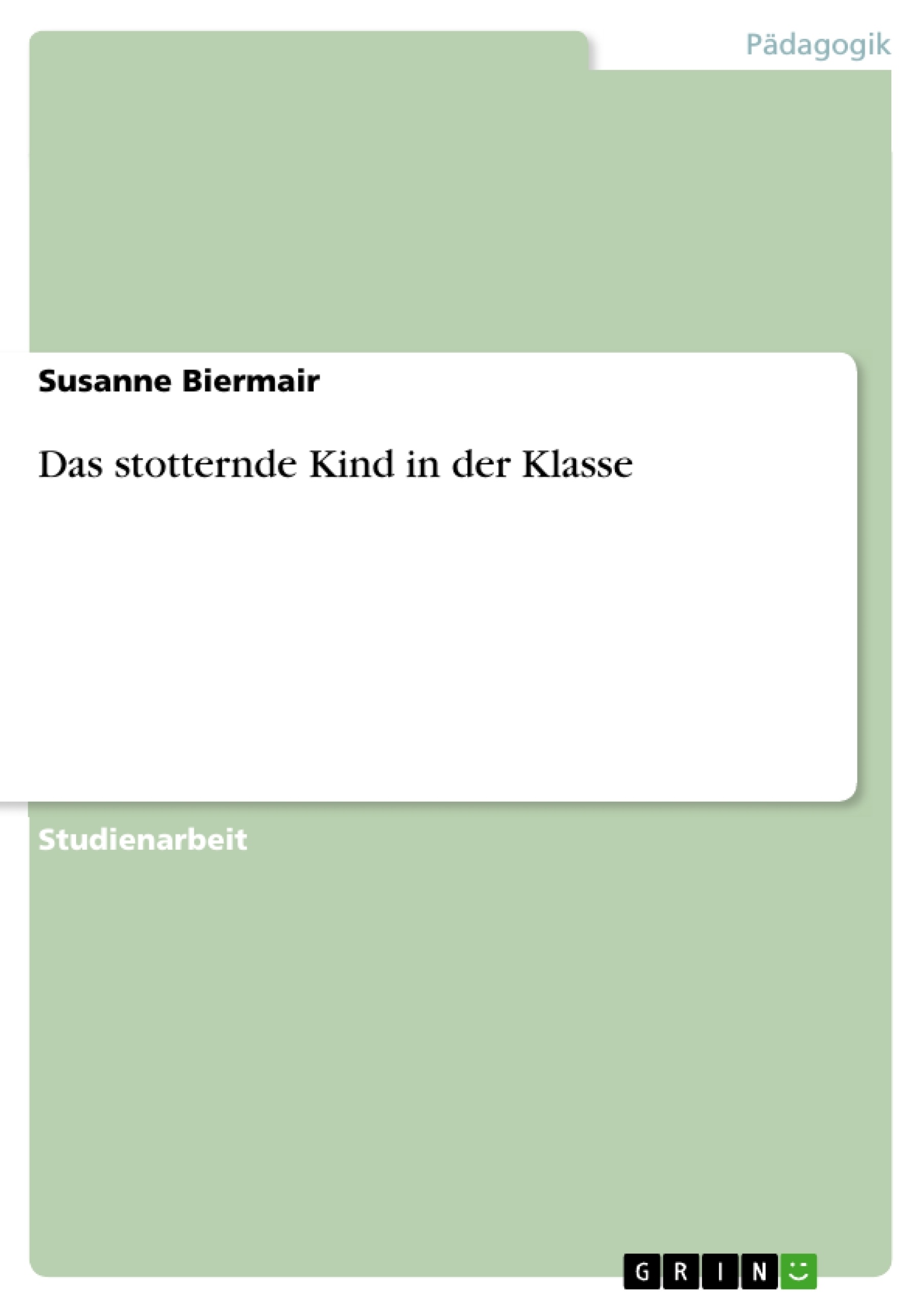Stottern ist eine zeitweise auftretende, willensunabhängige, situationsabhängige Redeflussstörung. Die Ursache ist im Einzelfall oft nicht bekannt. Die Störung ist durch angespanntes, stummes Verharren in der Artikulationsstellung (tonisches Stottern), Wiederholungen (klonisches Stottern), Dehnungen und Vermeidungsreaktionen charakterisiert. Eine allgemein gültige, auch die ursächlichen Faktoren berücksichtigende Definition gibt es bis heute nicht. Das liegt hauptsächlich darin begründet, dass es bis heute keine objektiven, vom Zuhörer unabhängigen Kriterien gibt, Unflüssigkeitssymptome sicher als Ausdruck eines Stotterns zu werten oder ein Kind auf Grund bestimmter Symptome sicher als Stotterer zu klassifizieren (vgl. Führing M./Lettmayer O. et al., 2000, S. 70).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Was ist „Stottern“?
- 1.1. Entstehung und Häufigkeit
- 1.2. Beschreibung des Zustandsbildes
- 1.3. Ätiologie und Erklärungsansätze
- 1.4. Entwicklung des echten Stotterns
- 1.5. Formen des Stotterns und Symptome
- 2. Stottern und Schule
- 2.1. Belastungen des stotternden Kindes in der Klasse
- 2.2. Unterstützungsmöglichkeiten der Lehrperson
- 2.3. Beratungsstellen in Österreich
- 3. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Stottern bei Kindern im schulischen Kontext. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Ursachen, Symptome und Auswirkungen von Stottern zu vermitteln und Lehrkräfte über unterstützende Maßnahmen zu informieren.
- Definition und Ursachen von Stottern
- Auswirkungen von Stottern auf das Kind im Schulalltag
- Möglichkeiten der Unterstützung durch Lehrkräfte
- Beschreibung des Zustandsbildes und Sekundärprobleme
- Beratung und Hilfsangebote
Zusammenfassung der Kapitel
1. Was ist „Stottern“?: Dieses Kapitel definiert Stottern als eine willensunabhängige, situationsabhängige Redeflussstörung, die durch verschiedene Symptome wie tonisches und klonisches Stottern charakterisiert ist. Es betont die Komplexität des Phänomens, die sich aus dem Fehlen einer einheitlichen Definition und der Vielzahl möglicher Ursachen ergibt. Die Entstehung von Stottern wird in der frühen Kindheit verortet, wobei physiologische, organische, linguistische und psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Die Häufigkeit von Stottern in der Gesamtbevölkerung und insbesondere bei Kindern im Schulalter wird ebenfalls beleuchtet, wobei ein deutliches Übergewicht bei Jungen festgestellt wird.
2. Stottern und Schule: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, denen stotternde Kinder im schulischen Umfeld begegnen. Es beschreibt die Belastungen, die aus der Sprechstörung resultieren, und zeigt auf, wie diese das Selbstwertgefühl und die soziale Integration des Kindes beeinträchtigen können. Gleichzeitig werden unterstützende Maßnahmen für Lehrkräfte erläutert, die dazu beitragen können, das Kind in seinem Lernprozess zu fördern und seine sprachlichen Schwierigkeiten zu bewältigen. Der Kapitelteil zu Beratungsstellen in Österreich bietet betroffenen Familien und Pädagogen wichtige Anlaufstellen und Hilfestellungen.
Schlüsselwörter
Stottern, Redeflussstörung, Kinder, Schule, Lehrkräfte, Unterstützung, Beratung, Ätiologie, Symptome, Sekundärprobleme, Entwicklung, Häufigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Stottern bei Kindern im Schulischen Kontext
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Stottern bei Kindern im schulischen Kontext. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Ursachen, Symptome und Auswirkungen von Stottern sowie auf der Unterstützung von stotternden Kindern im Schulalltag durch Lehrkräfte.
Was wird unter „Stottern“ verstanden?
Das Dokument definiert Stottern als eine willensunabhängige, situationsabhängige Redeflussstörung. Es werden verschiedene Symptome wie tonisches und klonisches Stottern beschrieben. Die Entstehung von Stottern wird in der frühen Kindheit verortet, wobei physiologische, organische, linguistische und psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Die Häufigkeit von Stottern, insbesondere bei Jungen, wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Auswirkungen hat Stottern auf Kinder im Schulalltag?
Das Dokument beschreibt die Belastungen, denen stotternde Kinder im schulischen Umfeld begegnen. Es zeigt auf, wie Stottern das Selbstwertgefühl und die soziale Integration beeinträchtigen kann. Die Herausforderungen im Lernprozess und die möglichen negativen Auswirkungen auf die schulische Leistung werden thematisiert.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Lehrkräfte im Umgang mit stotternden Kindern?
Das Dokument erläutert unterstützende Maßnahmen für Lehrkräfte, die dazu beitragen können, stotternde Kinder im Lernprozess zu fördern und ihre sprachlichen Schwierigkeiten zu bewältigen. Es werden Strategien und Verhaltensweisen beschrieben, die ein positives und förderliches Lernumfeld schaffen.
Wo finden betroffene Familien und Pädagogen Beratung und Hilfe in Österreich?
Das Dokument nennt Beratungsstellen in Österreich, die betroffenen Familien und Pädagogen wichtige Anlaufstellen und Hilfestellungen bieten. Diese Stellen unterstützen bei der Bewältigung des Stotterns und bieten Beratung und Therapie an.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Themen des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Stottern, Redeflussstörung, Kinder, Schule, Lehrkräfte, Unterstützung, Beratung, Ätiologie, Symptome, Sekundärprobleme, Entwicklung und Häufigkeit.
Welche Kapitel sind im Dokument enthalten?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel: 1. Was ist „Stottern“? (inkl. Entstehung, Häufigkeit, Beschreibung des Zustandsbildes, Ätiologie, Entwicklung und Formen des Stotterns); 2. Stottern und Schule (inkl. Belastungen des Kindes, Unterstützungsmöglichkeiten der Lehrperson und Beratungsstellen in Österreich); 3. Literatur (wahrscheinlich eine Liste der verwendeten Literatur, nicht explizit im Beispiel vorhanden).
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Ziel des Dokuments ist es, ein umfassendes Verständnis für die Ursachen, Symptome und Auswirkungen von Stottern zu vermitteln und Lehrkräfte über unterstützende Maßnahmen zu informieren. Es soll dazu beitragen, stotternde Kinder besser zu verstehen und ihnen im Schulalltag bestmöglich zu helfen.
- Quote paper
- Mag. Susanne Biermair (Author), 2006, Das stotternde Kind in der Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67031