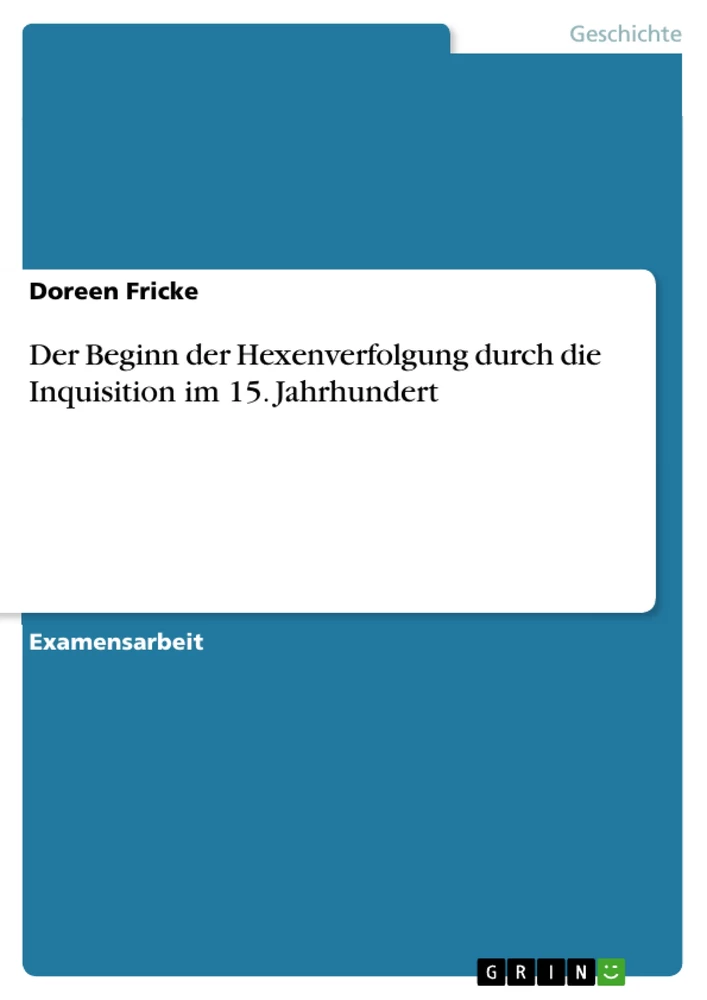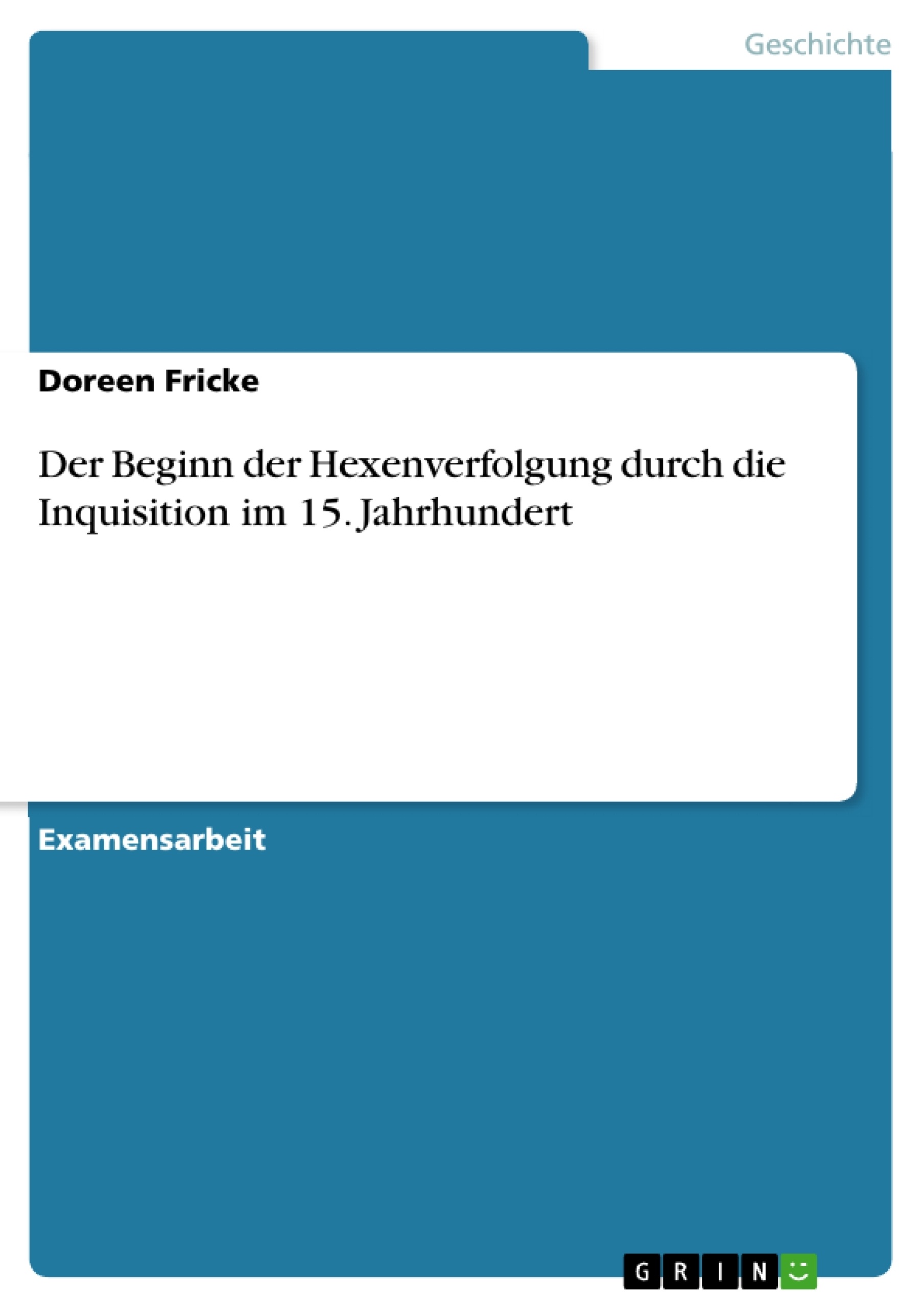Das Denken und Handeln vieler Europäer des Mittelalters war beherrscht von der Vorstellung, man könne durch Zauberei Einfluss auf den Alltag nehmen. So glaubten vor allem die ungebildeten Schichten, man könne mit Hilfe von magischen Riten z. B. Nachbarn aus Neid Schaden zufügen oder sich selbst vor derartigen Angriffen schützen. Derartige Vorstellungen hatte die mittelalterliche Christianisierung der europäischen Länder nicht ausrotten können. Da jedoch das Christentum die offiziell ausgeübte Religion war, duldete die katholische Kirche lange den heidnischen Aberglauben, der unter der Oberfläche erhalten geblieben war. Die Kleriker predigten, dass Zauberei keine Wirkung hätte und dass Menschen, die diese dennoch praktizierten, mit Kirchenbußen zu bestrafen sein, weil sie an die Effizienz der Magie glaubten.
Mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts wandelte sich in einigen europäischen Regionen die Einstellung der katholischen Kirche zur Ausübung nicht-christlicher Rituale. Immer stärker sahen sich christliche Geistliche die Erhaltung des von ihnen praktizierten Glaubens bedroht. Somit galt es, etwas gegen den erhalten gebliebenen heidnischen Aberglauben zu unternehmen. Auf der Suche nach jenen, die Zauberei betrieben, meinten Theologen, eine neue Gemeinschaft von Teufelsbündnern entdeckt zu haben, die nämlich die Hexensekte. Den Mitgliedern dieser vermeintlichen Sekte wurde vorgeworfen, einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein, um seine Hilfe bei der Schädigung von Mitmenschen beanspruchen und mit ihm Unzucht treiben zu können.
Für die Bekämpfung der Hexen war die Inquisition zuständig. Diese mittelalterliche Institution war vom Papst geschaffen worden, um alle Häretiker, die den christlichen Glauben anders auslegten, als es die katholische Kirche wünschte, zurück zu schlagen. Aufgabe der Kirchenmänner, die das Amt des Inquisitors ausübten, war es, die ketzerischen Sekten, also seit dem 15. Jahrhundert auch die Hexen, zu verfolgen und mittels eines Prozessverfahrens wegen ihrer Abtrünnigkeit von der katholischen Kirche unschädlich machen.
Diese Arbeit setzt sich speziell mit dem Beginn der Hexenverfolgung durch die Inquisition im 15. Jahrhundert auseinander. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die spätmittelalterlichen Hexenverfolgungen entstehen konnten. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf dem Einfluss der päpstlichen Inquisition bei der Umgestaltung des Hexereibegriffs und dem daraus resultierenden Umgang mit den vermeintlichen Hexen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Zeitliche und räumliche Eingrenzung
- Quellen- und Forschungsbericht
- Quellen
- Literatur
- Aufbau und Methode der Arbeit
- Die Hexen
- Antike und germanische Ursprünge der Hexereivorstellungen
- Der Wandel des Hexenbegriffs im Spätmittelalter durch den Einfluss der mittelalterlichen Kirche
- Die Verbindung zwischen Ketzern und Hexen
- Die Bulle Summis desiderantes affectibus
- Die Verbreitung des neuen Hexenglaubens
- Das Basler Konzil
- Die Übernahme der kirchlichen Hexereivorstellungen in der Bevölkerung
- Der Hexenhammer Malleus Maleficarum
- Der Autor Heinrich Kramer (Institoris)
- Der Lebenslauf Kramers
- Die Charakteristik des Inquisitors Kramer
- Das Verfasserproblem des Hexenhammers
- Der Entstehungskontext des Hexenhammers
- Der Aufbau des Werkes
- Aufbau und Inhalt des ersten Teils
- Aufbau und Inhalt des zweiten Teils
- Aufbau und Inhalt des dritten Teils
- Die Hexenlehre des Hexenhammers
- Das Teufelsbild
- Frauenfeindlichkeit im Hexenhammer
- Der Teufelspakt und die daraus resultierenden Fähigkeiten der Hexen
- Vermittlungen von Hexen
- Sexualdämonen
- Das Anrufen des Teufels
- Hexerei als Mischverbrechen
- Die unmittelbare Rezeption des Hexenhammers als Anleitung zur Hexenverfolgung
- Die Inquisitionspraxis bei der Verfolgung der Hexen
- Die beteiligten Organe der Inquisition
- Denunzianten und Verdächtige vor der Inquisition
- Die der Hexerei Verdächtigten
- Die Denunzianten
- Das Verhalten der Inquisition gegenüber Verdächtigen und Denunzianten
- Das Prozessverfahren
- Die Verhöre und der Einsatz der Folter
- Urteilsverkündung und Bestrafung
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit dem Beginn der Hexenverfolgung durch die Inquisition im 15. Jahrhundert. Sie untersucht, wie sich der Hexenbegriff im Spätmittelalter entwickelte und welche Rolle die päpstliche Inquisition dabei spielte. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Inquisition auf die Umgestaltung des Hexereibegriffs und die daraus resultierenden Praktiken im Umgang mit vermeintlichen Hexen.
- Die Entwicklung des Hexenbegriffs im Spätmittelalter
- Die Rolle der päpstlichen Inquisition bei der Verfolgung von Hexen
- Der Einfluss des Hexenhammers auf die Inquisitionspraxis
- Die Prozesse und Strafen im Zusammenhang mit Hexerei
- Die Verbreitung des Hexenglaubens in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung, die zeitliche und räumliche Eingrenzung sowie die Quellen und Methoden der Arbeit beleuchtet. In Kapitel 2 wird die Entstehung des Hexenbegriffs von der Antike bis zum Spätmittelalter nachgezeichnet, wobei insbesondere der Wandel des Hexenbegriffs durch den Einfluss der mittelalterlichen Kirche behandelt wird. Kapitel 3 befasst sich mit dem Hexenhammer, seinem Autor, seinem Entstehungskontext und seinem Einfluss auf die Inquisitionspraxis. In Kapitel 4 wird die Inquisitionspraxis bei der Verfolgung von Hexen beleuchtet, einschließlich der beteiligten Organe, der Denunzianten und Verdächtigen sowie des Prozessverfahrens.
Schlüsselwörter
Hexenverfolgung, Inquisition, Hexenhammer, Malleus Maleficarum, Spätmittelalter, Hexerei, Ketzerei, Teufelspakt, Prozessverfahren, Folter, Urteilsverkündung, Bestrafung.
- Quote paper
- Doreen Fricke (Author), 2004, Der Beginn der Hexenverfolgung durch die Inquisition im 15. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66897