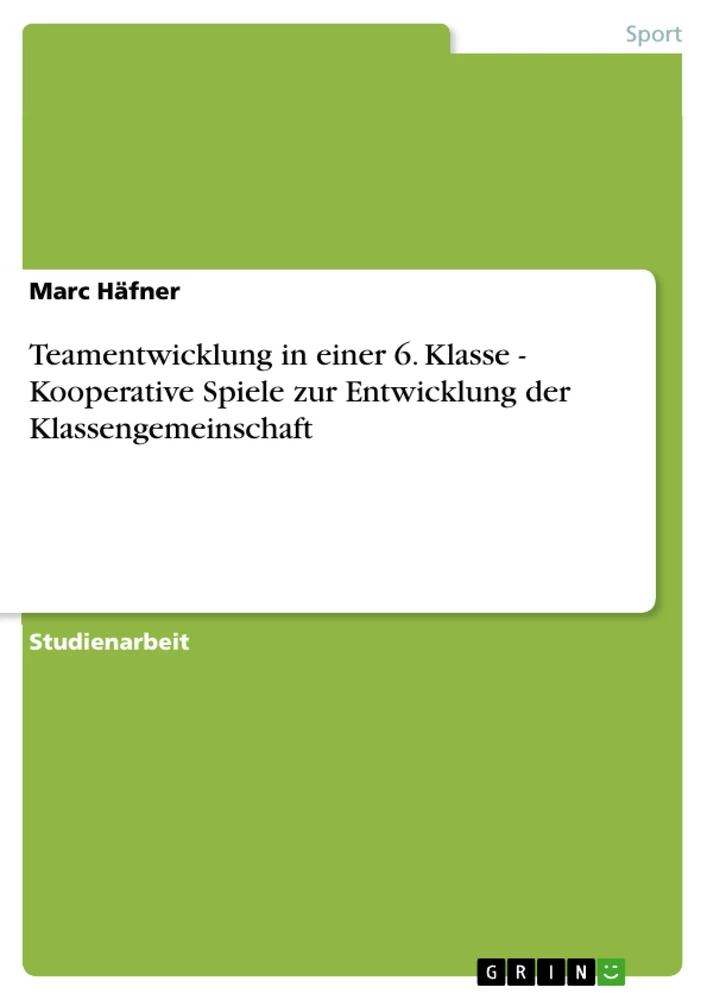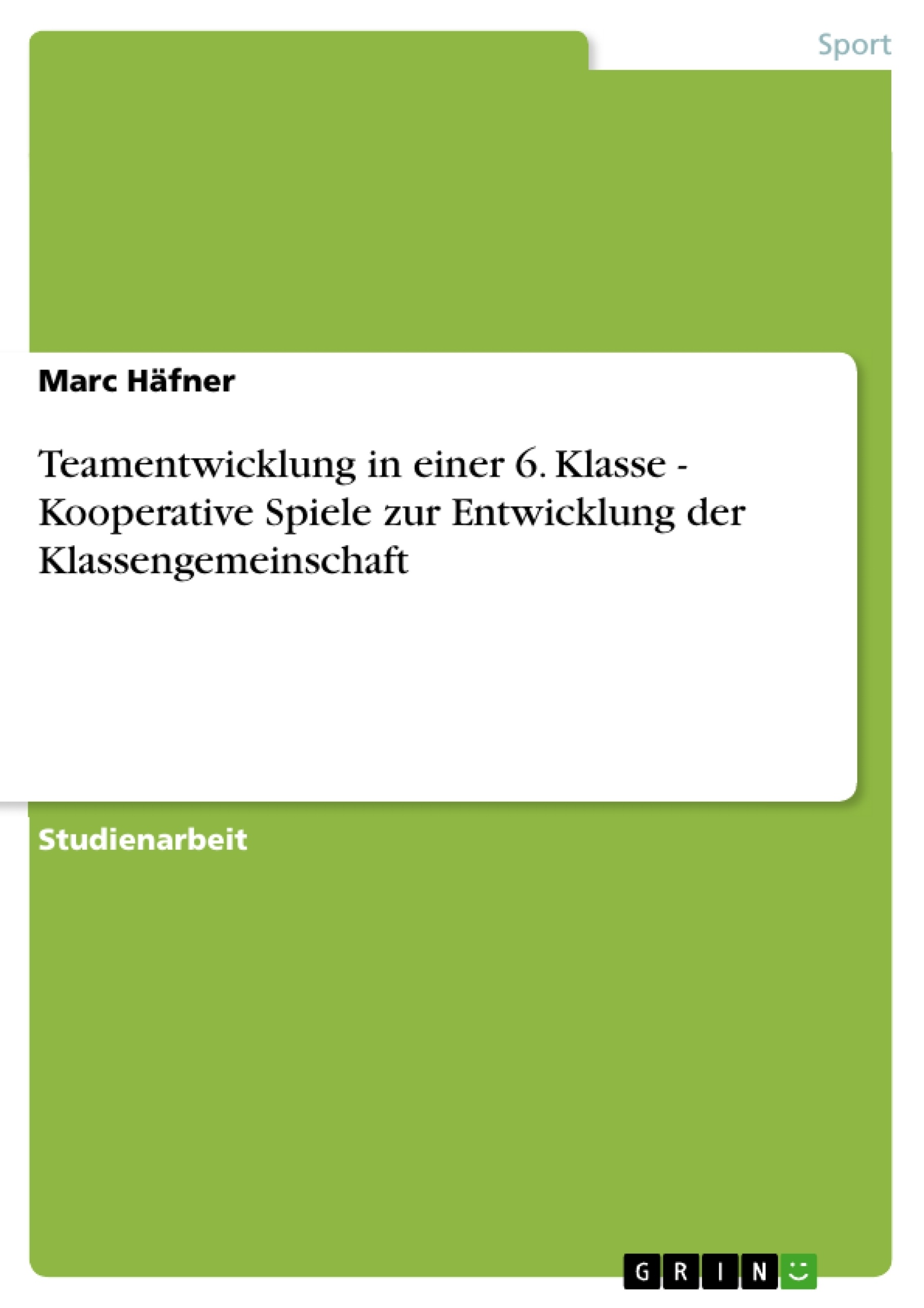Im Vergleich zu anderen Schulfächern wird mit dem Sportunterricht vielfach die Vorstellung verbunden, er sei ein für die Verfolgung sozialerzieherischer Lernziele prädestiniertes Fach. Die Interaktions- und Kommunikationsstrukturen des Sportunterrichts in Situationen des Miteinander und Gegeneinander, des Wettkampfes, der Gestaltung, des Spiels u.v.m. bieten gegenüber Formen des eher individuellen und primär auf die Vermittlung von Sachwissen ausgerichteten Lernens in anderen Schulfächern die Chance, die besonderen Möglichkeiten des Faches für die soziale Erziehung der SchülerInnen zu nutzen.
Dazu gilt es, über das motorische Können hinaus auch Fähigkeiten zur Kommunikation, Kooperation und Selbstorganisation zu entwickeln und zu fördern, um so die SchülerInnen zu Selbstbestimmtem, selbständigem und verantwortlichem Handeln zu befähigen. Diese erste Bildungsaufgabe beschreibt der Bildungsplan mit der persönlichen Bildung (vgl. Bildungsplan, S. 9 und 143).
Die Chance des sozialen Lernens im Sportunterricht ist jedoch nicht grundsätzlich positiv zu bewerten. Strukturen wie z.B. Stärkere - Schwächere, Könner - Außenseiter oder die (nicht) Gleichberechtigung der Geschlechter können gerade im Sportunterricht negativ verstärkt werden, d.h. der Sport bietet ein großes Selektionspotenzial.
Im nachfolgenden möchte ich den Aufbau der Unterrichtseinheit, nach dessen Struktur auch diese Arbeit aufgebaut ist, erläutern. In der Entscheidungsphase werden die Ausgangssituation (Ist-Zustand) der 6. Klassenstufe, der Grund der Auswahl des Themas Kooperative Spiele und die zu erreichenden Ziele formuliert. In der theoretischen Betrachtung erfolgt die Information über das Konzept und das Ziel der Kooperativen Spiele. Kommunikation und Wahrnehmung sowie die Erlebnis-, Spiel- und Gruppenpädagogik werden dabei vorgestellt. In der praktischen Umsetzung wird die Planung, die Struktur Kooperativer Spiele sowie die Lehrerrolle erläutert. In der Evaluationsphase wird auf mögliche Grenzen und Risiken verwiesen sowie ein erstes Fazit und Ausblick für den zukünftigen Unterricht gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Entscheidungsphase und Zielformulierung
- 3 Theoretische Betrachtung
- 3.1 Kommunikation und Wahrnehmung
- 3.2 Kooperative Spiele
- 3.3 Pädagogische Ansätze der Kooperativen Spiele
- 3.4 Erlebnispädagogik
- 3.5 Gruppenpädagogik
- 4 Praktische Umsetzung
- 4.1 Planung
- 4.2 Umsetzung
- 4.2.1 Kennenlernspiele
- 4.2.2 Warming-up-Spiele
- 4.2.3 Wahrnehmungsspiele
- 4.2.4 Vertrauensspiele
- 4.2.5 Kooperationsspiele
- 4.2.6 Reflexion
- 4.3 Lehrerrolle
- 5 Evaluation
- 5.1 Grenzen und Risiken
- 5.2 Fazit
- 5.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz kooperativer Spiele im Sportunterricht der 6. Klasse zur Verbesserung der Klassengemeinschaft und Förderung sozialer Kompetenzen. Ziel ist es, die vorhandenen Herausforderungen im Sozialverhalten der Schülerinnen (fehlender Zusammenhalt, Einzelkämpfertum) durch gezielte Spiele anzugehen und ein respektvolles und tolerantes Miteinander zu fördern.
- Förderung der Kooperation und Kommunikation
- Verbesserung des Klassenzusammenhalts und der Gemeinschaft
- Entwicklung von sozialer Kompetenz und Respekt
- Analyse der Herausforderungen im sozialen Miteinander einer Schulklasse
- Einsatz kooperativer Spiele als pädagogisches Instrument
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Sportunterricht ein geeignetes Fach zur Förderung sozialer Kompetenzen ist. Sie betont die Bedeutung von Kooperation, Kommunikation und Selbstorganisation und verweist auf den Bildungsplan. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Sportunterricht auch negative soziale Dynamiken verstärken kann, z.B. durch die Herausbildung von Stärkeren und Schwächeren. Die Arbeit wird im Kontext von Teamentwicklung in der Wirtschaft verortet, und es wird der Bezug zum Bildungsplan hergestellt, der die Bedeutung von Kooperationsfähigkeit und Kommunikation hervorhebt.
2 Entscheidungsphase und Zielformulierung: Dieses Kapitel beschreibt die Ausgangssituation in der 6. Klasse, die durch fehlenden Zusammenhalt und Einzelkämpfertum gekennzeichnet ist. Die Autorin beschreibt Beobachtungen aus der Hospitationsphase, die die Notwendigkeit des Einsatzes kooperativer Spiele verdeutlichen. Die Ziele der Unterrichtseinheit werden formuliert: Förderung eines respektvollen Umgangs, Verbesserung der Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sowie die Einbindung eines Gewaltpräventionsprojektes zur ganzheitlichen Förderung des sozialen Lernens.
3 Theoretische Betrachtung: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Grundlage der Arbeit. Es werden die Bedeutung von Kommunikation und Wahrnehmung im Kontext kooperativer Spiele erläutert, wobei der Fokus auf verbaler und nonverbaler Kommunikation und der Bedeutung von Missverständnissen liegt. Weitere pädagogische Ansätze wie Erlebnispädagogik und Gruppenpädagogik werden vorgestellt, die den Einsatz der kooperativen Spiele stützen.
Schlüsselwörter
Kooperative Spiele, Teamentwicklung, Klassengemeinschaft, Sozialkompetenz, Kommunikation, Wahrnehmung, Sportunterricht, Gewaltprävention, Erlebnispädagogik, Gruppenpädagogik, Schülerinnen, 6. Klasse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kooperative Spiele im Sportunterricht
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einsatz kooperativer Spiele im Sportunterricht der 6. Klasse, um die Klassengemeinschaft zu verbessern und soziale Kompetenzen zu fördern. Konkret geht es darum, Herausforderungen im Sozialverhalten wie fehlenden Zusammenhalt und Einzelkämpfertum durch gezielte Spiele anzugehen und ein respektvolles und tolerantes Miteinander zu fördern.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die folgenden Punkte zu erreichen: Förderung der Kooperation und Kommunikation, Verbesserung des Klassenzusammenhalts und der Gemeinschaft, Entwicklung sozialer Kompetenz und Respekt, Analyse der Herausforderungen im sozialen Miteinander einer Schulklasse und den Einsatz kooperativer Spiele als pädagogisches Instrument.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Entscheidungsphase und Zielformulierung, Theoretische Betrachtung (inkl. Kommunikation/Wahrnehmung, Kooperative Spiele, Pädagogische Ansätze, Erlebnispädagogik und Gruppenpädagogik), Praktische Umsetzung (inkl. Planung, Umsetzung verschiedener Spieltypen, Lehrerrolle) und Evaluation (inkl. Grenzen, Risiken, Fazit und Ausblick).
Wie wird die praktische Umsetzung der kooperativen Spiele beschrieben?
Das Kapitel zur praktischen Umsetzung beschreibt die Planungsphase, die Durchführung verschiedener Spieltypen (Kennenlernspiele, Warming-up-Spiele, Wahrnehmungsspiele, Vertrauensspiele, Kooperationsspiele) und die Rolle der Lehrkraft während des Unterrichts. Die Reflexion nach den Spielen wird ebenfalls behandelt.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die theoretische Betrachtung beleuchtet die Bedeutung von Kommunikation (verbal und nonverbal) und Wahrnehmung im Kontext kooperativer Spiele. Zusätzlich werden pädagogische Ansätze wie Erlebnispädagogik und Gruppenpädagogik vorgestellt, um den Einsatz der Spiele zu untermauern.
Welche Ausgangssituation wird in der Arbeit beschrieben?
Die Ausgangssituation in der 6. Klasse ist durch fehlenden Zusammenhalt und Einzelkämpfertum geprägt. Beobachtungen aus der Hospitationsphase zeigen die Notwendigkeit des Einsatzes kooperativer Spiele.
Wie wird die Evaluation der Arbeit durchgeführt?
Die Evaluation beinhaltet eine Betrachtung der Grenzen und Risiken des Einsatzes kooperativer Spiele, ein Fazit der gesamten Arbeit und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Möglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kooperative Spiele, Teamentwicklung, Klassengemeinschaft, Sozialkompetenz, Kommunikation, Wahrnehmung, Sportunterricht, Gewaltprävention, Erlebnispädagogik, Gruppenpädagogik, Schülerinnen, 6. Klasse.
Wie wird der Bezug zum Bildungsplan hergestellt?
Die Arbeit verortet sich im Kontext des Bildungsplans, der die Bedeutung von Kooperationsfähigkeit und Kommunikation hervorhebt. Die Einleitung betont den Sportunterricht als geeignetes Fach zur Förderung sozialer Kompetenzen und verweist explizit auf den Bildungsplan.
Welche Rolle spielt die Gewaltprävention?
Die Arbeit integriert ein Gewaltpräventionsprojekt in die Unterrichtseinheit, um die ganzheitliche Förderung des sozialen Lernens zu unterstützen.
- Arbeit zitieren
- Marc Häfner (Autor:in), 2007, Teamentwicklung in einer 6. Klasse - Kooperative Spiele zur Entwicklung der Klassengemeinschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66808