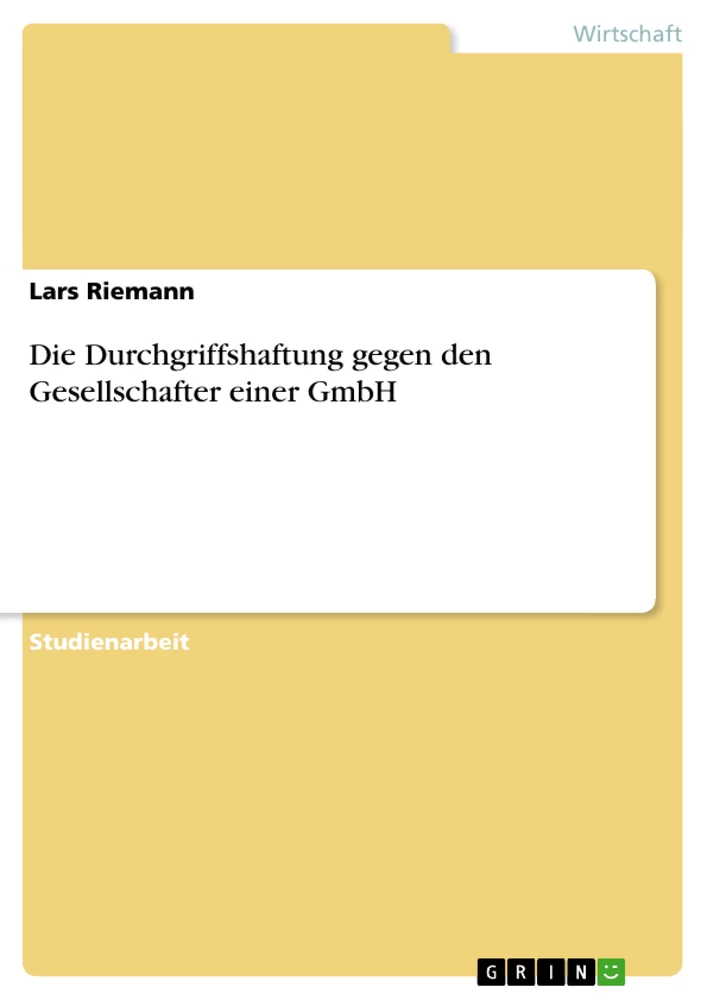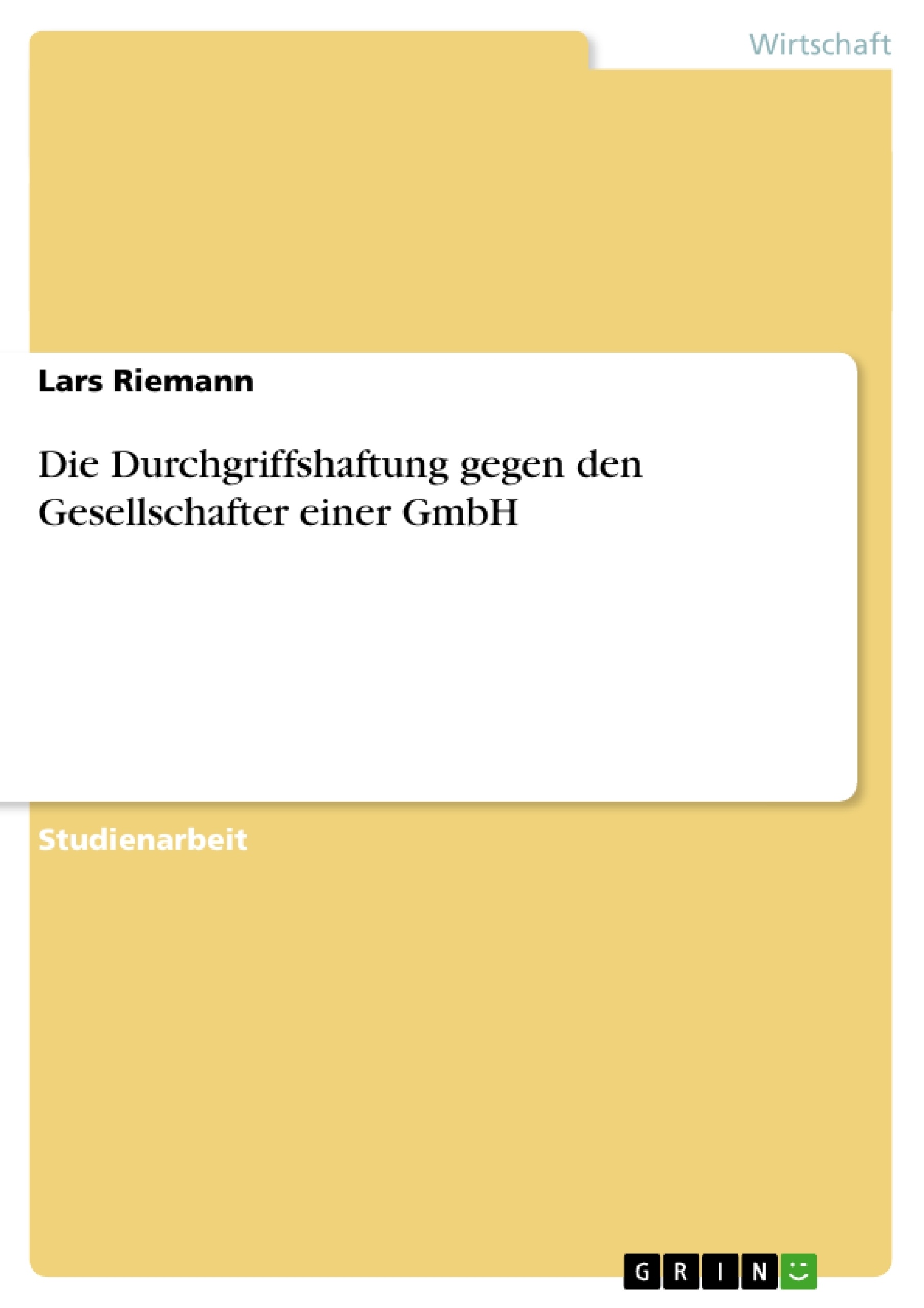In der jüngeren Vergangenheit hat die Rechtsprechung und lehrende Literatur das Institut der Gesellschafterhaftung innerhalb einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) über die gesetzlichen Grundlagen hinaus weiterentwickelt. Dies hat dazu geführt, daß der Begriff "mit beschränkter Haftung" inhaltlich neu definiert werden muß. Wann und unter welchen Voraussetzungen ein Haftungsdurchgriff auf das Privatvermögen eines Gesellschafters einer GmbH eintritt, soll in der vorliegenden Seminararbeit verdeutlicht werden.
Der Charakter einer GmbH
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Eine GmbH muß in Ihrer Form als Kapitalgesellschaft eindeutig von ihrem Korrelat - der Personengesellschaft - unterschieden werden. Bei einer Kapitalgesellschaft steht nicht wie bei einer Personengesellschaft die Person als Gesellschafter im Vordergrund, sondern ausnahmslos die kapitalmäßige Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen. Persönliche Ziele und Absichten der Gesellschafter stehen also hinter denen der Gesellschaft zurück.
Die Rechtspersönlichkeit einer GmbH fußt darin, gezielt das Zuordnungsobjekt von Rechtsnormen und damit Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Hinter dieser Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Rechtsordnung uneingeschränkt rechtsfähig ist, verbirgt sich hier also hinter einer GmbH eine juristische Person des privaten Rechts.
Die verliehene Rechtsfähigkeit ermächtigt die GmbH im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zu der gesamtheitlichen selbständigen Wahrnehmung ihrer Interessen, soweit diese Rechte und Pflichten nicht einzig natürlichen Personen vorbehalten sind. Die Rechte und Pflichten der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter wurden durch den Gesetzgeber durch das GmbH-Gesetz (GmbHG) vom 20. Mai 1898 reglementiert, welches in weiten Teilen bis zum heutigen Tage inhaltlich unverändert blieb.
Die personelle Form einer GmbH ist in eine Mehrpersonen- und eine Einmann-GmbH zu unterteilen. Eine Mehrpersonen-GmbH bildet die Regelform einer GmbH, da hier mindestens zwei Gesellschafter mit der Gesellschaftsführung beauftragt sind, während bei einer Einmann-GmbH juristische- und natürliche Person identisch sind. Diese Sonderform der Einmann-GmbH wirft unter manchen Aspekten besondere Problemstellungen auf, welche aber aus Platzgründen in dieser Ausarbeitung nicht gesondert abgehandelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Charakter einer GmbH
- Der Charakter einer GmbH
- Die Einordnung des GmbH-Gesetzes
- Der allgemeine Haftungsgrundsatz einer GmbH
- Das Trennungsprinzip
- Die Durchbrechung des Trennungsprinzips
- Die subjektive Mißbrauchslehre nach Serick
- Die institutionelle Mißbrauchslehre nach Reinhardt
- Die Normzwecklehre nach Müller-Freienfels
- Die Organschaftstheorie nach Wilhelm
- Die Haftung aus einem besonderem Verpflichtungsgrund
- Die Fallgruppen der Durchgriffshaftung
- Vermögensvermischung
- Sphärenvermischung
- Unterkapitalisierung
- Institutsmißbrauch
- Der umgekehrte Durchgriff
- Der gesellschafterfreundliche Durchgriff
- Reflexschäden
- Sonstige Durchgriffskonstellationen
- Die Rechtsfolgeseite der Haftung
- Die Durchgriffshaftung nach §§ 32a, b GmbHG
- Eigene Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Durchgriffshaftung gegen den Gesellschafter einer GmbH. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „mit beschränkter Haftung“ und klärt die Voraussetzungen für einen Haftungsdurchgriff auf das Privatvermögen eines Gesellschafters.
- Der Charakter der GmbH als Kapitalgesellschaft und ihre Abgrenzung zur Personengesellschaft
- Das Trennungsprinzip und seine Durchbrechung
- Die verschiedenen Theorien der Durchgriffshaftung (Mißbrauchslehren, Normzwecklehre, Organschaftstheorie)
- Die Fallgruppen der Durchgriffshaftung
- Die Rechtsfolgen der Durchgriffshaftung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Weiterentwicklung der Gesellschafterhaftung bei GmbHs über die gesetzlichen Grundlagen hinaus und beleuchtet unter welchen Voraussetzungen ein Haftungsdurchgriff auf das Privatvermögen eines Gesellschafters erfolgt.
Der Charakter einer GmbH: Dieses Kapitel beschreibt die GmbH als Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und hebt die Unterschiede zur Personengesellschaft hervor. Der Fokus liegt auf der kapitalmäßigen Beteiligung der Gesellschafter und der Trennung von persönlichen Zielen der Gesellschafter und den Zielen der Gesellschaft. Die Rechtspersönlichkeit der GmbH als juristische Person des privaten Rechts und ihre daraus resultierende Rechtsfähigkeit werden erläutert. Die Arbeit differenziert zwischen Mehrpersonen- und Einmann-GmbHs, wobei letztere nur kurz erwähnt werden.
Die Einordnung des GmbH-Gesetzes: Das Kapitel erläutert die Einordnung des GmbH-Gesetzes (GmbHG) als lex specialis für GmbHs und beschreibt die Relevanz des Handelsgesetzbuchs (HGB) für GmbHs als Handelsgesellschaften und Vollkaufleute. Die Bedeutung der allgemeinen Haftungsnormen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Kontext der Haftung von GmbHs und deren Gesellschaftern wird hervorgehoben, um den umfassenden rechtlichen Rahmen zu verdeutlichen.
Der allgemeine Haftungsgrundsatz einer GmbH: Dieses Kapitel behandelt den allgemeinen Haftungsgrundsatz der GmbH, das Trennungsprinzip zwischen Gesellschafter und Gesellschaft, und seine Durchbrechung durch verschiedene Theorien der Durchgriffshaftung (z.B. Mißbrauchslehren, Normzwecklehre, Organschaftstheorie). Es wird auf die verschiedenen Fallgruppen der Durchgriffshaftung (z.B. Vermögensvermischung, Sphärenvermischung, Unterkapitalisierung) eingegangen und die Rechtsfolgen dieser Haftung erläutert.
Die Durchgriffshaftung nach §§ 32a, b GmbHG: Dieses Kapitel befasst sich mit der Durchgriffshaftung im Kontext der spezifischen gesetzlichen Regelungen in §§ 32a und 32b GmbHG.
Schlüsselwörter
Durchgriffshaftung, GmbH, Gesellschafterhaftung, Trennungsprinzip, Mißbrauchslehre, Normzwecklehre, Organschaftstheorie, Vermögensvermischung, Sphärenvermischung, Unterkapitalisierung, §§ 32a, b GmbHG, Haftungsdurchgriff, Kapitalgesellschaft, Rechtspersönlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Durchgriffshaftung bei GmbHs
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Durchgriffshaftung gegen den Gesellschafter einer GmbH. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „mit beschränkter Haftung“ und klärt die Voraussetzungen für einen Haftungsdurchgriff auf das Privatvermögen eines Gesellschafters. Die Arbeit analysiert das Trennungsprinzip, dessen Durchbrechung und die verschiedenen Theorien der Durchgriffshaftung (Mißbrauchslehren, Normzwecklehre, Organschaftstheorie) sowie die relevanten Fallgruppen (Vermögensvermischung, Sphärenvermischung, Unterkapitalisierung etc.).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Charakter der GmbH als Kapitalgesellschaft, das Trennungsprinzip und dessen Durchbrechung, verschiedene Theorien der Durchgriffshaftung, die Fallgruppen der Durchgriffshaftung (z.B. Vermögensvermischung, Sphärenvermischung, Unterkapitalisierung, Institutsmißbrauch, umgekehrter Durchgriff, gesellschafterfreundlicher Durchgriff, Reflexschäden), die Rechtsfolgen der Durchgriffshaftung und die Durchgriffshaftung nach §§ 32a, b GmbHG.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Charakter der GmbH (inkl. Einordnung des GmbH-Gesetzes), zum allgemeinen Haftungsgrundsatz (inkl. Trennungsprinzip und dessen Durchbrechung), ein Kapitel zur Durchgriffshaftung nach §§ 32a, b GmbHG und eine eigene Beurteilung. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
Welche Theorien der Durchgriffshaftung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien der Durchgriffshaftung, darunter die subjektive und institutionelle Mißbrauchslehre (Serick, Reinhardt), die Normzwecklehre (Müller-Freienfels) und die Organschaftstheorie (Wilhelm).
Welche Fallgruppen der Durchgriffshaftung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Vielzahl von Fallgruppen der Durchgriffshaftung, darunter Vermögensvermischung, Sphärenvermischung, Unterkapitalisierung, Institutsmißbrauch, der umgekehrte Durchgriff, der gesellschafterfreundliche Durchgriff, Reflexschäden und sonstige Durchgriffskonstellationen.
Welche Rolle spielt das Trennungsprinzip?
Das Trennungsprinzip, welches die Trennung von Gesellschafts- und Privatvermögen beschreibt, bildet den zentralen Ausgangspunkt der Arbeit. Die Arbeit untersucht, unter welchen Voraussetzungen dieses Prinzip durchbrochen wird und eine Durchgriffshaftung gerechtfertigt ist.
Welche gesetzlichen Regelungen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet neben allgemeinen haftungsrechtlichen Bestimmungen insbesondere die Regelungen der §§ 32a und 32b GmbHG zur Durchgriffshaftung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Durchgriffshaftung, GmbH, Gesellschafterhaftung, Trennungsprinzip, Mißbrauchslehre, Normzwecklehre, Organschaftstheorie, Vermögensvermischung, Sphärenvermischung, Unterkapitalisierung, §§ 32a, b GmbHG, Haftungsdurchgriff, Kapitalgesellschaft, Rechtspersönlichkeit.
- Quote paper
- Lars Riemann (Author), 1999, Die Durchgriffshaftung gegen den Gesellschafter einer GmbH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6645