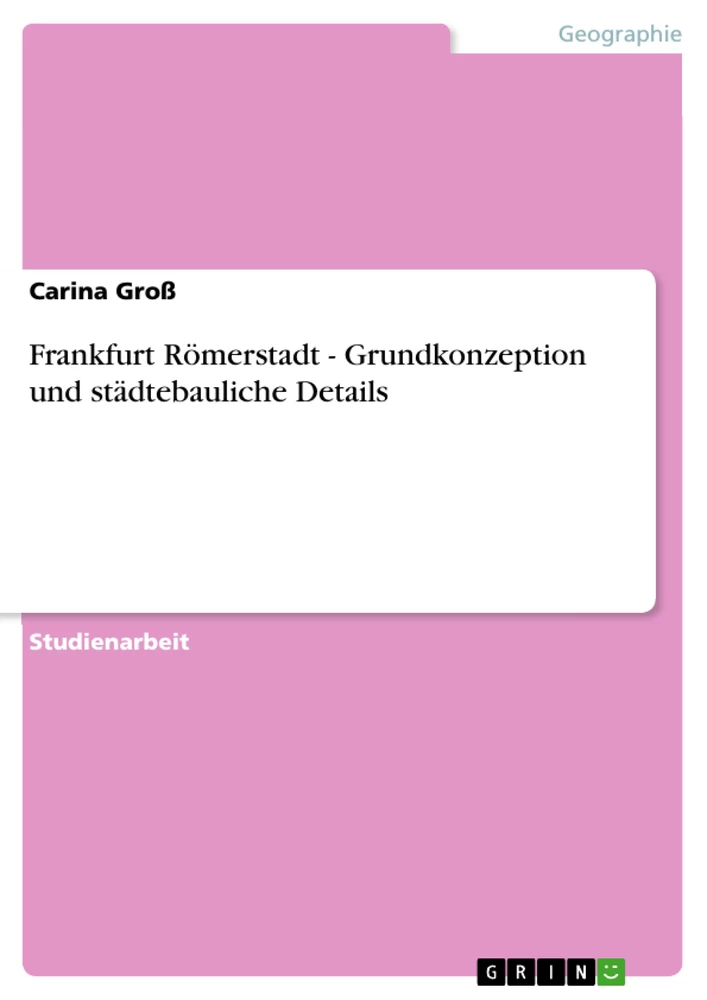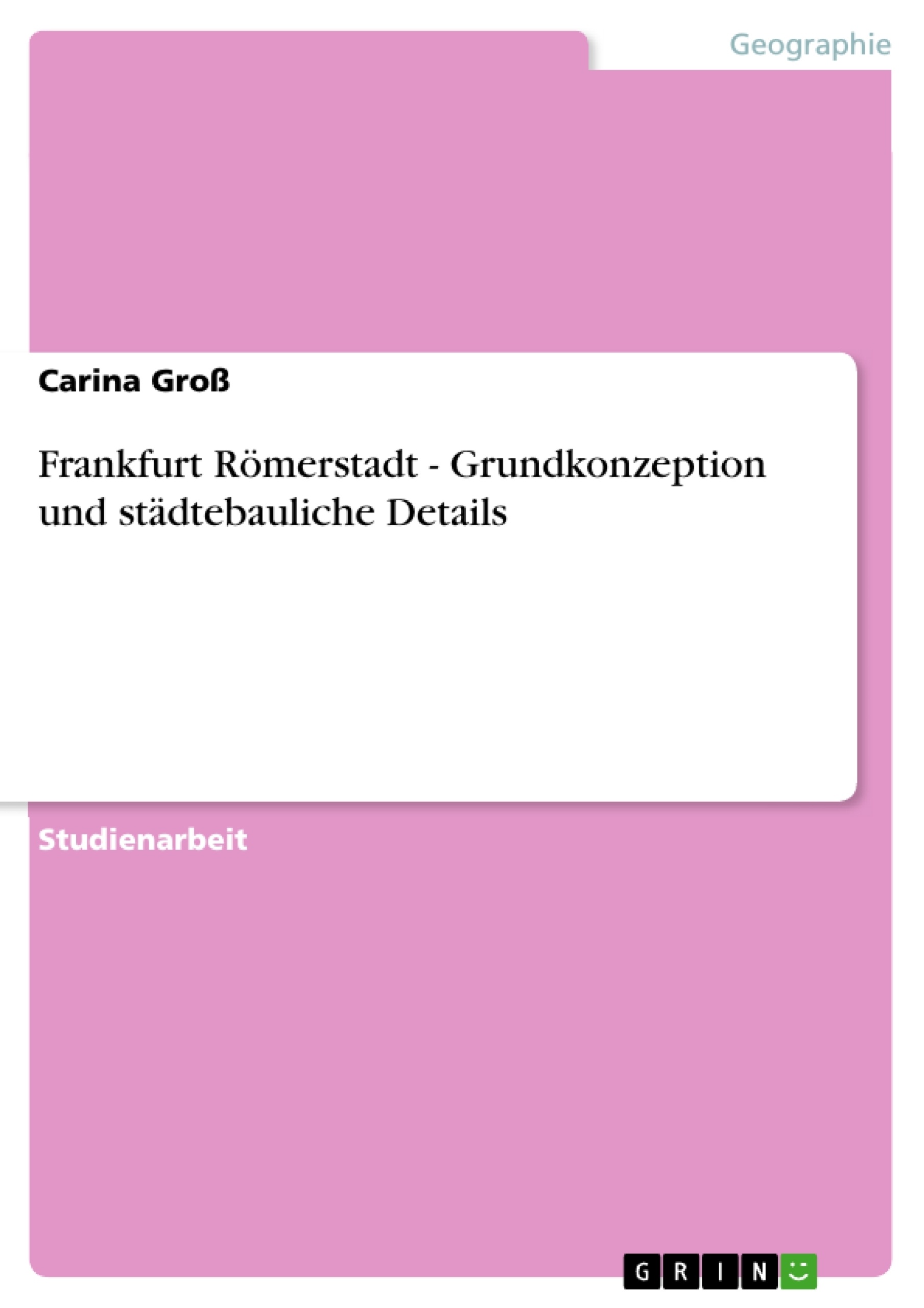Die Römerstadt in Frankfurt am Main stellt eines der Siedlungsprojekte des so genannten "Neuen Frankfurt" dar. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in ganz Deutschland erheblicher Wohnungsmangel, vor allem in den Großstädten. Um diesen Missstand zu beseitigen musste möglichst schnell und kostengünstig Wohnraum geschaffen werden. In Frankfurt nahm man sich mit dem Projekt "Das Neue Frankfurt" nicht nur dem Problem des Wohnungsmangels an, man setzte durch modernes Bauen auch neue gestalterische Maßstäbe. Unter Gesichtspunkten der Funktionalität und Rationalität entstanden groß angelegte Siedlungen rund um die Stadt, so auch die Römerstadt. Im Folgenden soll es nun um die Entstehung und Gestaltung der Römerstadt gehen und was aus ihr geworden ist. Zunächst soll der historische Kontext kurz erläutert werden; einerseits unter den gesellschaftspolitischen Aspekten in der eher instabilen Zeit der Weimarer Republik, andererseits auch direkte wohnungspolitische Hintergründe, sowie Grundlegendes zur Konzeption des Neuen Frankfurt. Im Weiteren folgt eine Beschreibung der Römerstadt: Grundkonzeption, architek-tonische Besonderheiten und städtebauliche Details. Da aber Planung und Verwirklichung nie ganz Hand in Hand gehen, sollen Ziele und letztendliche Umsetzung gegenübergestellt werden. Abschließend soll noch ein Blick auf die Entwicklung der Siedlung bis zur heutigen Zeit geworfen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Gesellschaftspolitischer Hintergrund
- Wohnungspolitik der Weimarer Republik
- Das Neue Frankfurt
- Die Siedlung Römerstadt
- Grundlagen der Planung und Gestaltung
- Grundidee vs. Realität
- Die Römerstadt heute
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Gestaltung der Römerstadt in Frankfurt am Main im Kontext des „Neuen Frankfurt“. Ziel ist es, die Siedlung in ihrem historischen, städtebaulichen und gesellschaftlichen Umfeld zu verorten und die Diskrepanz zwischen Planung und Realisierung zu beleuchten.
- Der historische Kontext der Römerstadt im Rahmen der Weimarer Republik
- Die städtebaulichen Konzepte des „Neuen Frankfurt“ und ihre Umsetzung in der Römerstadt
- Die architektonischen Besonderheiten und Details der Römerstadt
- Der Vergleich zwischen Planungsgrundlagen und der tatsächlichen Realisierung der Siedlung
- Die Entwicklung der Römerstadt bis zur Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Römerstadt als ein Projekt des „Neuen Frankfurt“ vor und beschreibt den Kontext des Wohnungsmangels nach dem Ersten Weltkrieg. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der den historischen Kontext, die Konzeption der Römerstadt, den Vergleich von Planung und Umsetzung sowie die heutige Situation der Siedlung umfasst.
2. Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen und wohnungspolitischen Hintergrund der Römerstadt. Der gesellschaftliche Kontext wird durch die Unruhen und die wirtschaftlichen Probleme der Weimarer Republik, wie Reparationsforderungen, Inflation und Wohnungsnot, geprägt. Der wohnungspolitische Aspekt beschreibt die staatliche Förderung des Wohnungsbaus durch Baukostenzuschüsse und die Bemühungen um Kostensenkung und Rationalisierung. Die Entstehung von Versuchsbauten im Stil des „Neuen Bauens“ wird ebenfalls erwähnt, die jedoch durch den Auslaufen des Etats und die Wirtschaftskrise beendet wurden.
3. Das Neue Frankfurt: Dieses Kapitel beschreibt das städtebauliche Programm „Neues Frankfurt“ unter Oberbürgermeister Landmann und die Rolle Ernst Mays als Dezernent für das Hochbauwesen. Mays Ziel war eine Auflockerung der Stadt durch die Schaffung von Trabantenstädten, Naturbezug und Nachbarschaftsbildung. Finanziert wurde das Programm hauptsächlich durch die Hauszinssteuer, Darlehen und Eigenkapital. Trotz des anfänglichen Erfolgs und der Übererfüllung des Programms führte die Wirtschaftskrise zu einer drastischen Reduzierung der Bautätigkeit. Das Kapitel betont die verschiedenen Siedlungen des „Niddatal-Projekts“, darunter die Römerstadt, Praunheim und Westhausen, und deren stilistische Unterschiede, die trotz gemeinsamer Gestaltungselemente des „Neuen Bauens“ bestehen.
4. Die Siedlung Römerstadt: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Römerstadt selbst, detaillierend die Planungsgrundlagen und die Gestaltung der Siedlung. Es werden die architektonischen Besonderheiten und städtebaulichen Details beschrieben, aber auch der Vergleich zwischen der ursprünglichen Planung und der tatsächlichen Umsetzung durchgeführt. Der Fokus liegt auf den Unterschieden zwischen der ursprünglichen Idee einer Gartenstadt und der Realität der Umsetzung, und wie sich diese auf die Siedlung ausgewirkt haben. Abschließend wird ein Ausblick auf die heutige Situation der Römerstadt gegeben.
Schlüsselwörter
Römerstadt, Neues Frankfurt, Weimarer Republik, Wohnungspolitik, Städtebau, Ernst May, Gartenstadt, Rationalisierung, Neues Bauen, Architektur, Sozialpolitik, Wohnungsnot.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Römerstadt im Neuen Frankfurt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Gestaltung der Römerstadt in Frankfurt am Main im Kontext des „Neuen Frankfurt“. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen Planung und Realisierung der Siedlung und verortet sie in ihrem historischen, städtebaulichen und gesellschaftlichen Umfeld.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Kontext der Römerstadt im Rahmen der Weimarer Republik, die städtebaulichen Konzepte des „Neuen Frankfurt“ und ihre Umsetzung in der Römerstadt, die architektonischen Besonderheiten, den Vergleich zwischen Planung und Realisierung sowie die Entwicklung der Römerstadt bis zur Gegenwart.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Kontext (inkl. Gesellschafts- und Wohnungspolitik der Weimarer Republik), ein Kapitel zum Neuen Frankfurt, ein Kapitel zur Römerstadt selbst (Planung, Gestaltung, Realität vs. Ideal, heutige Situation) und eine Zusammenfassung.
Was ist der historische Kontext der Römerstadt?
Der historische Kontext wird durch die Unruhen und wirtschaftlichen Probleme der Weimarer Republik (Reparationen, Inflation, Wohnungsnot) geprägt. Die Wohnungspolitik der Zeit umfasste staatliche Förderungen des Wohnungsbaus und Bemühungen um Kostensenkung und Rationalisierung. Die Entstehung von Versuchsbauten im Stil des „Neuen Bauens“ wurde durch den Auslaufen des Etats und die Wirtschaftskrise beendet.
Was war das „Neue Frankfurt“?
Das „Neue Frankfurt“ war ein städtebauliches Programm unter Oberbürgermeister Landmann mit Ernst May als Dezernenten für das Hochbauwesen. Ziel war die Auflockerung der Stadt durch Trabantenstädten, Naturbezug und Nachbarschaftsbildung. Finanziert wurde es durch Hauszinssteuer, Darlehen und Eigenkapital. Die Wirtschaftskrise führte zu einer drastischen Reduzierung der Bautätigkeit.
Wie wurde die Römerstadt geplant und gestaltet?
Das Kapitel zur Römerstadt beschreibt detailliert die Planungsgrundlagen und die Gestaltung der Siedlung, einschließlich architektonischer Besonderheiten und städtebaulicher Details. Es vergleicht die ursprüngliche Planung (Gartenstadt-Ideal) mit der tatsächlichen Umsetzung und beleuchtet die Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Siedlung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römerstadt, Neues Frankfurt, Weimarer Republik, Wohnungspolitik, Städtebau, Ernst May, Gartenstadt, Rationalisierung, Neues Bauen, Architektur, Sozialpolitik, Wohnungsnot.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Römerstadt in ihrem historischen, städtebaulichen und gesellschaftlichen Umfeld zu verorten und die Diskrepanz zwischen Planung und Realisierung zu beleuchten.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Römerstadt vorstellt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Es folgen Kapitel zum historischen Kontext, dem Neuen Frankfurt und der Römerstadt selbst, bevor sie mit einer Zusammenfassung abschließt.
- Quote paper
- Carina Groß (Author), 2005, Frankfurt Römerstadt - Grundkonzeption und städtebauliche Details, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66360