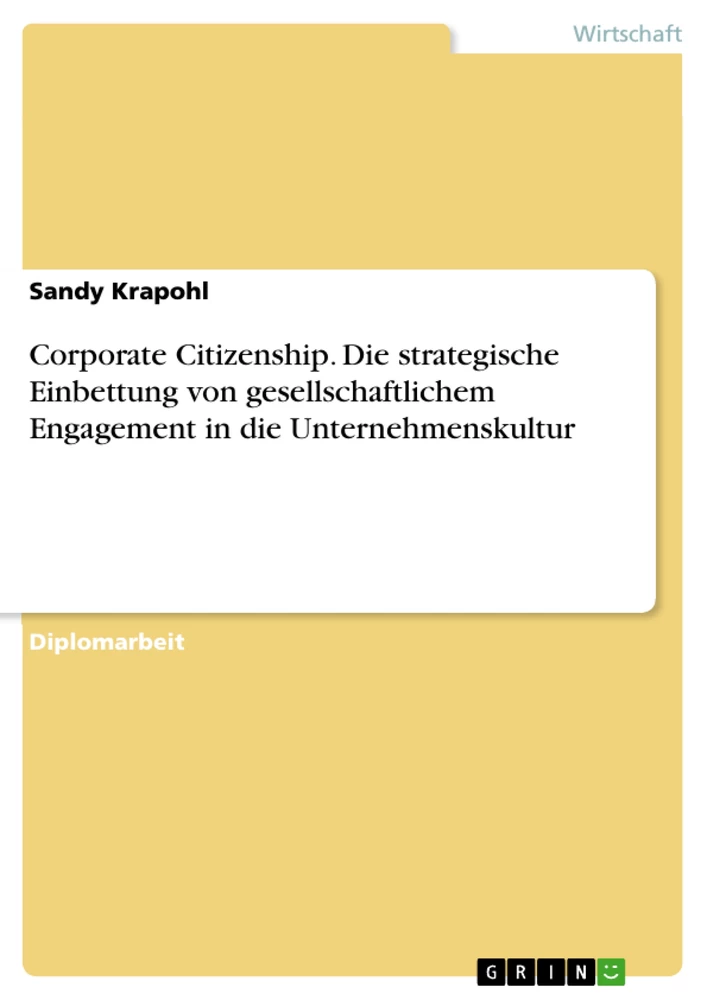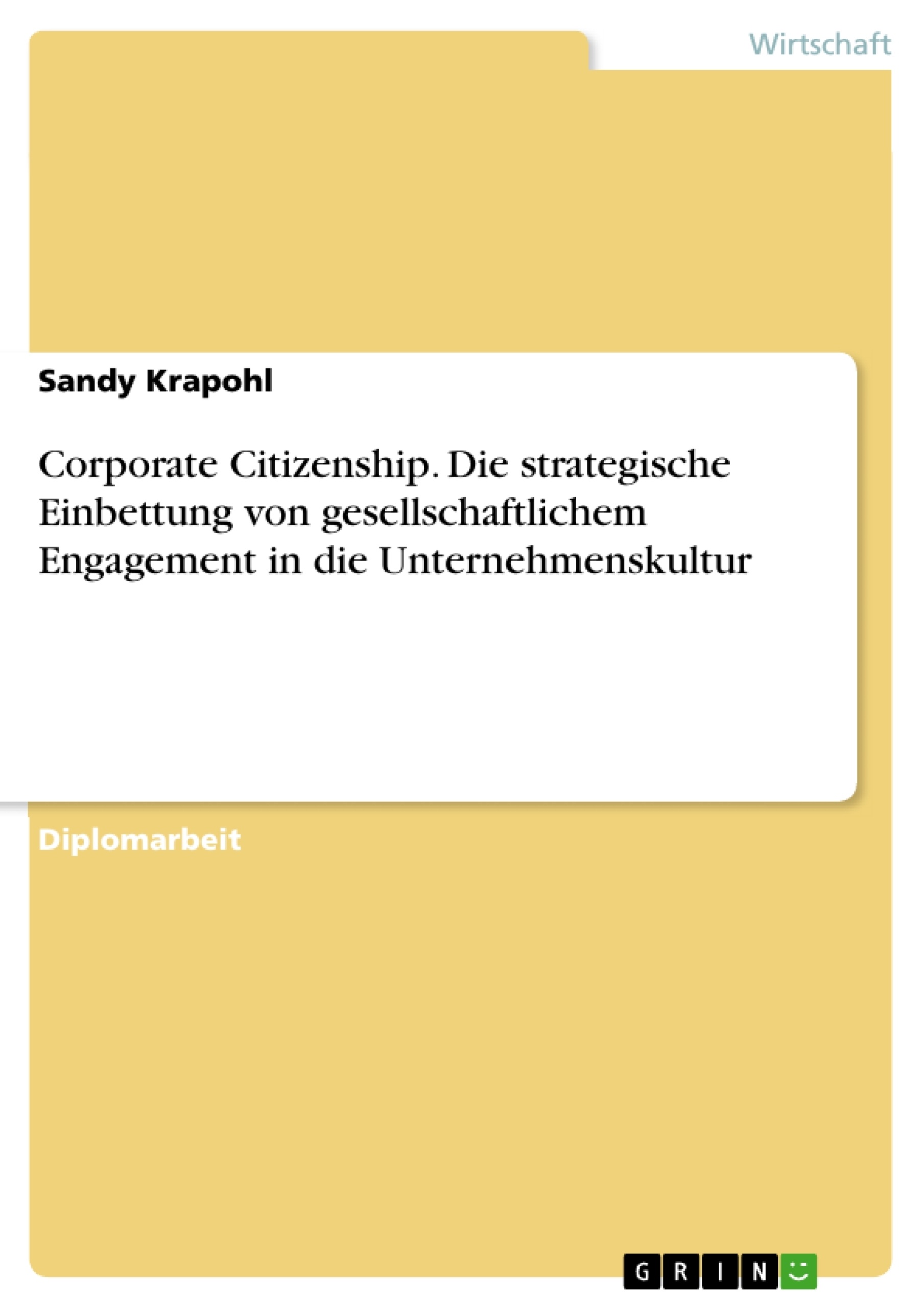Das Spenden, Sponsern und Stiften für die Bereiche Kultur, Sport oder Soziales ist bei Unternehmen weit verbreitet. In den letzten Jahren hat jedoch ein neues Verständnis gesellschaftlichen Engagements und sozialer Verantwortung von Unternehmen in der öffentlichen Diskussion an Bedeutung gewonnen, welches durch die sich verändernde Rollenverteilung zwischen Staat, Unternehmen und Gesellschaft hervorgerufen wurde. Auslöser für diese Veränderung sind sowohl die leeren öffentlichen Kassen als auch die wachsenden Herausforderungen der Globalisierung.
Das Konzept des Corporate Citizenship stammt aus den USA und basiert auf der Leitidee für die Übernahme sozialer Verantwortung – The Art of Giving Back to the Community. Im Rahmen von Corporate Citizenship wird Unternehmen die konzeptionelle Mitwirkung an dauerhaft angelegten und strategisch ausgerichteten Lösungen gesellschaftlicher Probleme zugewiesen. Der Staat leistet seinen Beitrag, indem er Gelegenheitsstrukturen für unternehmerisches bürgerschaftliches Engagement durch die Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen schafft und zwischen den an einer Zusammenarbeit interessierten Partnern vermittelt.
Der Begriff Corporate Citizenship bezeichnet demnach einen Wandel im Verständnis von unternehmerischem Engagement, das über gelegentliche Spenden hinausgeht und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung als Teil der Unternehmensstrategie plant und langfristig anlegt. Immer mehr Unternehmen nutzen immer systematischer das Potential, welches eine Kooperation mit Projekten gemeinnütziger Einrichtungen aus den verschiedensten Bereichen bereithält.
Ausgehend von der Bestimmung des Begriffes Corporate Citizenship und der Abgrenzung zu Corporate Social Responsibility wird eine Auswahl an Initiativen vorgestellt, die die Verbreitung von Corporate Citizenship in Deutschland unterstützen und fördern. Im Anschluss werden die vielfältigen Erscheinungsformen gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen anhand von Fallbeispielen näher erläutert. Das gesellschaftliche Engagement sollte konsequent in die Unternehmenskultur und -strategie implementiert und regelmäßig gegenüber allen Zielgruppen kommuniziert werden. Dadurch kann das Unternehmen die Glaubhaftigkeit seines Engagements stärken. Diese Partnerschaften zwischen den Sektoren bringen nicht nur den Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen einen Nutzen. Die beteiligten Mitarbeiter und nicht zuletzt die Gemeinschaft selbst profitieren davon.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Entwicklung des gesellschaftlichen Engagements der Wirtschaft
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Grundlagen und Begriffe
- 2.1 Corporate Citizenship
- 2.1.1 Begriffsverständnis
- 2.1.2 Wesentliche Merkmale des Corporate Citizenship
- 2.2 Abgrenzung zu Corporate Social Responsibility
- 2.3 Formen, Bereiche und Träger von Corporate Citizenship-Aktivitäten
- 3 Initiativen zur Festigung und Verbreitung von Corporate Citizenship
- 3.1 Gegenwärtige Situation in Deutschland
- 3.2 Initiative Freiheit und Verantwortung
- 3.3 Unternehmen: Partner der Jugend e. V.
- 3.4 Initiative "Engagiertes Unternehmen"
- 4 Erscheinungsformen gesellschaftlichen Engagements
- 4.1 Überblick
- 4.2 Corporate Giving
- 4.2.1 Charakteristika
- 4.2.2 Unternehmensspenden
- 4.2.3 Sponsoring
- 4.2.4 Stiftungswesen
- 4.3 Corporate Volunteering
- 4.3.1 Vielfältige Ausgestaltungsmöglichkeiten
- 4.3.2 Unternehmen unterstützen und fördern privates Engagement ihrer Mitarbeiter
- 4.3.2.1 Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland
- 4.3.2.2 Förderungsmöglichkeiten
- 4.3.3 Mitarbeiter-Engagement im Rahmen von Unternehmensprogrammen
- 4.3.3.1 Regelmäßige Projekttage
- 4.3.3.2 Mentorenprojekte
- 4.3.3.3 Secondment-Programme
- 4.3.3.4 Pro bono-Projekte
- 4.3.4 Einsatz in gemeinnützigen Projekten als Instrument der Personalentwicklung
- 4.3.5 Beispiele aus der Praxis
- 4.3.5.1 Henkel KGaA: Förderung des Engagements der Mitarbeiter
- 4.3.5.2 betapharm GmbH: bereichsübergreifende Kooperation
- 4.3.5.3 Stadt Köln: Corporate Volunteering ist Chefsache
- 5 Strategische Verankerung von Corporate Citizenship in der Unternehmenskultur und Stakeholder-Kommunikation
- 5.1 Notwendigkeit der strategischen Einbettung gesellschaftlichen Engagements
- 5.2 Corporate Citizenship und Corporate Identity
- 5.3 Corporate Citizenship-Strategie
- 5.4 Leitlinien für ein erfolgreiches Corporate Citizenship
- 5.5 Stakeholder-Dialog
- 5.5.1 Konsequente Kommunikation mit den Zielgruppen
- 5.5.2 Interne Kommunikation
- 5.5.3 Externe Kommunikation
- 6 Potentiale des Corporate Citizenship
- 6.1 Nutzen für die Unternehmen
- 6.1.1 Bedeutung für die Personalwirtschaft
- 6.1.2 Bedeutung für die Kommunikationspolitik
- 6.1.3 Absatzpolitische Bedeutung
- 6.2 Nutzen für die Unternehmensmitarbeiter
- 6.3 Nutzen für die gemeinnützigen Einrichtungen und ihre Mitarbeiter
- 6.4 Nutzen für die Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Corporate Citizenship (CC), dessen Erscheinungsformen, Nutzen und die Notwendigkeit der strategischen Integration in die Unternehmenskultur. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von CC zu entwickeln und dessen Bedeutung für Unternehmen, Mitarbeiter und die Gesellschaft aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung von Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility
- Analyse verschiedener Erscheinungsformen gesellschaftlichen Engagements (Corporate Giving, Corporate Volunteering)
- Strategische Einbettung von CC in die Unternehmenskultur und Stakeholder-Kommunikation
- Potentiale und Nutzen von CC für Unternehmen, Mitarbeiter und die Gesellschaft
- Best-Practice-Beispiele aus der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema Corporate Citizenship ein und beschreibt die Entwicklung des gesellschaftlichen Engagements der Wirtschaft. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und legt die Forschungsfrage fest.
2 Grundlagen und Begriffe: Dieses Kapitel definiert Corporate Citizenship und grenzt es von Corporate Social Responsibility ab. Es werden verschiedene Formen, Bereiche und Träger von CC-Aktivitäten erläutert und ein fundiertes begriffliches Verständnis geschaffen, das als Grundlage für die weiteren Kapitel dient. Die wesentlichen Merkmale von CC werden detailliert beschrieben und analysiert.
3 Initiativen zur Festigung und Verbreitung von Corporate Citizenship: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Initiativen in Deutschland, die die Verbreitung und Festigung von CC fördern. Es analysiert die aktuelle Situation in Deutschland und stellt verschiedene Initiativen wie die Initiative Freiheit und Verantwortung, Unternehmen: Partner der Jugend e.V. und die Initiative "Engagiertes Unternehmen" vor. Der Fokus liegt auf den Zielen, Strategien und der Wirksamkeit dieser Initiativen.
4 Erscheinungsformen gesellschaftlichen Engagements: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Erscheinungsformen von gesellschaftlichem Engagement, insbesondere Corporate Giving (Unternehmensspenden, Sponsoring, Stiftungswesen) und Corporate Volunteering. Es beschreibt die Charakteristika der einzelnen Formen, die Möglichkeiten der Mitarbeiterförderung im Bereich des Corporate Volunteering und liefert praxisnahe Beispiele von Unternehmen, die diese Formen des Engagements erfolgreich umsetzen.
5 Strategische Verankerung von Corporate Citizenship in der Unternehmenskultur und Stakeholder-Kommunikation: Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit und den Möglichkeiten der strategischen Verankerung von CC in der Unternehmenskultur. Es untersucht den Zusammenhang zwischen CC und Corporate Identity, beschreibt die Entwicklung einer CC-Strategie, formuliert Leitlinien für erfolgreiches CC und analysiert die Bedeutung des Stakeholder-Dialogs für die erfolgreiche Umsetzung von CC-Maßnahmen.
6 Potentiale des Corporate Citizenship: In diesem Kapitel werden die Potentiale und der Nutzen von CC für Unternehmen, Mitarbeiter, gemeinnützige Einrichtungen und die Gesellschaft umfassend dargestellt. Es werden die positiven Auswirkungen auf die Personalwirtschaft, die Kommunikationspolitik, die Absatzpolitik sowie auf die soziale und ökologische Verantwortung beleuchtet. Die jeweiligen Vorteile und Synergien werden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility, gesellschaftliches Engagement, Unternehmenskultur, Stakeholder-Kommunikation, Corporate Giving, Corporate Volunteering, Nachhaltigkeit, Personalentwicklung, Strategie, Unternehmenszweck, gemeinnützige Organisationen, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Corporate Citizenship
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Corporate Citizenship (CC). Sie untersucht die Definition und Abgrenzung von CC zu Corporate Social Responsibility (CSR), analysiert verschiedene Erscheinungsformen des gesellschaftlichen Engagements (Corporate Giving und Corporate Volunteering), beleuchtet die strategische Einbettung von CC in die Unternehmenskultur und Stakeholder-Kommunikation und schließlich die Potentiale und den Nutzen von CC für Unternehmen, Mitarbeiter und die Gesellschaft. Best-Practice-Beispiele aus der Praxis ergänzen die theoretischen Ausführungen.
Was wird unter Corporate Citizenship (CC) verstanden?
Die Arbeit definiert Corporate Citizenship und grenzt es von Corporate Social Responsibility (CSR) ab. Es wird ein detailliertes Verständnis der wesentlichen Merkmale von CC entwickelt und verschiedene Formen, Bereiche und Träger von CC-Aktivitäten erläutert.
Welche Erscheinungsformen gesellschaftlichen Engagements werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Erscheinungsformen des gesellschaftlichen Engagements, insbesondere Corporate Giving (Unternehmensspenden, Sponsoring, Stiftungswesen) und Corporate Volunteering. Im Detail werden die Charakteristika der einzelnen Formen, Möglichkeiten der Mitarbeiterförderung im Bereich Corporate Volunteering und praxisnahe Beispiele erfolgreicher Unternehmen vorgestellt.
Wie kann Corporate Citizenship strategisch in die Unternehmenskultur integriert werden?
Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit und Möglichkeiten der strategischen Verankerung von CC in der Unternehmenskultur. Der Zusammenhang zwischen CC und Corporate Identity wird beleuchtet, die Entwicklung einer CC-Strategie beschrieben und Leitlinien für erfolgreiches CC formuliert. Die Bedeutung des Stakeholder-Dialogs für die erfolgreiche Umsetzung von CC-Maßnahmen wird ebenfalls analysiert.
Welchen Nutzen hat Corporate Citizenship für Unternehmen, Mitarbeiter und die Gesellschaft?
Die Arbeit beschreibt umfassend die Potentiale und den Nutzen von CC für Unternehmen (Personalwirtschaft, Kommunikationspolitik, Absatzpolitik), Mitarbeiter, gemeinnützige Einrichtungen und die Gesellschaft. Die positiven Auswirkungen auf soziale und ökologische Verantwortung sowie die jeweiligen Vorteile und Synergien werden detailliert dargestellt.
Welche Initiativen zur Förderung von Corporate Citizenship werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Initiativen in Deutschland vor, die die Verbreitung und Festigung von CC fördern. Es werden die aktuelle Situation in Deutschland und Initiativen wie die „Initiative Freiheit und Verantwortung“, „Unternehmen: Partner der Jugend e.V.“ und die „Initiative Engagiertes Unternehmen“ analysiert. Der Fokus liegt auf Zielen, Strategien und Wirksamkeit dieser Initiativen.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit enthält praxisnahe Beispiele von Unternehmen, die verschiedene Formen des gesellschaftlichen Engagements erfolgreich umsetzen, z.B. Henkel KGaA, betapharm GmbH und die Stadt Köln. Diese Beispiele illustrieren die verschiedenen Aspekte von Corporate Volunteering und deren Umsetzung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility, gesellschaftliches Engagement, Unternehmenskultur, Stakeholder-Kommunikation, Corporate Giving, Corporate Volunteering, Nachhaltigkeit, Personalentwicklung, Strategie, Unternehmenszweck, gemeinnützige Organisationen, Integration.
- Quote paper
- Diplom-Betriebswirtin Sandy Krapohl (Author), 2006, Corporate Citizenship. Die strategische Einbettung von gesellschaftlichem Engagement in die Unternehmenskultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66170