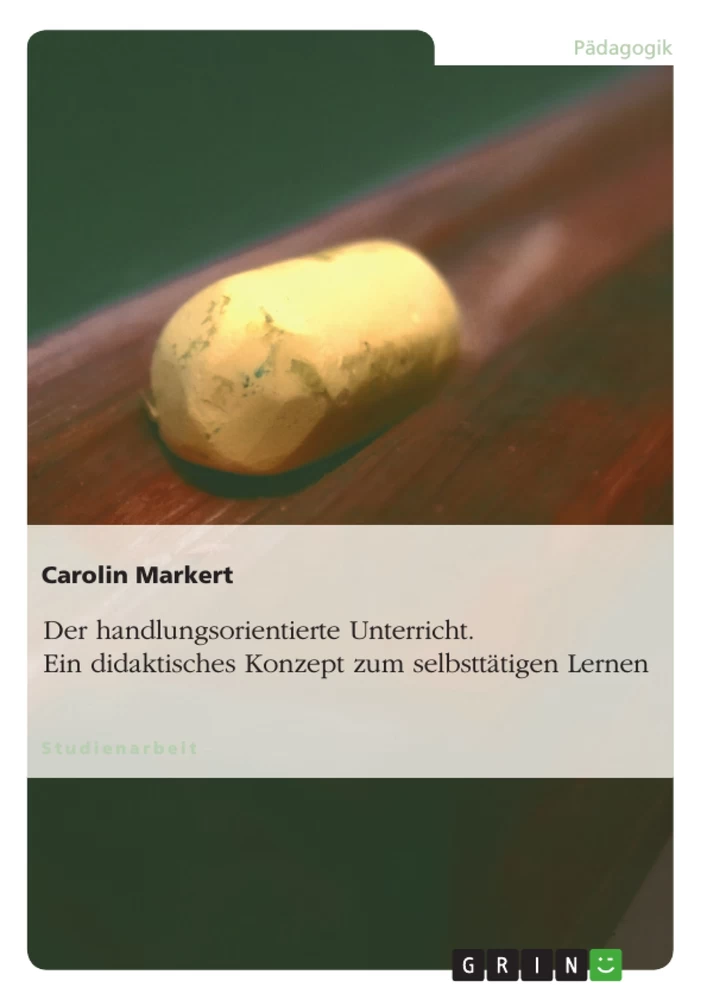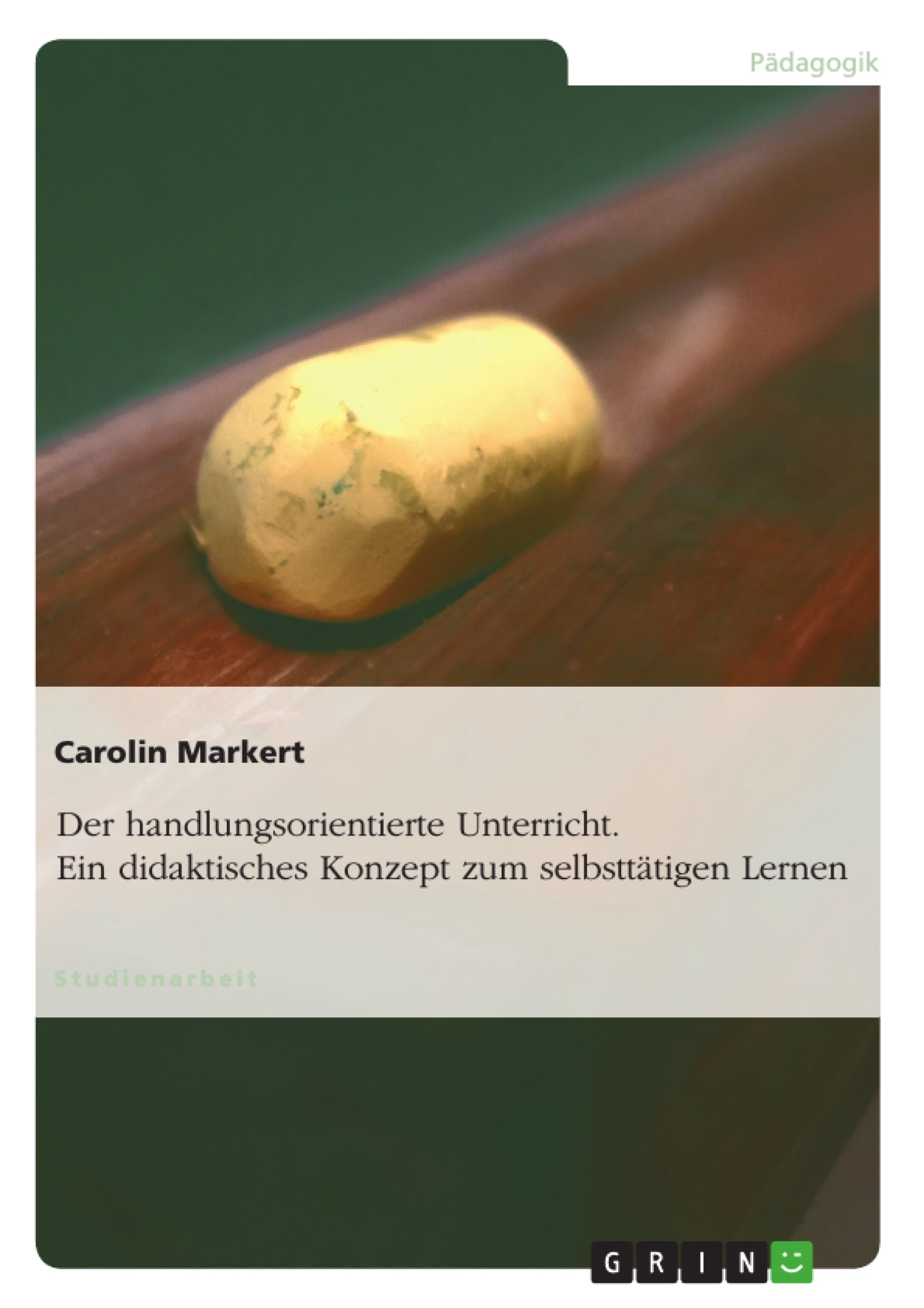Der Lehrer steht vor der Klasse, redet monoton über irgendein Thema und unterbricht seine Rede ab und an für einige Tafelanschriften. Einige Schüler tauschen Zettel mit kleinen Nachrichten aus, andere träumen vor sich hin und wieder andere unterhalten sich lautstark in der letzten Reihe, während sie ihr Heft mit Mustern und Blumen verzieren. – Eine Situation wie diese spielt sich vermutlich täglich in Schulklassen ab. Der Lehrer zieht eigensinnig seinen Vortrag durch, wie er ihn vorbereitet hat und die Schüler reagieren auf diesen einseitigen Unterrichtsvortrag mit solchen Nebentätigkeiten. Es ist natürlich aus der Sicht des Lehrers nachvollziehbar, dass solche Nebentätigkeiten für den Unterricht störend sind, aber es ist auch verständlich, dass die Schüler durch eine derartige „Verkopfung“ den Unterrichtsinhalten mit einer gewissen Gleichgültigkeit begegnen. Es besteht die Gefahr, dass sich der Lehrer durch die Langeweile der Schüler gezwungen sieht den Schülern ihren Frontalunterricht noch intensiver aufzudrängen, was aber wiederum die Langeweile der Schüler noch zusätzlich verstärkt. So ergibt sich ein Kreislauf, in dem sich die beiden Faktoren gegenseitig immer mehr steigern. Untersucht man die Nebentätigkeiten der Schüler hinsichtlich ihrer Struktur genauer, so stößt man auf einige Hinweise, die deutlich machen, was die Schüler durch diese Nebentätigkeiten kompensieren, sprich an was es ihnen im Unterricht mangelt. Die Nebentätigkeiten erweisen sich als sinnlichganzheitlich, die Schüler verbinden meistens Kopf- und Handarbeit miteinander und beziehen auch ihre Gefühle mitein; außerdem sind sie dabei sehr selbsttätig und kooperieren viel mit ihren Mitschülern. Somit können die Nebentätigkeiten der Schüler dem Lehrer sogar behilflich sein, wenn er sich näher mit ihrer Struktur beschäftigt und versucht die Anforderungen, die den Schülern im Unterricht fehlen, in seine Unterrichtsgestaltung zu integrieren. Dadurch würden nämlich nicht nur die Nebentätigkeiten abnehmen, sondern die Schüler hätten auch mehr Spaß am Unterricht, wenn ihnen mehr Selbsttätigkeit zugestanden werden würde.
Der handlungsorientierte Unterricht soll als didaktisches Konzept vorgestellt werden. Zunächst werden der historische Hintergrund, Merkmale/Definitionen und theoretische Begründungen behandelt. Außerdem wird die praktische Umsetzung erläutert und eine Bewertung des Konzepts hinsichtlich seiner Vor- und Nachteile und seiner Realisierbarkeit in der Praxis vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zur Notwendigkeit handlungsorientierten Unterrichts
- 2 Handlungsorientierter Unterricht als didaktisches Konzept zur Anleitung selbsttätigen Lernens von Schülerinnen und Schülern
- 2.1 Der historische Hintergrund des handlungsorientierten Unterrichts
- 2.2 Definition, Merkmale und Abgrenzung des handlungsorientierten Unterrichts gegenüber ähnlichen Konzepten
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Merkmale
- 2.2.3 Abgrenzung gegenüber ähnlichen Konzepten
- 2.3 Theoretische Begründungen des handlungsorientierten Unterrichts
- 2.3.1 Entwicklungstheoretische Begründung
- 2.3.2 Lerntheoretische Begründung
- 2.3.3 Sozialisationstheoretische Begründung
- 2.3.4 Bildungstheoretische Begründung
- 2.4 Der handlungsorientierte Unterricht in der Praxis
- 2.4.1 Ablauf und einzelne Phasen eines handlungsorientierten Unterrichts
- 2.4.2 Veranschaulichung der einzelnen Phasen an einer Unterrichtseinheit
- 2.5 Bewertung des Konzepts des handlungsorientierten Unterrichts
- 2.5.1 Vor- und Nachteile des handlungsorientierten Unterrichts
- 2.5.2 Kritische Betrachtung und Stellungnahme zur Position Janks/Meyers
- 3 Fazit: Ist der handlungsorientierte Unterricht ein realisierbares Unterrichtskonzept oder nur eine utopische Vorstellung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht handlungsorientierten Unterricht als didaktisches Konzept zur Förderung selbstständigen Lernens bei Schülerinnen und Schülern. Sie beleuchtet den historischen Kontext, definiert das Konzept, untersucht seine theoretischen Grundlagen und bewertet seine praktische Anwendbarkeit.
- Historische Entwicklung des handlungsorientierten Unterrichts
- Definition und Merkmale handlungsorientierten Unterrichts
- Theoretische Fundierung (entwicklungs-, lern-, sozialisations- und bildungstheoretisch)
- Praktische Umsetzung und didaktische Gestaltung
- Bewertung des Konzepts und seiner Realisierbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Zur Notwendigkeit handlungsorientierten Unterrichts: Das Kapitel beschreibt den traditionellen Frontalunterricht als monoton und wenig motivierend für Schüler, die oft mit Nebentätigkeiten reagieren. Diese Nebentätigkeiten werden analysiert und als Ausdruck des Bedürfnisses nach sinnlicher Ganzheitlichkeit, Selbsttätigkeit und Kooperation interpretiert. Der empirische Befund, dass selbsttätiges Lernen die Gedächtnisleistung erheblich steigert, unterstreicht die Notwendigkeit handlungsorientierten Unterrichts. Der zunehmende Mangel an Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten im außerunterrichtlichen Bereich verstärkt diese Notwendigkeit weiter.
2 Handlungsorientierter Unterricht als didaktisches Konzept zur Anleitung selbsttätigen Lernens von Schülerinnen und Schülern: Dieses Kapitel definiert handlungsorientierten Unterricht als ein Konzept, das Kopf- und Handarbeit verbindet und die Selbsttätigkeit der Schüler fördert. Es wird der hohe Anteil von Frontalunterricht in Schulen kritisiert und der Bedarf an mehr handlungsorientierten Methoden betont. Der historische Hintergrund wird kurz angerissen, um den Entwicklungsprozess des Konzepts aufzuzeigen.
2.1 Der historische Hintergrund des handlungsorientierten Unterrichts: Dieses Kapitel verfolgt die historischen Wurzeln des handlungsorientierten Unterrichts von Comenius über Rousseau bis hin zu Pestalozzi. Die Betonung von sinnlicher Erfahrung und Selbsttätigkeit im Lernen wird als wiederkehrendes Element herausgestellt. Die Autoren des Kapitels beleuchten die didaktischen Ideen dieser Pädagogen und zeigen, wie sie die Grundlagen für den modernen handlungsorientierten Unterricht gelegt haben.
Schlüsselwörter
Handlungsorientierter Unterricht, Selbsttätiges Lernen, Didaktik, Reformpädagogik, Entwicklungstheorie, Lerntheorie, Sozialisationstheorie, Bildungstheorie, Frontalunterricht, Kopf- und Handarbeit, Unterrichtsmethoden.
Häufig gestellte Fragen zum handlungsorientierten Unterricht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über handlungsorientierten Unterricht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition, den theoretischen Grundlagen und der praktischen Anwendbarkeit des Konzepts im Unterricht.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 befasst sich mit der Notwendigkeit handlungsorientierten Unterrichts im Vergleich zum traditionellen Frontalunterricht. Kapitel 2 definiert handlungsorientierten Unterricht, beleuchtet seinen historischen Hintergrund, die theoretischen Begründungen (entwicklungs-, lern-, sozialisations- und bildungstheoretisch) und die praktische Umsetzung. Kapitel 3 zieht ein Fazit und hinterfragt die Realisierbarkeit des Konzepts.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Das Dokument untersucht handlungsorientierten Unterricht als didaktisches Konzept zur Förderung des selbstständigen Lernens bei Schülerinnen und Schülern. Es beleuchtet den historischen Kontext, definiert das Konzept, untersucht seine theoretischen Grundlagen und bewertet seine praktische Anwendbarkeit. Schwerpunkte sind die historische Entwicklung, Definition und Merkmale, die theoretische Fundierung, die praktische Umsetzung und die Bewertung der Realisierbarkeit.
Welche theoretischen Grundlagen werden im Dokument behandelt?
Die theoretischen Grundlagen des handlungsorientierten Unterrichts werden aus entwicklungstheoretischer, lerntheoretischer, sozialisationstheoretischer und bildungstheoretischer Perspektive beleuchtet. Das Dokument zeigt auf, wie diese Theorien das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts unterstützen.
Wie wird der handlungsorientierte Unterricht im Dokument definiert?
Handlungsorientierter Unterricht wird als ein didaktisches Konzept definiert, das Kopf- und Handarbeit verbindet und die Selbsttätigkeit der Schüler fördert. Im Gegensatz zum traditionellen Frontalunterricht soll er die aktive Beteiligung und das eigenständige Lernen der Schüler in den Mittelpunkt stellen.
Welche Vor- und Nachteile des handlungsorientierten Unterrichts werden diskutiert?
Das Dokument erwähnt Vor- und Nachteile des handlungsorientierten Unterrichts, wobei die konkreten Punkte nicht im Detail in der Zusammenfassung aufgeführt sind. Eine kritische Betrachtung und Stellungnahme zur Position Janks/Meyers ist ebenfalls Teil der Auswertung.
Welche historischen Wurzeln des handlungsorientierten Unterrichts werden genannt?
Der historische Hintergrund wird von Comenius über Rousseau bis hin zu Pestalozzi verfolgt. Die Betonung von sinnlicher Erfahrung und Selbsttätigkeit im Lernen wird als wiederkehrendes Element hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Handlungsorientierter Unterricht, Selbsttätiges Lernen, Didaktik, Reformpädagogik, Entwicklungstheorie, Lerntheorie, Sozialisationstheorie, Bildungstheorie, Frontalunterricht, Kopf- und Handarbeit, Unterrichtsmethoden.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Die Zielgruppe sind Pädagogen, Lehramtsstudierende und alle, die sich mit didaktischen Konzepten und der Verbesserung des Unterrichts auseinandersetzen. Der Text ist für die akademische Nutzung konzipiert.
- Quote paper
- Carolin Markert (Author), 2006, Der handlungsorientierte Unterricht. Ein didaktisches Konzept zum selbsttätigen Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66123