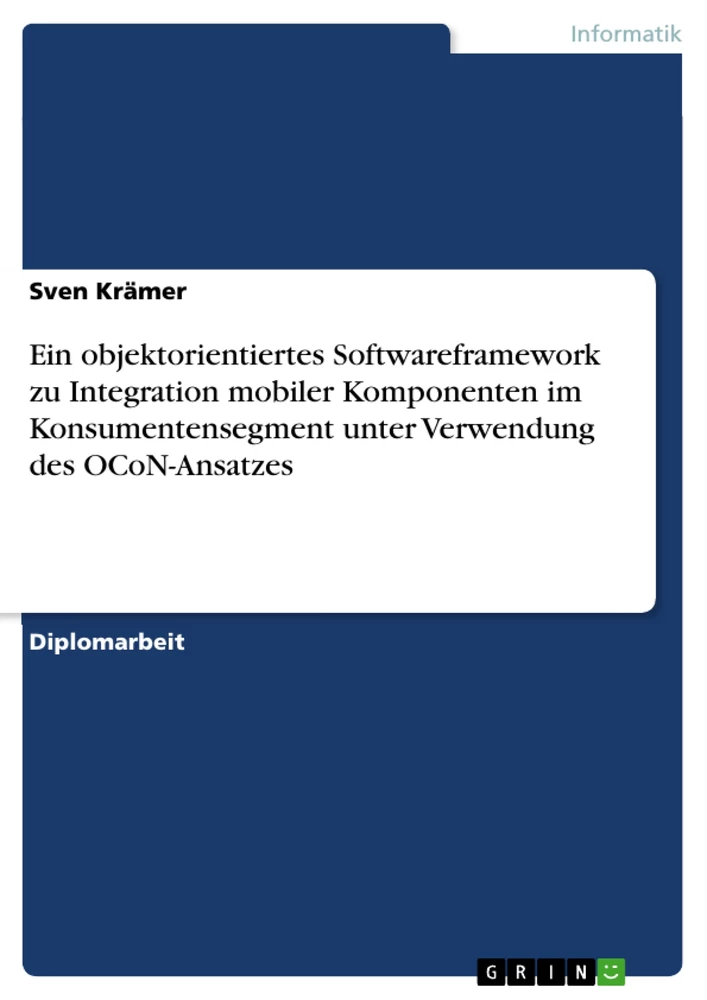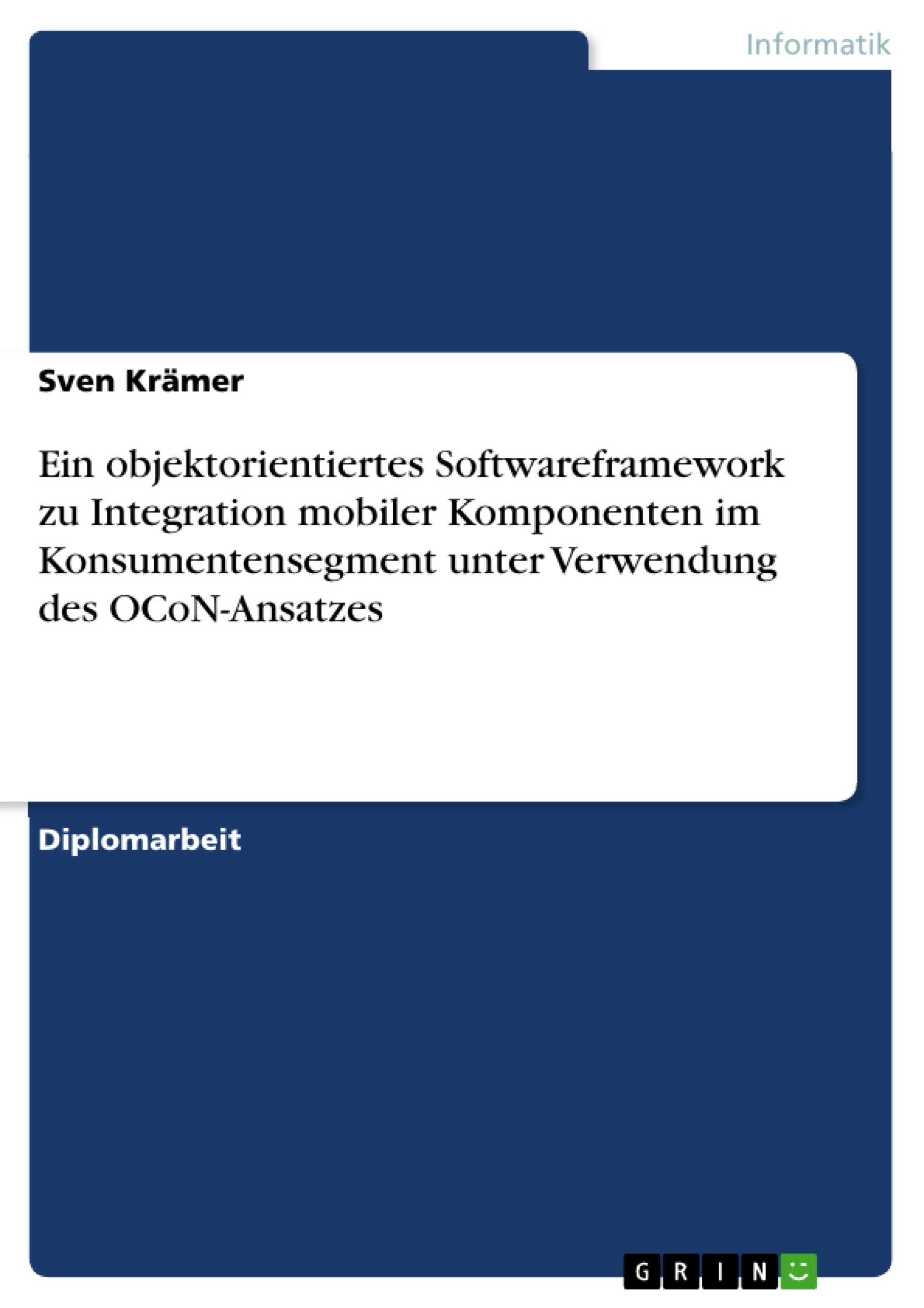Im August 2001 gab es in der Bundesrepublik Deutschland 55 Millionen Nutzer der Mobilfunknetze.1 Dem standen ungefähr 82 Millionen Einwohner2 gegenüber. Folglich haben im August 2001 67 % der Bevölkerung mobile Endgeräte verwendet. Jeder Vierte Handynutzer besitzt ein WAP-fähiges Handy. Davon nutzen allerdings nur 5 Prozent WAP-Dienste.3 Ein Grund für die geringe Nutzung der WAP-Dienste ist, neben den hohen Verbindungsgebühren, die langsame Datenübertragungsrate. Der technologische Fortschritt im Bereich der Übertragungstechnologien bringt jedoch neue Nutzungsmöglichkeiten. Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) hat in Deutschland bei der Versteigerung der Lizenzen für viel Diskussionsstoff gesorgt, da die Lizenzen für außerordentlich hohe Summen von sechs Unternehmen ersteigert wurden. Beispielsweise hat die Deutsche Telekom 16,58 Milliarden DM für ihre beiden Frequenzpakete gezahlt. Das war ca. ein Viertel ihres Umsatzes von rund 69 Milliarden DM des vorherigen Jahres, bei einem Konzernüberschuss von 2,35 Milliarden DM.4 Die Mobilcom brauchte mit einem Umsatz von 2,44 Milliarden DM und einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 123 Millionen DM die Unterstützung der France Telecom. Die gemeinsame Lizenz kostet 16,37 Milliarden DM. Die Mobilcom plant im Jahre 2008 schwarze Zahlen mit der UMTS-Sparte zu erwirtschaften. Zudem will Mobilcom im Jahre 2005 einen UMTS-Umsatz von fünf Milliarden Euro und im Jahre 2012 einen Umsatz von zwölf Milliarden Euro erreichen.5 Alle sechs börsennotierten Unternehmen und zukünftige UMTS-Netzbetreiber stehen unter Erfolgsdruck bei ihren Anlegern und werden weiterhin umfangreiche Investitionen tätigen müssen, um in naher Zukunft ihre Ziele erreichen zu können. Hohe Investitionen im mobilen Markt sprechen für eine hervorragende Perspektive dieses Marktes. Die Unternehmen, die in diesen Markt eindringen wollen, müssen den potenziellen Kunden einen nachhaltigen Mehrwert durch UMTS bieten. Folglich ist es wichtig, die genauen Anforderungen und Wünsche der Kunden zu erkennen, um ihnen gerecht werden zu können. Wünsche zu ermöglichen heißt in diesem Zusammenhang, eine Netz- und Serviceinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dieses beinhaltet entsprechende Software für die mobilen Endgeräte, um die Anwendungen des Mobile Business abzudecken. Potenzielle Kunde sind die Akteure des Mobile Business, also Unternehmungen und Konsumenten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen
- Objektorientiertes Framework
- Mobile Komponenten und Technologien
- Mobile Netze
- Mobile Mittelstrecken-Technologien
- Mobile Kurzstrecken-Technologien
- Mobile Lokalisierungs-Technologien
- Der OCON-Ansatz
- Das Konsumentensegment
- Mobile Information
- Mobile Communication
- Mobile Entertainment
- Mobile Financial Transaction
- Analyse
- Ausgewählte Frameworks der Literatur
- Situated Computing Framework
- Globale Architektur (MOCA)
- Szenarien
- Ad-Hoc
- Mobile Brokerage
- Mobile Ticketing
- M-Tracking
- Mobile child tracking
- Mobile Gaming
- Mobile Advertising
- M-Auctions
- Anforderungen an ein Framework zur Integration mobiler Komponenten im Konsumentensegment
- Ausgewählte Frameworks der Literatur
- Das Framework und sein Modell
- RequestM
- Request
- RequestListener
- RequestManager
- SessionM
- Session
- Sessionmanager
- ApplicationM
- Application
- ApplicationManager
- Essentielle Applikationen
- ServiceM
- Service
- ServiceManager
- Essentielle Services
- UserAdministration
- Admin
- RemoteUser
- UserManager
- Group
- GroupManager
- RequestM
- Anwendungsbeispiele
- Ad-Hoc
- Mobile Brokerage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines objektorientierten Softwareframeworks zur Integration mobiler Komponenten im Konsumentensegment. Das Framework basiert auf dem OCON-Ansatz und soll eine effiziente und flexible Integration mobiler Dienste und Anwendungen ermöglichen.
- Objektorientierte Frameworks für die Integration mobiler Komponenten
- Anforderungen an ein Framework im Konsumentensegment
- Der OCON-Ansatz und seine Anwendung in der Praxis
- Entwicklung eines Softwareframeworks zur Integration mobiler Komponenten
- Anwendungsbeispiele und Evaluierung des entwickelten Frameworks
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der Integration mobiler Komponenten im Konsumentensegment vor und gibt einen Überblick über die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen des objektorientierten Frameworks, mobiler Komponenten und Technologien, des OCON-Ansatzes und des Konsumentensegments.
Analyse: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Frameworks aus der Literatur und beschreibt verschiedene Anwendungsszenarien für mobile Komponenten im Konsumentensegment. Des Weiteren werden die Anforderungen an ein Framework zur Integration mobiler Komponenten in diesem Bereich definiert.
Das Framework und sein Modell: Dieses Kapitel stellt das entwickelte Framework und seine einzelnen Subsysteme (RequestM, SessionM, ApplicationM, ServiceM, UserAdministration) vor. Die Kapitel erläutern die Funktionsweise und die Architektur der einzelnen Subsysteme und zeigen die wichtigsten Klassen und Interfaces.
Anwendungsbeispiele: Dieses Kapitel demonstriert die Anwendung des entwickelten Frameworks anhand von zwei konkreten Beispielen: Ad-Hoc und Mobile Brokerage.
Schlüsselwörter
Objektorientiertes Framework, Mobile Komponenten, Konsumentensegment, OCON-Ansatz, Integration, Dienste, Anwendungen, Softwareentwicklung, Mobile Technologien, Ad-Hoc, Mobile Brokerage, Mobile Ticketing, M-Tracking, Mobile child tracking, Mobile Gaming, Mobile Advertising, M-Auctions, Mobile Information, Mobile Communication, Mobile Entertainment, Mobile Financial Transaction.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des entwickelten Softwareframeworks?
Es soll mobile Komponenten und Dienste effizient im Konsumentensegment integrieren, um Anwendungen wie Mobile Brokerage oder Ticketing flexibel zu ermöglichen.
Was bedeutet der OCoN-Ansatz?
OCoN steht für „Object-oriented Coordination Nets“ und dient zur Modellierung und Koordination von parallelen und verteilten Systemabläufen.
Warum wurde UMTS als wichtiger technologischer Treiber genannt?
UMTS bot zum Zeitpunkt der Arbeit deutlich höhere Datenraten als WAP, was die Entwicklung komplexer mobiler Geschäftsanwendungen (M-Business) erst wirtschaftlich sinnvoll machte.
Welche Bereiche umfasst das Konsumentensegment im Mobile Business?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Mobile Information, Communication, Entertainment und Financial Transactions.
Was sind Beispiele für Szenarien im Framework?
Zu den untersuchten Szenarien gehören Ad-Hoc-Netzwerke, Mobile Gaming, Werbe-Auktionen und das Tracking von Personen oder Gütern.
- Quote paper
- Sven Krämer (Author), 2002, Ein objektorientiertes Softwareframework zu Integration mobiler Komponenten im Konsumentensegment unter Verwendung des OCoN-Ansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6576