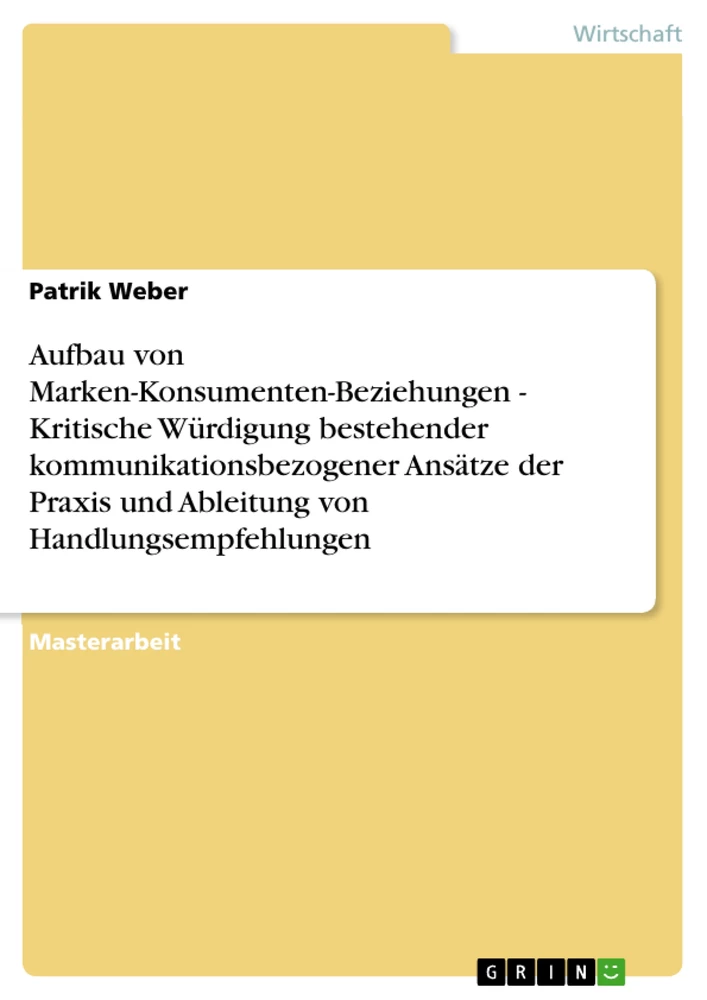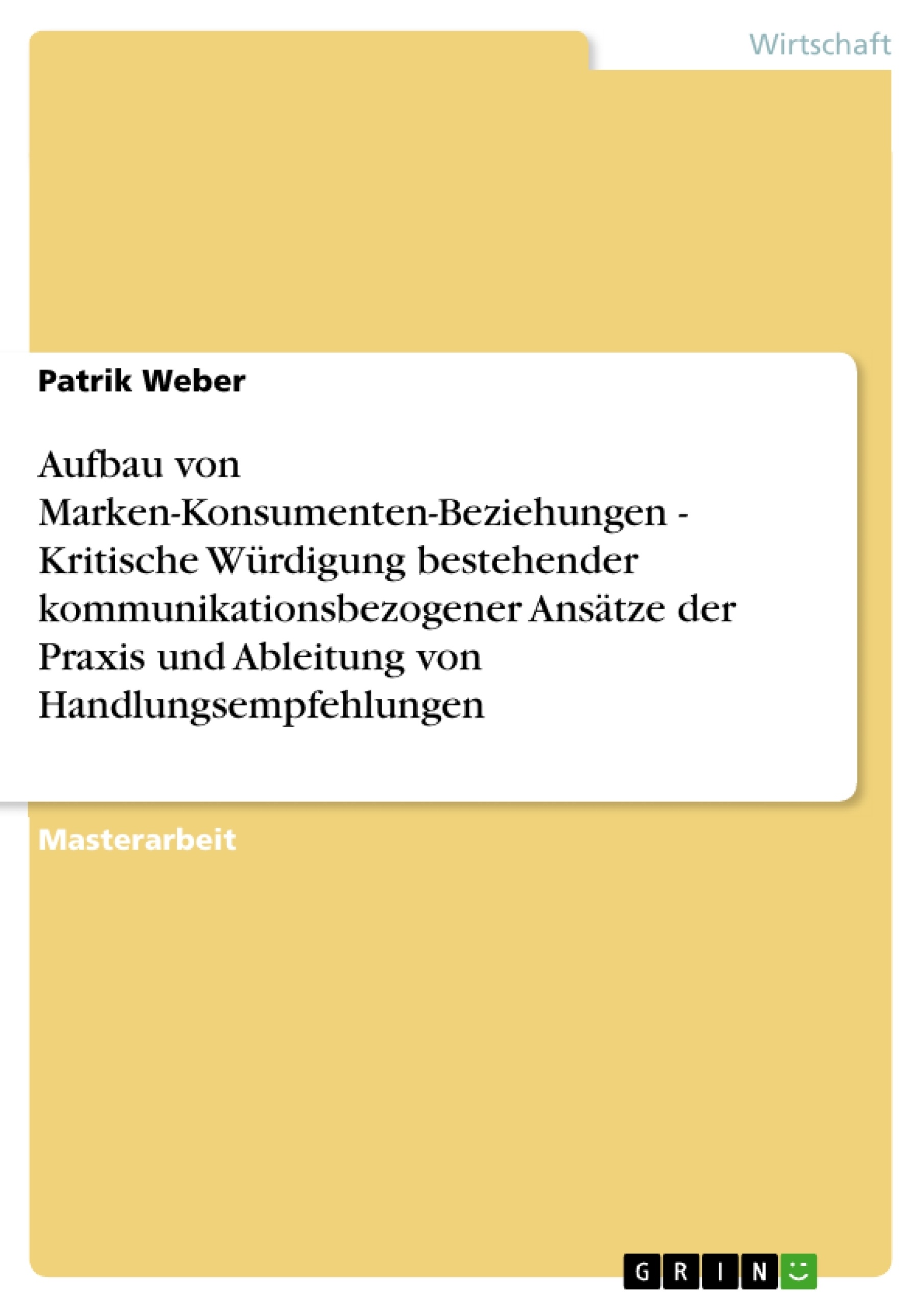„Wir erfüllen Träume durch das Erlebnis »Motorradfahren«.“ (Harley Davidson 2006). Mit diesem beziehungsorientierten Grundsatz stellt sich der amerikanische Motorradhersteller Harley Davidson als Erlebnismarke dar und versucht auf diese Weise, eine Marken-Konsumenten-Beziehung aufzubauen.
Das klassische Marketingkonzept wurde in den 1970er Jahren entwickelt und diente der Befriedigung des Massenkonsums,welcher aufgrund des Prosperitätsanstieges entstanden war. „Damals waren es die grundlegenden Prinzipien wie der Einsatz der Marketinginstrumente oder Segmentierung, die dem Marketing als Leitidee einer marktorientierten Unternehmensführung zum Durchbruch verhalfen.“. Vor diesem Hintergrund entstanden Mitte der 1980er Jahre die ersten Vorschläge für eine neue Akzentuierung des Marketing unter dem Begriff des Relationship Marketing. „Relationship Marketing bezeichnet die Ausrichtung der unternehmerischen Marketingaktivitäten auf die dauerhafte Bindung ausgewählter Kunden und stellt einen Gegenentwurf zu einem Marketing dar, in dessen Mittelpunkt die kurzfristige Realisierung einzelner Kaufabschlüsse steht.“. Diese Ansätze wurden in den 1990er Jahren weiterentwickelt und schliesslich im Jahre 2000 auf deutschsprachigen Konsumgütermärkten eingeführt. So griff das Konzept des Relationship Marketing eine für andere Branchen schon bekannte Regel auf: „stabile und langfristige Kundenbeziehungen sind essentiell für den Erfolg eines Konsumgüterherstellers.“. Ausgehend von der Erfolgskette ist klar erkennbar, dass langfristige Beziehungen zwischen Käufer und Verkäufer zu ökonomischem Erfolg führen.
Durch diese allgemeine Tendenz von einem transaktions- zu einem beziehungsorientierten Marketingverständnis hat die Unternehmenskommunikation in den letzten Jahren einen umfassenden Funktionswandel erfahren: Zwar ist gemäss O’Malley/Tynan der Konsumgütermarkt mit seinen fast homogenen Produkten und dem einhergehenden Konkurrenzdruck nach wie vor vom Transaktionsmarketing geprägt, jedoch kann eine Veränderung hin zum Beziehungsmarketing beobachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Wandel vom Bedarfs- zum Erlebniskonsum
- 2.2 Marken als Beziehungspartner auf Konsumgütermärkten
- 2.3 Konstitutionelle Elemente einer Marken-Konsumenten-Beziehung
- 2.3.1 Herleitung der konstitutiven Merkmale einer Marken-Konsumenten-Beziehung
- 2.3.2 Interaktion
- 2.3.3 Intimität
- 2.3.4 Reziprozität
- 3. Bestandsaufnahme und Systematisierung kommunikationsbezogener Ansätze der Praxis zum Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen auf Konsumgütermärkten
- 4. Kritische Würdigung kommunikationsbezogener Ansätze der Praxis zum Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen auf Konsumgütermärkten
- 5. Ableitung von kommunikationsbezogenen Handlungsempfehlungen
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen auf Konsumgütermärkten. Sie analysiert kritisch bestehende kommunikationsbezogene Ansätze und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. Der Fokus liegt auf dem Wandel vom Transaktions- zum Relationship Marketing und den damit verbundenen Herausforderungen.
- Wandel vom Transaktions- zum Relationship Marketing
- Konstitutionelle Elemente von Marken-Konsumenten-Beziehungen (Interaktion, Intimität, Reziprozität)
- Kritische Bewertung kommunikationsbezogener Ansätze in der Praxis
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen
- Herausforderungen des Relationship Marketing auf Konsumgütermärkten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Aufbaus von Marken-Konsumenten-Beziehungen auf Konsumgütermärkten ein. Sie beschreibt den Wandel vom transaktionsorientierten zum beziehungsorientierten Marketing und die damit verbundenen Herausforderungen. Am Beispiel von Harley Davidson wird der beziehungsorientierte Ansatz einer Erlebnismarke veranschaulicht. Die Einleitung hebt die Problematik der hohen Kosten der Neukundenakquisition im Vergleich zur Kundenbindung hervor und benennt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Wie kann ein Hersteller langfristige Beziehungen zu Konsumenten initiieren und erhalten und sich gleichzeitig von Wettbewerbern differenzieren?
2. Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt den Wandel vom Bedarfs- zum Erlebniskonsum und die Rolle von Marken als Beziehungspartner. Ein Schwerpunkt liegt auf der Definition und Analyse konstitutiver Elemente von Marken-Konsumenten-Beziehungen, nämlich Interaktion, Intimität und Reziprozität. Jedes dieser Elemente wird detailliert erklärt und seine Bedeutung für den Aufbau und die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen herausgestellt. Die Kapitel untermauern die Bedeutung einer tiefgreifenden Beziehung für den nachhaltigen Unternehmenserfolg.
3. Bestandsaufnahme und Systematisierung kommunikationsbezogener Ansätze der Praxis: Dieses Kapitel systematisiert verschiedene kommunikationsbezogene Ansätze aus der Praxis zum Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen. Es unterscheidet zwischen ein- und mehrmaligen sowie standardisierten und konsumentenbezogenen Instrumenten. Beispiele hierfür sind Flagship Stores, Concept Stores, Brandlands, Communities, Kundenclubs und Sponsoring. Die Darstellung dieser Instrumente ermöglicht einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten des Relationship Marketing.
4. Kritische Würdigung kommunikationsbezogener Ansätze der Praxis: Dieses Kapitel bewertet die im vorherigen Kapitel vorgestellten kommunikationsbezogenen Ansätze kritisch anhand von Kriterien wie Interaktion, Intimität, Reziprozität und ökonomischer Effizienz. Es analysiert Stärken und Schwächen der einzelnen Instrumente und identifiziert relevante Herausforderungen bei der Umsetzung. Die Kapitel liefert eine fundierte Einschätzung der Eignung verschiedener Ansätze für den Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen.
5. Ableitung von kommunikationsbezogenen Handlungsempfehlungen: Basierend auf den vorherigen Kapiteln werden in diesem Kapitel konkrete Handlungsempfehlungen für den Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen abgeleitet. Diese Empfehlungen berücksichtigen die spezifischen Herausforderungen des Konsumgütermarktes und bieten praktische Lösungen für Unternehmen. Die Handlungsempfehlungen sind auf die verschiedenen Instrumentenkategorien zugeschnitten und zielen auf eine nachhaltige Kundenbindung ab.
Schlüsselwörter
Relationship Marketing, Marken-Konsumenten-Beziehung, Konsumgütermärkte, Interaktion, Intimität, Reziprozität, Kommunikationsstrategien, Kundenbindung, Transaktionsmarketing, Erlebniskonsum, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen auf Konsumgütermärkten
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen auf Konsumgütermärkten. Sie analysiert kritisch bestehende kommunikationsbezogene Ansätze und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. Der Fokus liegt auf dem Wandel vom Transaktions- zum Relationship Marketing und den damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel vom Transaktions- zum Relationship Marketing, die konstitutiven Elemente von Marken-Konsumenten-Beziehungen (Interaktion, Intimität, Reziprozität), eine kritische Bewertung kommunikationsbezogener Ansätze in der Praxis, die Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen und die Herausforderungen des Relationship Marketing auf Konsumgütermärkten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Konzeptionelle Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen dar, einschließlich des Wandels vom Bedarfs- zum Erlebniskonsum und der konstitutiven Elemente von Marken-Konsumenten-Beziehungen. Kapitel 3 (Bestandsaufnahme und Systematisierung) systematisiert kommunikationsbezogene Ansätze aus der Praxis. Kapitel 4 (Kritische Würdigung) bewertet diese Ansätze kritisch. Kapitel 5 (Handlungsempfehlungen) leitet konkrete Handlungsempfehlungen ab. Kapitel 6 (Fazit und Ausblick) rundet die Arbeit ab.
Welche kommunikationsbezogenen Ansätze werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene kommunikationsbezogene Ansätze aus der Praxis, darunter ein- und mehrmalige sowie standardisierte und konsumentenbezogene Instrumente wie Flagship Stores, Concept Stores, Brandlands, Communities, Kundenclubs und Sponsoring.
Welche Kriterien werden zur kritischen Bewertung der kommunikationsbezogenen Ansätze verwendet?
Die kritische Bewertung der Ansätze erfolgt anhand von Kriterien wie Interaktion, Intimität, Reziprozität und ökonomischer Effizienz.
Welche Handlungsempfehlungen werden abgeleitet?
Die Arbeit leitet konkrete, auf die verschiedenen Instrumentenkategorien zugeschnittene Handlungsempfehlungen für den Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen ab, die die spezifischen Herausforderungen des Konsumgütermarktes berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Relationship Marketing, Marken-Konsumenten-Beziehung, Konsumgütermärkte, Interaktion, Intimität, Reziprozität, Kommunikationsstrategien, Kundenbindung, Transaktionsmarketing, Erlebniskonsum, Handlungsempfehlungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich Marketing und Markenmanagement, die sich mit dem Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen auf Konsumgütermärkten beschäftigen.
- Quote paper
- Patrik Weber (Author), 2006, Aufbau von Marken-Konsumenten-Beziehungen - Kritische Würdigung bestehender kommunikationsbezogener Ansätze der Praxis und Ableitung von Handlungsempfehlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65707