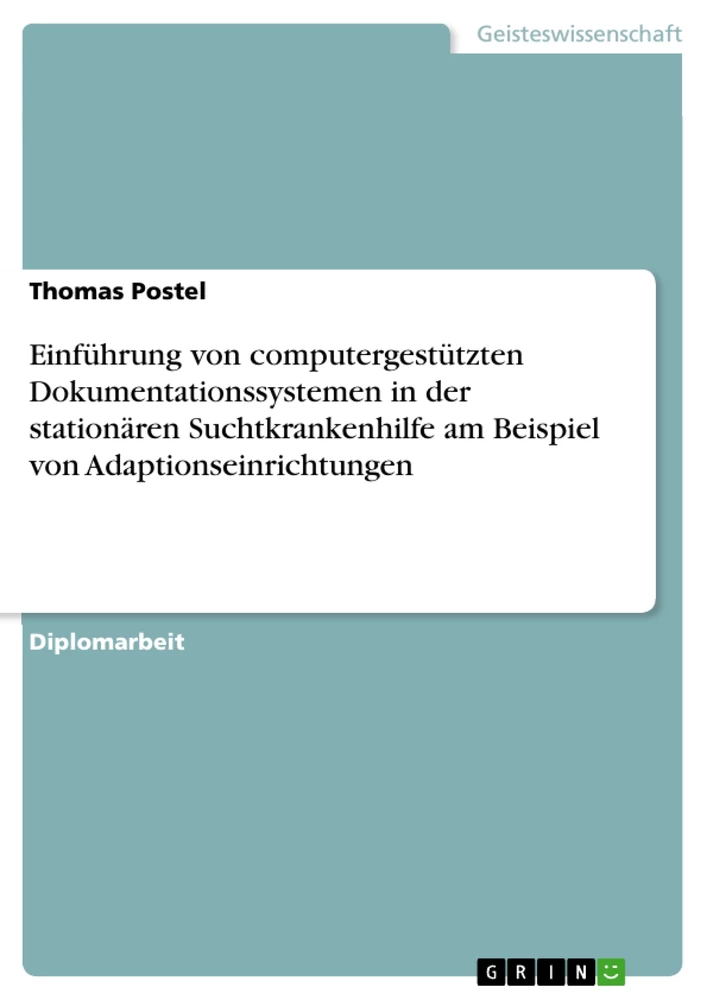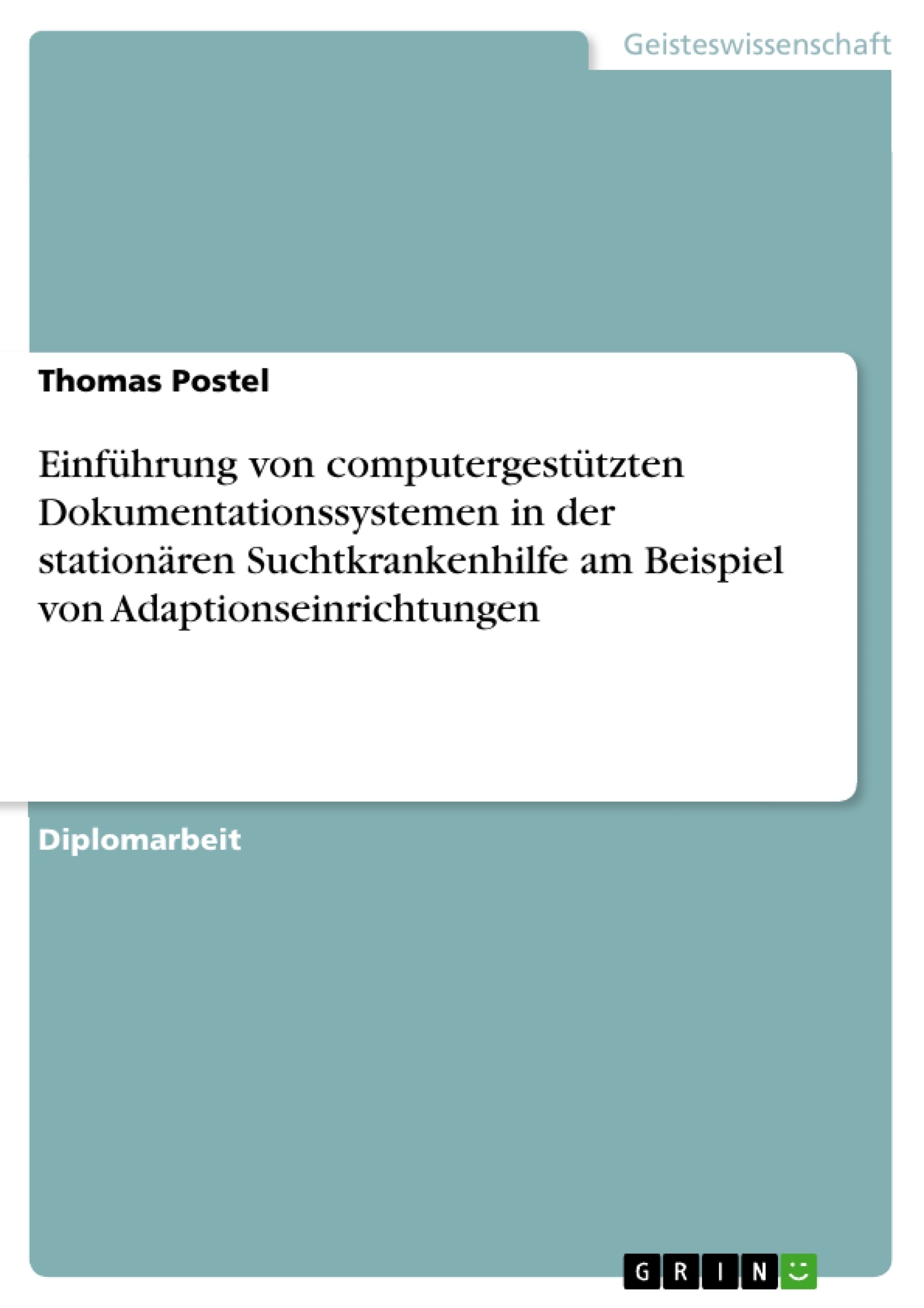Die Nutzung von Computern und Internet ist heute in vielen sozialen Einrichtungen selbstverständlich. Informationstechnologie (IT) wird inzwischen auch verstärkt in der fachlichen Arbeit eingesetzt. Die Dokumentation der Behandlungsprozesse ist eines dieser Aufgabenfelder. Mit einer konventionellen Aktenführung lassen sich diese Aufgaben häufig nicht mehr effizient durchführen. Viele Einrichtungen setzen bereits computergestützte Dokumentationsprogramme ein, andere planen eine Einführung dieser Systeme.
Inzwischen ist Fachsoftware auch für kleinere Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe erschwinglich geworden. Mit modernen IT-Systemen kann der Behandlungsprozess nicht nur dokumentiert sondern auch geplant werden. Häufig sind noch Adressverwaltungs- und Kommunikationsfunktionen vorhanden.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es deutlich zu machen, dass für eine erfolgreiche Einführung und Nutzung von IT-Systemen eine systematische Vorbereitung und Planung unabdingbar ist. Die dafür erforderlichen Schritte und Prozesse sollen vorgestellt werden.
Dazu werden zunächst im 2. Kapitel das System der Suchthilfe in Deutschland und der Einrichtungstyp Adaptionseinrichtung beschrieben. Anschließend wird im 3. Kapitel die Qualität im Bereich sozialer Dienstleistungen erläutert und aufgezeigt, dass die Dokumentation eine Voraussetzung für die Qualitätssicherung ist. Im 4. Kapitel werden Funktion und Inhalt der Aktenführung und Dokumentation dargestellt. Die Nutzung der Informationstechnologie in sozialen Organisationen und die IT-Grundlagen werden im 5. Kapitel erläutert. Anschließend wird im 6. Kapitel der Auswahl- und Einführungsprozess für eine Fachsoftware beschrieben. Notwendige Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch IT-Systeme werden im 7. Kapitel aufgezeigt. Im 8. Kapitel wird der Funktionsumfang einer Dokumentationssoftware näher erläutert. Abschließend soll im 9. Kapitel an einem Beispielprojekt der Einführungsprozess eines IT-Dokumentationssystems dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- System der Suchthilfe in Deutschland
- Träger und Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe
- ICF als Grundlage der Rehabilitationsmaßnahmen
- Adaptionsmaßnahmen als 2. Phase der Rehabilitation
- Phasen der Adaption
- Zielgruppe der Adaptionsbehandlung
- Struktur der Einrichtungen
- Nachsorge
- Zukunft der stationären Sucht-Rehabilitation
- Qualität im Bereich sozialer Dienstleistungen
- Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementsystem
- Rahmenbedingungen der Qualität in der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen
- Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherung
- Qualitätsvergleiche als Belegungskriterium
- Dokumentation als Voraussetzung für die Qualitätssicherung
- Wissensmanagement
- Aktenführung und Dokumentation
- Funktion der klientenbezogenen Dokumentation
- Inhaltliche und formale Anforderungen
- Therapieziele und Behandlungsplan
- Informationstechnologie in sozialen Organisationen
- Geschichtliche Entwicklung
- Technische IT-Grundlagen
- Computer-Netzwerke
- Softwarearchitektur-Konzepte
- Software-Ergonomie
- Trends und Entwicklungen der IT in der Sozialwirtschaft
- Chancen und Risiken
- IT-Management in Organisationen der Sozialwirtschaft
- Konsequenzen der Computerisierung
- Folgen für Mitarbeiter und Arbeitsplätze
- Folgen für Patienten
- Maßnahmen zur Einführung neuer Software
- Analyse und Optimierung der Arbeitsprozesse
- IT-Schulung der Mitarbeiter
- Software-Auswahlprozess
- Planungsphase
- Formulierung des Anforderungsprofils
- Vorauswahl-Verfahren
- Gezielte Informationsbeschaffung
- Endauswahl-Verfahren
- Kaufentscheidung und Vertragsabschluss
- Einführungsprozess von IT-Lösungen
- Planungsphase
- Auswahl der Strategie
- Vorbereitungsphase
- Betreuung und Programmanpassung
- Arbeit mit dem neuen IT-System
- Mitarbeiterschulung
- Datenschutz und IT-Sicherheit
- Datenschutzrecht
- Einwilligung
- Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
- Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
- Meldepflicht für IT-Verfahren und Datenschutzbeauftragter
- Schutz der Mitarbeiterdaten
- Schutzmaßnahmen
- IT-Sicherheit
- Bestandsaufnahme und Risiko-Analyse
- Schutzstufenkonzept
- Organisatorische Maßnahmen
- Organisatorisch-technische Maßnahmen
- Datenschutzrecht
- Dokumentationssoftware für Adaptionseinrichtungen
- Einführung eines IT-Dokumentationssystems in einer Adaptionseinrichtung
- Beispielprojekt
- Planungsphase
- Technische Maßnahmen
- Auftaktveranstaltung (Kick-Off-Meeting)
- Umsetzungsphase Software-Auswahlprozess
- Kaufentscheidung
- Umsetzungsphase Einführung IT-System
- Konsolidierungsphase und Reflexion
- Abbildungen
- Zusammenfassung und Ausblick
- Anschriftenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anhangverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die systematische Einführung computergestützter Dokumentationssysteme in Adaptionseinrichtungen der stationären Suchtkrankenhilfe. Ziel ist es, die notwendigen Schritte und Prozesse für eine erfolgreiche Implementierung aufzuzeigen und die Bedeutung einer gründlichen Planung und Vorbereitung hervorzuheben. Die Arbeit beleuchtet die Schnittstelle zwischen Sozialer Arbeit und Sozialinformatik.
- Einführung von IT-Systemen in der Suchtkrankenhilfe
- Qualitätsmanagement und Dokumentation in sozialen Dienstleistungen
- Software-Auswahl und -Einführungsprozess
- Datenschutz und IT-Sicherheit im Kontext sozialer Einrichtungen
- Optimierung von Arbeitsprozessen durch IT
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den zunehmenden Einsatz von Informationstechnologie (IT) in sozialen Einrichtungen, insbesondere die computergestützte Dokumentation in der Suchtkrankenhilfe. Sie hebt die Notwendigkeit einer systematischen Planung für die erfolgreiche Einführung von IT-Systemen hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
System der Suchthilfe in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt das System der Suchthilfe in Deutschland, einschließlich der Träger, Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe, und fokussiert auf Adaptionseinrichtungen als eine Phase der Rehabilitation. Es beleuchtet die Zielgruppen, die Struktur der Einrichtungen und die Nachsorge, sowie die zukünftigen Herausforderungen der stationären Sucht-Rehabilitation.
Qualität im Bereich sozialer Dienstleistungen: Das Kapitel behandelt Qualitätsmanagement und -sicherung im Bereich sozialer Dienstleistungen, mit besonderem Augenmerk auf die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen. Es wird die Bedeutung der Dokumentation als Grundlage für die Qualitätssicherung und die Rolle von Qualitätsprogrammen und -vergleichen herausgestellt. Das Kapitel thematisiert auch Wissensmanagement im Kontext der Qualitätssicherung.
Aktenführung und Dokumentation: Dieses Kapitel beschreibt die Funktion und die inhaltlichen sowie formalen Anforderungen an die klientenbezogene Dokumentation in der Suchtkrankenhilfe. Es betont die Bedeutung von Therapiezielen und Behandlungsplanung innerhalb der Dokumentation.
Informationstechnologie in sozialen Organisationen: Hier wird die geschichtliche Entwicklung und die technischen Grundlagen der Informationstechnologie in sozialen Organisationen erläutert. Das Kapitel behandelt Computernetzwerke, Softwarearchitektur, Software-Ergonomie, aktuelle Trends und Entwicklungen, Chancen und Risiken des IT-Einsatzes sowie das IT-Management in der Sozialwirtschaft. Die Folgen der Computerisierung für Mitarbeiter, Arbeitsplätze und Patienten werden diskutiert.
Maßnahmen zur Einführung neuer Software: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Prozess der Einführung neuer Software, einschließlich der Analyse und Optimierung von Arbeitsprozessen, der IT-Schulung der Mitarbeiter und des detaillierten Software-Auswahlprozesses. Die verschiedenen Phasen des Auswahlprozesses, von der Planung bis zum Vertragsabschluss, werden systematisch dargestellt. Auch der Einführungsprozess der IT-Lösung selbst, von der Planung bis zur Implementierung, wird ausführlich beschrieben.
Mitarbeiterschulung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit den neuen IT-Systemen. Es geht um die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten, um einen erfolgreichen und effizienten Einsatz der Software zu gewährleisten.
Datenschutz und IT-Sicherheit: Dieses Kapitel behandelt die wichtigen Aspekte des Datenschutzes und der IT-Sicherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch IT-Systeme. Es erläutert die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes, die Pflichten der Mitarbeiter und die notwendigen Schutzmaßnahmen, sowohl organisatorischer als auch technischer Natur.
Dokumentationssoftware für Adaptionseinrichtungen: Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen und Möglichkeiten moderner Dokumentationssoftware, die speziell für die Bedürfnisse von Adaptionseinrichtungen entwickelt wurden.
Schlüsselwörter
Suchtkrankenhilfe, Adaptionseinrichtungen, computergestützte Dokumentation, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie (IT), Software-Einführung, Datenschutz, IT-Sicherheit, Arbeitsprozessoptimierung, Sozialinformatik, Wissensmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Einführung computergestützter Dokumentationssysteme in Adaptionseinrichtungen der stationären Suchtkrankenhilfe
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die systematische Einführung computergestützter Dokumentationssysteme in Adaptionseinrichtungen der stationären Suchtkrankenhilfe. Sie zeigt die notwendigen Schritte und Prozesse für eine erfolgreiche Implementierung auf und betont die Bedeutung gründlicher Planung und Vorbereitung. Der Fokus liegt auf der Schnittstelle zwischen Sozialer Arbeit und Sozialinformatik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der IT-Einführung in der Suchtkrankenhilfe, darunter Qualitätsmanagement und -sicherung, Software-Auswahl und -Einführungsprozesse, Datenschutz und IT-Sicherheit, sowie die Optimierung von Arbeitsprozessen durch den Einsatz von IT. Sie beleuchtet auch das deutsche System der Suchthilfe, Aktenführung und Dokumentation sowie Mitarbeiterschulung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Vorwort, Einleitung, System der Suchthilfe in Deutschland (inkl. Träger, Leistungen, ICF, Adaptionsmaßnahmen, Nachsorge und Zukunftsperspektiven), Qualität in sozialen Dienstleistungen (inkl. Qualitätsmanagement, Qualitätsprogramme und -vergleiche, Dokumentation und Wissensmanagement), Aktenführung und Dokumentation, Informationstechnologie in sozialen Organisationen (inkl. Geschichte, technische Grundlagen, Software-Ergonomie, Trends, Chancen und Risiken, IT-Management und Konsequenzen der Computerisierung), Maßnahmen zur Einführung neuer Software (inkl. Prozessanalyse, Mitarbeiterschulung, Software-Auswahlprozess und Einführungsprozess), Mitarbeiterschulung, Datenschutz und IT-Sicherheit, Dokumentationssoftware für Adaptionseinrichtungen, Einführung eines IT-Dokumentationssystems (inkl. Beispielprojekt und Phasenbeschreibung), Abbildungen, Zusammenfassung und Ausblick, Anschriftenverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Literaturverzeichnis und Anhangverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die notwendigen Schritte und Prozesse für eine erfolgreiche Implementierung computergestützter Dokumentationssysteme in Adaptionseinrichtungen aufzuzeigen und die Bedeutung einer gründlichen Planung und Vorbereitung hervorzuheben. Es soll ein umfassender Leitfaden für die Praxis geschaffen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Suchtkrankenhilfe, Adaptionseinrichtungen, computergestützte Dokumentation, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie (IT), Software-Einführung, Datenschutz, IT-Sicherheit, Arbeitsprozessoptimierung, Sozialinformatik, Wissensmanagement.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einem Vorwort und einer Einleitung. Es folgt eine detaillierte Beschreibung des Themas, gegliedert in einzelne Kapitel mit jeweiligen Unterkapiteln. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung, einem Ausblick und den üblichen bibliographischen Angaben.
Welche praktischen Anwendungen hat die Arbeit?
Die Arbeit bietet praktische Hilfestellung für Adaptionseinrichtungen der Suchtkrankenhilfe bei der Planung und Umsetzung der Einführung computergestützter Dokumentationssysteme. Sie dient als Leitfaden für die Optimierung von Arbeitsprozessen und die Sicherstellung von Datenschutz und IT-Sicherheit.
Für wen ist die Arbeit relevant?
Die Arbeit richtet sich an Fachkräfte in der Suchtkrankenhilfe, insbesondere in Adaptionseinrichtungen, IT-Verantwortliche in sozialen Organisationen, sowie Studierende und Wissenschaftler im Bereich Sozialarbeit und Sozialinformatik.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln finden Sie im Inhaltsverzeichnis der Arbeit, welches die einzelnen Kapitel und Unterkapitel mit ihren jeweiligen Themen beschreibt.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen der IT-Einführung in einem sensiblen Bereich wie der Suchtkrankenhilfe, insbesondere die Aspekte Datenschutz, IT-Sicherheit und die Notwendigkeit einer umfassenden Mitarbeiterschulung.
- Citar trabajo
- Thomas Postel (Autor), 2006, Einführung von computergestützten Dokumentationssystemen in der stationären Suchtkrankenhilfe am Beispiel von Adaptionseinrichtungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65673