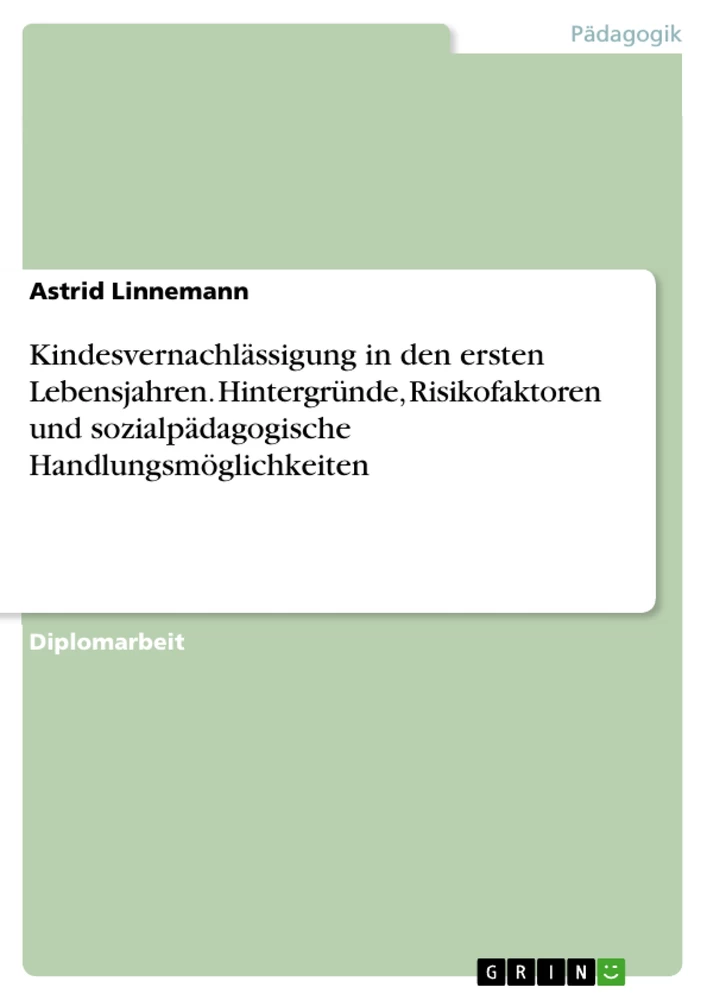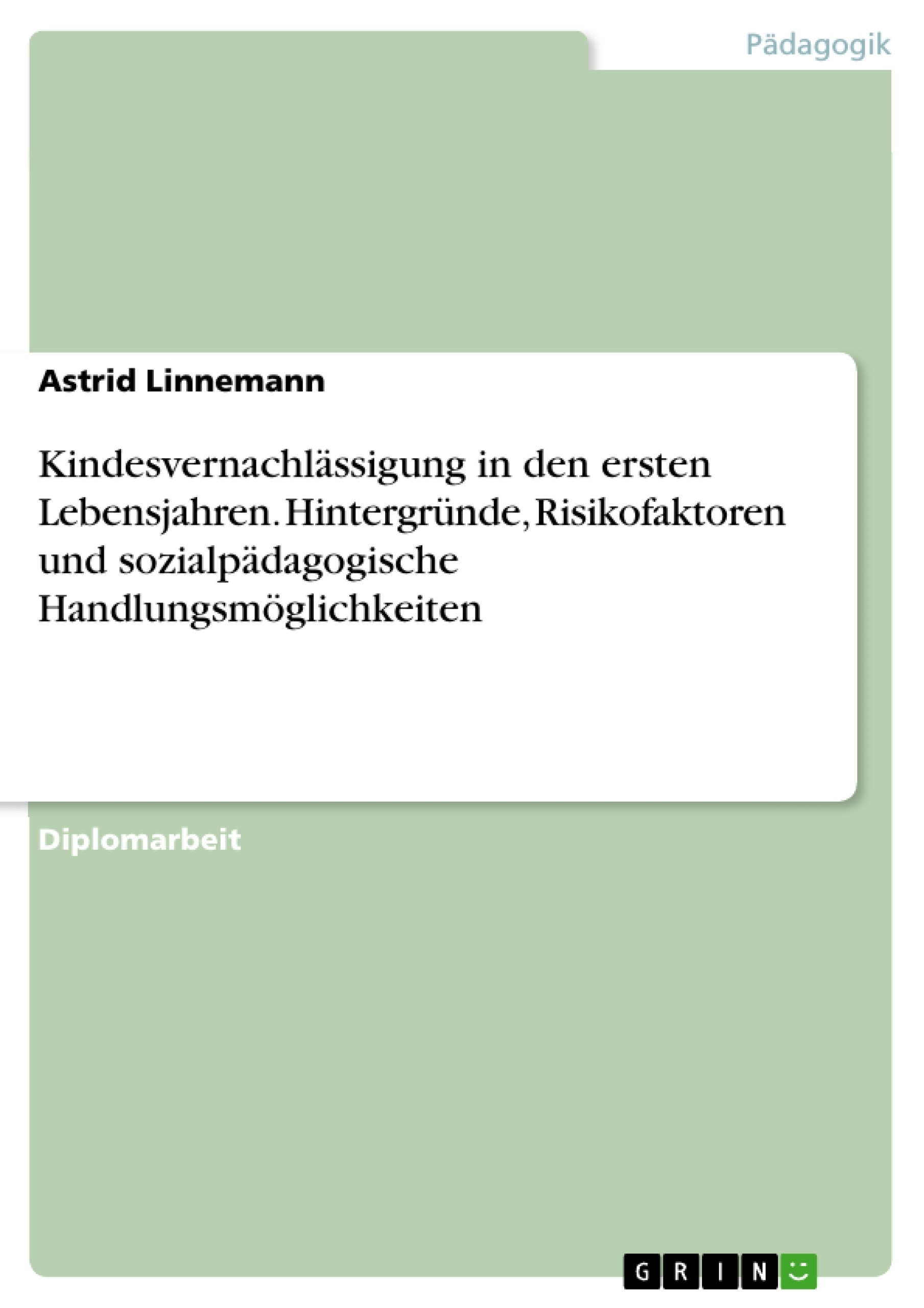„Ein Kind verhungert - mitten in Deutschland
Es schien, als habe es das Mädchen Jessica nie gegeben. Nach dem schrecklichen Tod fragen sich alle: Warum haben weder Nachbarn noch Ämter die Tragödie bemerkt?“(Süddeutsche Zeitung, 3.3.2005)
„Kinderleiche bei Stendal gefunden - tragischer Hungertod im Jerichower Land“(www.heute.de, 1.3.2006)
„Benjamin, Lydia, Tobias und Jessica sind verhungert und verdurstet - in Stendal, Osnabrück, Frankfurt/Oder und Hamburg. Die Schicksale dieser Kinder lassen aufschreien: warum hat niemand etwas getan?“(Westdeutsche Zeitung online, 26.7.2006)
Diese Meldungen haben gemeinsam, dass sie über die extremsten Fälle von Kindesvernachlässigung berichten. In der Regel ist die Vernachlässigung von Kindern ein wenig beachtetes Phänomen. In der öffentlichen Berichterstattung und der fachlichen Diskussion tritt sie häufig zugunsten der Kindesmisshandlung und des sexuellen Missbrauchs zurück. Kindesvernachlässigung ist ein schleichender Prozess, der häufig im Intimbereich der Familie verborgen bleibt. Auf Grund der relativen Unsichtbarkeit des Phänomens ist die Vernachlässigung kaum medienwirksam, es sei denn, ein Kind stirbt an den Folgen der Vernachlässigung. In diesen Fällen lösen die Schlagzeilen in den Zeitungen Gefühle von Wut, Trauer, Unverständnis und Ohnmacht in der Öffentlichkeit aus. Wie im Fall der siebenjährigen Jessica, die nach jahrelanger Qual in der elterlichen Wohnung verhungerte. Schnell sucht die Öffentlichkeit dann nach den Schuldigen der Tat und geht der Frage nach, warum Nachbarn und Ämter nichts Verdächtiges bemerkt haben. Dabei ist die Berichterstattung der Medien oftmals geprägt von einseitigen Schuldzuschreibungen an die„Horror-Mutter“(Bild-Zeitung, 31.8.2005) und nach den Ursachen der Kindesvernachlässigung wird kaum gefragt. In dieser Arbeit untersuche ich daher das Thema Kindesvernachlässigung in den ersten Lebensjahren in Bezug auf Hintergründe und Risikofaktoren dieser Gewaltform sowie hinsichtlich der sozialpädagogischen Handlungsmöglichkeiten, die
sich daraus ergeben. Ich gehe der Frage nach, wie es zur Vernachlässigung eines Kindes kommen kann und warum dieser Sachverhalt lange verborgen bleiben kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Begriffsdefinition und Abgrenzung zu anderen Gewaltformen
- 1.1 Formen der Kindesmisshandlung
- 1.1.1 Körperliche Misshandlung
- 1.1.2 Emotionale Misshandlung
- 1.1.3 Sexueller Missbrauch
- 1.2 Kindesvernachlässigung
- 1.2.1 Abgrenzung Kindesvernachlässigung – Kindesmisshandlung
- 1.3 Zusammenfassung
- 2. Kindliche Lebensbedürfnisse und Folgen von Bedürfnisrestriktionen
- 2.1 Kindliche Grundbedürfnisse
- 2.2 Bedürfnisse aus Sicht der Bindungstheorie und elterliche Fähigkeiten
- 2.3 Auswirkungen auf Bindungsqualität und Beziehung
- 2.4 Folgen früher Kindesvernachlässigung
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Hintergründe der Kindesvernachlässigung
- 3.1 Familie im Wandel
- 3.2 Soziale Isolation
- 3.3 Charakteristische Merkmale von Vernachlässigungsfamilien
- 3.3.1 Lebensgeschichtliche Erfahrungen der Eltern
- 3.3.2 Familiäre Beziehungsmuster
- 3.3.3 Struktur und Dynamik in Vernachlässigungsfamilien
- 3.4 Zusammenfassung
- 4. Belastende Lebensumstände als Kontextfaktoren der Kindesvernachlässigung
- 4.1 Risikofaktoren für Kindesvernachlässigung
- 4.2 Ergebnisse der Forschung
- 4.2.1 Die Mannheimer Risiko-Kinder-Studie
- 4.2.2 Studie des Instituts für soziale Arbeit (ISA)
- 4.3 Darstellung ausgewählter Risikofaktoren
- 4.3.1 Kindliche Merkmale
- 4.3.2 Armut
- 4.3.3 Eltern mit Suchterkrankungen
- 4.3.4 Psychisch kranke Eltern
- 4.3.5 Jugendliche und allein erziehende Mütter
- 4.4 Schutzfaktoren der kindlichen Entwicklung
- 4.5 Zusammenfassung
- 5. Sozialpädagogische Handlungsmöglichkeiten
- 5.1 Prävention und Intervention im Rahmen des KJHG
- 5.2 Die Bedeutung frühzeitiger Prävention und Intervention
- 5.3 Beratung und Therapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
- 5.4 Darstellung ausgewählter früher Präventions- und Interventionsprogramme
- 5.4.1 Entwicklungspsychologische Beratung
- 5.4.2 Beratungsstelle „Menschenskind”
- 5.4.3 Familienhebammen
- 5.4.4 Frühförderprogramm „Opstapje - Schritt für Schritt”
- 5.5 Zusammenfassung
- III. Schlusswort
- Definition und Abgrenzung von Kindesvernachlässigung zu anderen Gewaltformen
- Kindliche Lebensbedürfnisse und die Folgen von Bedürfnisrestriktionen
- Hintergründe und Risikofaktoren der Kindesvernachlässigung
- Auswirkungen der Vernachlässigung auf die kindliche Entwicklung
- Sozialpädagogische Handlungsmöglichkeiten und Präventions- und Interventionsprogramme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Thema Kindesvernachlässigung in den ersten Lebensjahren. Der Fokus liegt dabei auf den Hintergründen und Risikofaktoren dieser Gewaltform sowie auf den sozialpädagogischen Handlungsmöglichkeiten. Die Arbeit befasst sich mit den Folgen der Vernachlässigung für die kindliche Entwicklung und zeigt die Bedeutung frühzeitiger Präventions- und Interventionsprogramme auf.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition von Kindesvernachlässigung und grenzt diese von anderen Formen der Kindesmisshandlung ab. Es werden die verschiedenen Formen der Kindesmisshandlung und die spezifischen Merkmale von Kindesvernachlässigung erläutert. Das zweite Kapitel behandelt die kindlichen Grundbedürfnisse und die Folgen von Bedürfnisrestriktionen. Es werden die Bedürfnisse aus Sicht der Bindungstheorie betrachtet und die Auswirkungen von Vernachlässigung auf die Bindungsqualität und die Beziehung zwischen Kind und Eltern beschrieben. Das dritte Kapitel untersucht die Hintergründe der Kindesvernachlässigung und betrachtet die familiäre Situation, die sozialen Verhältnisse sowie die Lebensgeschichten der Eltern. Das vierte Kapitel analysiert belastende Lebensumstände und Risikofaktoren, die mit Kindesvernachlässigung zusammenhängen. Es werden Studien vorgestellt, die Risikofaktoren identifizieren und die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung untersuchen. Das fünfte Kapitel widmet sich den sozialpädagogischen Handlungsmöglichkeiten und zeigt verschiedene Präventions- und Interventionsprogramme auf, die Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern unterstützen können.
Schlüsselwörter
Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Prävention, Intervention, Bindungstheorie, Grundbedürfnisse, sozialpädagogische Handlungsmöglichkeiten, Familienhebammen, Frühförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung?
Misshandlung ist eine aktive schädigende Handlung, während Vernachlässigung das Unterlassen notwendiger Fürsorge (Ernährung, Hygiene, Zuwendung) beschreibt.
Welche Risikofaktoren begünstigen Vernachlässigung?
Wichtige Faktoren sind Armut, soziale Isolation der Familie, Suchterkrankungen oder psychische Krankheiten der Eltern sowie eigene traumatische Erfahrungen der Erziehungsberechtigten.
Welche Folgen hat frühe Vernachlässigung für das Kind?
Sie kann zu schweren Bindungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen und im Extremfall zum Tod durch Verhungern oder Verdursten führen.
Welche sozialpädagogischen Hilfen gibt es?
Es gibt Programme wie Familienhebammen, Frühförderung („Opstapje“) und Beratungsstellen für Eltern mit Säuglingen, um frühzeitig zu intervenieren.
Warum bleibt Vernachlässigung oft lange unbemerkt?
Da sie ein schleichender Prozess im Intimbereich der Familie ist und weniger sichtbare Spuren hinterlässt als körperliche Gewalt, wird sie oft erst spät von Nachbarn oder Ämtern erkannt.
- Quote paper
- Diplom-Pädagogin Astrid Linnemann (Author), 2006, Kindesvernachlässigung in den ersten Lebensjahren. Hintergründe, Risikofaktoren und sozialpädagogische Handlungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65198