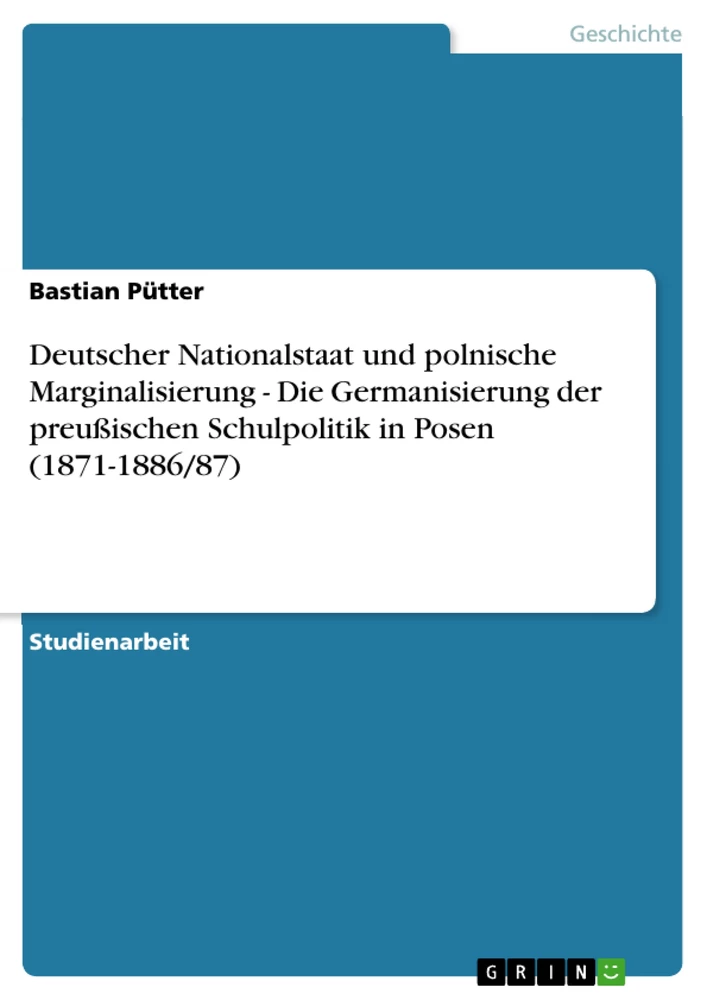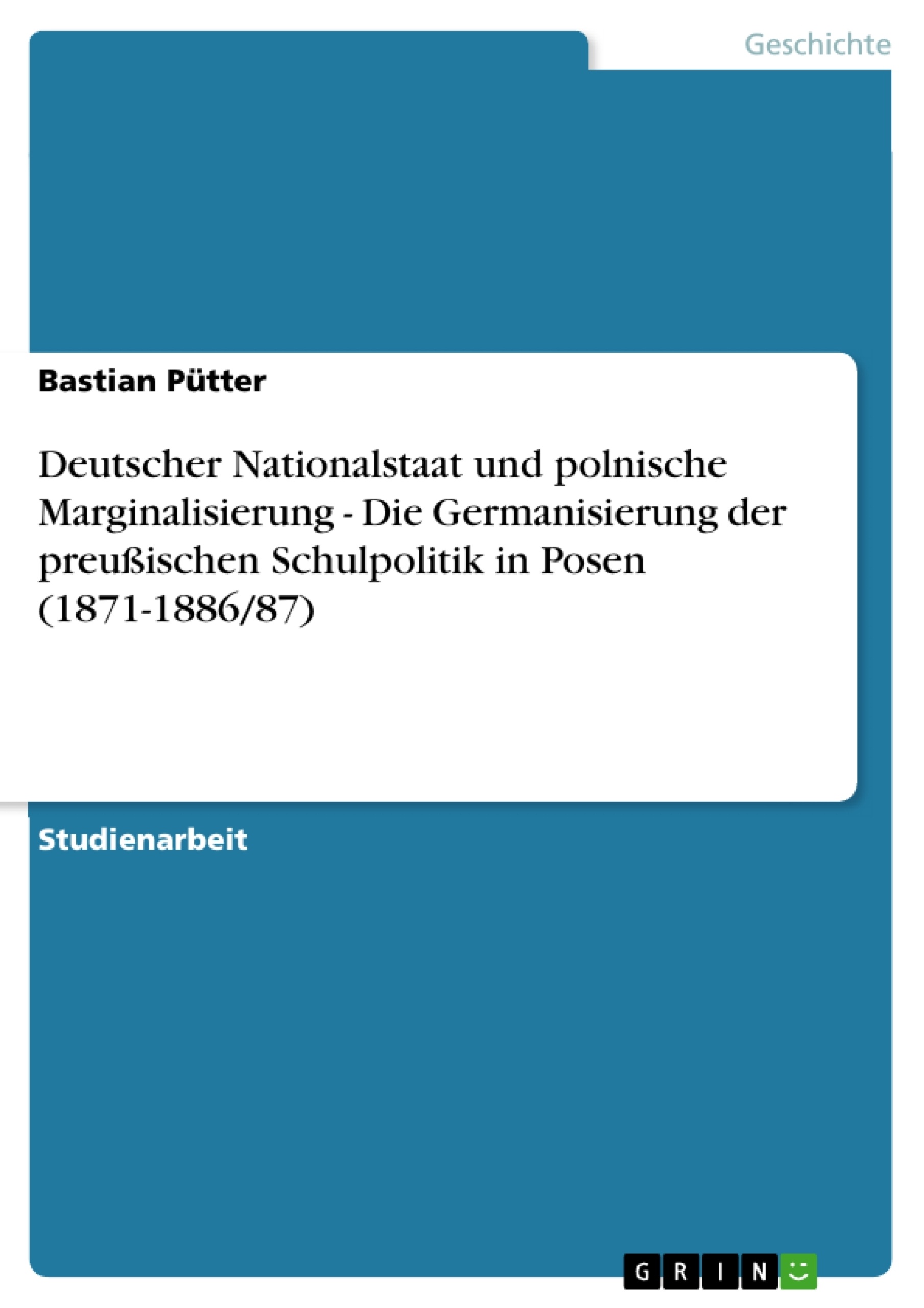Ungeachtet der Folgen des Ersten Weltkriegs und der Gegenwart der deutschen Republik beschreibt der deutsche Historiker Johannes Haller 1923 die `innere Nationenbildung´ folgendermaßen:
"Aus den alten und neuen Provinzen musste ein einheitliches Ganzes, aus Posenern, Sachsen, Westfalen und Rheinländern mussten Preußen gemacht werden. Das ist geschehen. Die preußische Beamtenschaft hat diese Aufgabe gelöst und glänzend gelöst. Nach einem Menschenalter schon war die Einheit so fest geworden, dass auch eine Revolution sie nicht mehr zu erschüttern vermochte."
Haller mag als Beispiel gelten für die teutozentrische Geschichtswissenschaft der Vor- und Nachkriegszeit mit den ihr typischen Verkennungen. Die Posener waren nicht Deutsche geworden. Und sie waren es auch bis 1918 nicht gewesen. Für die Provinz Posen ist bei relativ konstanten Zahlen zwischen 1831 und 1910 von einer polnischsprachigen Mehrheit zu sprechen.
Richtig ist die herausragende Rolle der preußischen Verwaltung am Versuch der Assimilierung der polnischsprachigen Bevölkerung in der Provinz Posen. Entscheidendes Mittel dazu sind Schul- und Sprachenpolitik.
Die vorliegende Arbeit versucht anhand der Situation in der Provinz Posen nachzuzeichnen, wie mit der Entstehung des deutschen Nationalstaats, bzw. des Nationalstaats- und Sprachenkonzepts eine polnischsprachige Minderheit erst entsteht und zum Ziel immer massiverer Eingriffe des preußischen Staates wird, der mittels der Sprachvermittlungsinstanz Schule die `Elimination´ dieser Minderheit betreibt.
Die Untersuchung erstreckt sich über die Jahre 1871 - 1886/87. Ziel ist es nachzuweisen, dass die aggressive Assimilierungspolitik gegenüber den Polen im Reichsgebiet nicht Ergebnis einer chauvinistisch pervertierten Großmachtpolitik unter Wilhelm II. ist, sondern angelegt in der Nationalstaatsidee selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen und Begriffsklärung
- Nationalstaat und Nation, Nationalismus, ethnische Minderheit
- Nation und Nationalsprache
- Die preußische Schul- und Sprachenpolitik in der Provinz Posen
- Schul- und Sprachenpolitik bis zur Reichsgründung
- 'Innere Reichsgründung und polnische Marginalisierung
- Das Schulaufsichtsgesetz als Grundlage preußischer Germanisierungspolitik
- Die „Allgemeinen Bestimmungen“ als schulpolitisches Grundlagenprogramm
- Der Spracherlass von 1873 als Praxis der Germanisierung
- „Deutsch lehren - Deutsch lernen“. Die Formulierung des Programms der Germanisierung des Schulwesens
- Der Auftakt des Nationalitätenkampfes 1886/87
- Antipolnische Sondergesetze
- Das Lehreranstellungsgesetz als Germanisierung der Schulverwaltung
- Folgebeschlüsse
- Begründungsmuster
- Ausblick: Schulpolitik und „Wilhelmismus“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die preußische Schul- und Sprachenpolitik in der Provinz Posen zwischen 1871 und 1886/87. Ziel ist es aufzuzeigen, wie die Entstehung des deutschen Nationalstaates und seine Sprachpolitik zur Entstehung einer polnischsprachigen Minderheit führten und zu immer massiveren Eingriffen des preußischen Staates führten, der mittels der Schule versuchte, diese Minderheit zu assimilieren. Die Arbeit argumentiert, dass diese aggressive Assimilierungspolitik nicht allein auf Wilhelm II. zurückzuführen ist, sondern in der Nationalstaatsidee selbst angelegt war.
- Die Entwicklung der preußischen Schul- und Sprachenpolitik in Posen.
- Der Zusammenhang zwischen Nationalstaatsidee und der Germanisierung der polnischen Bevölkerung.
- Die Rolle der Schule als Instrument der Assimilation.
- Analyse der Strategien und Methoden der preußischen Germanisierungspolitik.
- Die Entstehung und Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in Posen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen der Entstehung des deutschen Nationalstaats und der Germanisierung der preußischen Schulpolitik in Posen dar. Sie beleuchtet die Quellenlage und den Forschungsstand, wobei die teutozentrische Geschichtsschreibung kritisiert und die Bedeutung der preußischen Verwaltung bei der Assimilierung der polnischsprachigen Bevölkerung hervorgehoben wird. Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum 1871-1886/87 und zielt darauf ab, die aggressive Assimilierungspolitik als immanent in der Nationalstaatsidee selbst nachzuweisen, nicht nur als Ergebnis wilhelminischer Politik.
Theoretischer Rahmen und Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Nationalstaat, Nation, Nationalismus und ethnische Minderheit. Es diskutiert unterschiedliche Theorien der Nationsbildung, betont den konstruktiven Aspekt von Nationen und die Rolle von Sprache und Kultur bei der Definition nationaler Zugehörigkeit. Es werden verschiedene Modelle der nationalen Zugehörigkeit, wie ethnische und politische Begründungsmodelle, sowie die Konzepte der Staatsnation und Kulturnation, erläutert, um den theoretischen Rahmen für die Analyse der preußischen Politik in Posen zu legen.
Die preußische Schul- und Sprachenpolitik in der Provinz Posen: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der preußischen Schul- und Sprachenpolitik in Posen, beginnend vor der Reichsgründung bis zum Auftakt des Nationalitätenkampfes 1886/87. Es untersucht verschiedene Gesetze und Erlasse, wie das Schulaufsichtsgesetz und die „Allgemeinen Bestimmungen“, um die Strategien der Germanisierung aufzuzeigen. Die Rolle des Spracherlasses von 1873 und die Umsetzung des Programms „Deutsch lehren - Deutsch lernen“ werden im Detail untersucht, um die systematische Unterdrückung der polnischen Sprache und Kultur im Bildungssystem darzustellen. Der Abschnitt über den Nationalitätenkampf beleuchtet antipolnische Sondergesetze, das Lehreranstellungsgesetz und weitere Maßnahmen zur Germanisierung der Schulverwaltung. Der Ausblick verknüpft die dargestellte Schulpolitik mit dem „Wilhelmismus“ und seinen Implikationen.
Schlüsselwörter
Deutscher Nationalstaat, polnische Marginalisierung, preußische Schulpolitik, Germanisierung, Provinz Posen, Nationalitätenkampf, Assimilation, Sprachpolitik, Nationalismus, Nation, Ethnie.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Preußischen Schul- und Sprachenpolitik in der Provinz Posen (1871-1886/87)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die preußische Schul- und Sprachenpolitik in der Provinz Posen zwischen 1871 und 1886/87. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen der Entstehung des deutschen Nationalstaates und der daraus resultierenden Germanisierungspolitik, die zur Marginalisierung der polnischsprachigen Bevölkerung führte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte aufzeigen, wie die Entstehung des deutschen Nationalstaates und seine Sprachpolitik zur Entstehung einer polnischsprachigen Minderheit und zu massiven staatlichen Eingriffen führten. Sie argumentiert, dass die aggressive Assimilierungspolitik nicht nur auf Wilhelm II. zurückzuführen ist, sondern in der Nationalstaatsidee selbst angelegt war. Die Rolle der Schule als Instrument der Assimilation wird dabei besonders hervorgehoben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der preußischen Schul- und Sprachenpolitik in Posen, den Zusammenhang zwischen Nationalstaatsidee und Germanisierung, die Rolle der Schule als Instrument der Assimilation, die Strategien und Methoden der preußischen Germanisierungspolitik und die Entstehung und Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in Posen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Rahmen und der Begriffsklärung, ein Kapitel zur preußischen Schul- und Sprachenpolitik in Posen und ein Schlusskapitel mit Schlüsselbegriffen. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Das zweite Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Nationalstaat, Nation und Nationalismus. Das dritte Kapitel analysiert die Entwicklung der preußischen Schulpolitik in Posen mit Fokus auf Gesetzen und Erlassen, die die Germanisierung vorantrieben. Das vierte Kapitel fasst die wichtigsten Schlüsselbegriffe zusammen.
Welche konkreten Gesetze und Erlasse werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem das Schulaufsichtsgesetz, die „Allgemeinen Bestimmungen“, den Spracherlass von 1873 und das Lehreranstellungsgesetz. Diese werden als zentrale Instrumente der preußischen Germanisierungspolitik untersucht.
Welche Rolle spielte die Schule in der Germanisierungspolitik?
Die Schule spielte eine zentrale Rolle als Instrument der Assimilation. Durch die gezielte Durchsetzung der deutschen Sprache im Bildungssystem sollte die polnische Sprache und Kultur unterdrückt und die polnische Bevölkerung assimiliert werden.
Wie wird der Nationalitätenkampf in Posen dargestellt?
Der Nationalitätenkampf wird als Folge der aggressiven Assimilierungspolitik dargestellt, die durch antipolnische Sondergesetze und Maßnahmen zur Germanisierung der Schulverwaltung weiter verschärft wurde.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die aggressive Assimilierungspolitik in der preußischen Provinz Posen nicht nur ein Ergebnis wilhelminischer Politik war, sondern immanent in der Nationalstaatsidee selbst angelegt war. Die systematische Unterdrückung der polnischen Sprache und Kultur durch die preußische Schulpolitik trug maßgeblich zum Nationalitätenkonflikt bei.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Deutscher Nationalstaat, polnische Marginalisierung, preußische Schulpolitik, Germanisierung, Provinz Posen, Nationalitätenkampf, Assimilation, Sprachpolitik, Nationalismus, Nation, Ethnie.
- Quote paper
- Bastian Pütter (Author), 2002, Deutscher Nationalstaat und polnische Marginalisierung - Die Germanisierung der preußischen Schulpolitik in Posen (1871-1886/87), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64661