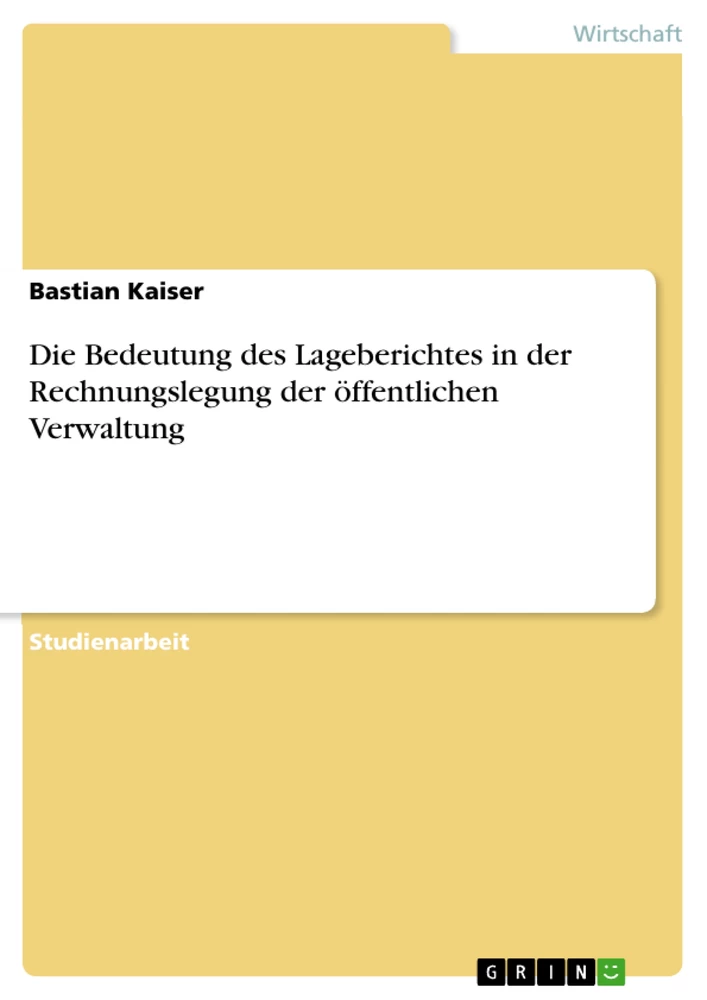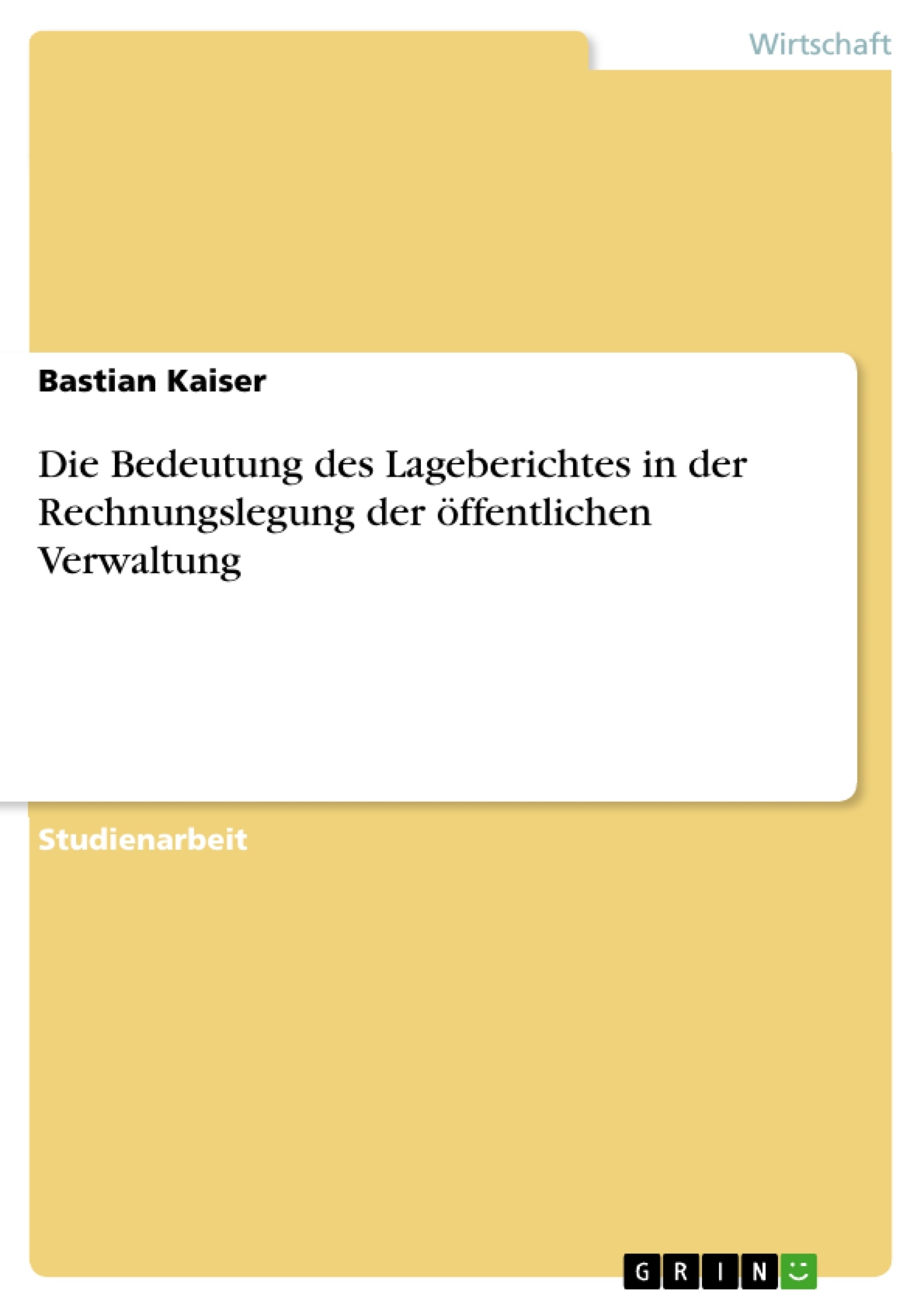Die öffentliche Verwaltung ist stets bemüht, ihre Prozesse und Vorgänge, wie jedes andere Unternehmen auch, zu verbessern und zu optimieren. In diesem Zuge erfolgte vor einigen Jahren der Beschluss, die in der Rechnungslegung angewandte Kameralistik abzuschaffen und durch ein neues Verfahren zu ersetzen. Dieses als doppelte Buchführung bekannte System, wird von den Firmen und Betrieben schon seit etlichen Jahren gebraucht, weshalb es in vielen Bereichen eine Vorbildsfunktion hat und der Staat sich ihm anpasst. Einen Ausschnitt der neuen Methode stellt der Lagebericht dar, welcher das Thema dieser Arbeit bestimmt. Seine Aufgabe besteht darin, dem Leser die Angaben aus dem Jahresabschluss zu erläutern und zu ergänzen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Unternehmenslage entsteht. Ähnlich wie bei dem gesamten Prozess der Übernahme eines solchen Systems stellt sich die Frage, wie die Vorgaben aus dem Gesetz und die bisherige Praxis im Umgang mit diesem Instrument auf die Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung angewandt werden kann. Um sich diesem Problem zu nähern, wird zunächst der Lagebericht in der Privatwirtschaft beschrieben und analysiert. Die darin enthalten Angaben stützen sich maßgeblich auf die Literatur von Karl Hengstberger, Wolfgang Tumfart 1 und Barbara Selch 2 , welche sich einschlägig dem Thema gewidmet haben. Bezogen auf die Verwaltung , welche abgesehen von einigen Ausnahmen, kaum Erfahrungen mit dem Lagebericht aufweisen kann, soll dann erörtert werden, welche inhaltlichen Schwerpunkte und welche Bedeutung ein Lagebericht im öffentlichen Sektor haben müsste und wo ähnliche Ziele wie in der Privatwirtschaft verfolgt werden. Außerdem gilt es zu klären, ob ein solcher Bericht im öffentlichen Sektor überhaupt angebracht ist oder ob es falsch ist, sich der Privatwirtschaft anzupassen. Aufgrund der Aktualität der Thematik ist bis dato nur wenig veröffentlichte Literatur vorhanden, weshalb viele Aussagen aus der Analyse und Bearbeitung eines Lageberichtes des Ministeriums für Bauen und Verkehr stammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung zum Thema und Problemstellung
- 2. Die Grundlagen zum Lagebericht
- 2.1 Die gesetzlichen Bestimmungen bei der Erstellung des Lageberichtes
- 2.1.1 Die Bestimmungen nach dem HGB
- 2.1.2 Die Bestimmungen nach den International Accounting Standards (IAS)
- 2.2 Die Funktion des Lageberichtes
- 2.3 Die Lageberichtsadressaten und deren Informationsinteressen
- 2.4 Die Grundsätze bei der Lageberichtserstattung
- 2.4.1 Der Grundsatz der Richtigkeit
- 2.4.2 Der Grundsatz der Vollständigkeit
- 2.4.3 Der Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
- 2.4.4 Der Grundsatz der Vorsicht
- 2.5 Der inhaltliche Aufbau des Lageberichtes
- 2.5.1 Der Wirtschaftsbericht
- 2.5.2 Der Risikobericht
- 2.5.3 Der Nachtragsbericht
- 2.5.4 Der Prognosebericht
- 2.5.5 Der Forschungsbericht
- 2.5.6 Der Zweigniederlassungsbericht
- 3. Beispiele aus der freien Wirtschaft
- 4. Der Lagebericht in der Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung
- 4.1 Besonderheiten bei der Erstellung des Lageberichtes
- 4.2 Der Lagebericht der Wohnungsförderungsanstalt
- 5. Die Bedeutung und der Stellenwert des Lageberichtes im öffentlichen Sektor
- 6. Anmerkungen und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Lageberichts in der Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung. Ziel ist es, die Anwendung der aus der Privatwirtschaft bekannten Prinzipien des Lageberichts auf den öffentlichen Sektor zu analysieren und dessen Stellenwert zu bewerten. Dabei wird insbesondere die Frage beleuchtet, inwieweit eine Anpassung an private Rechnungslegungsmethoden sinnvoll und notwendig ist.
- Die gesetzlichen Grundlagen des Lageberichts (HGB, IAS)
- Der inhaltliche Aufbau und die Funktionen des Lageberichts
- Der Vergleich zwischen Lageberichten in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor
- Besonderheiten der Lageberichtserstellung in der öffentlichen Verwaltung
- Die Bedeutung des Lageberichts für Transparenz und Kontrolle im öffentlichen Sektor
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hinführung zum Thema und Problemstellung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Hintergrund der Arbeit und stellt die Problematik dar, wie die Prinzipien des Lageberichts, bereits etabliert in der Privatwirtschaft, in die Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung integriert werden können. Es werden die Schwierigkeiten und die Notwendigkeit einer solchen Integration herausgestellt und die Methodik der Arbeit umrissen.
2. Die Grundlagen zum Lagebericht: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die weitere Analyse. Es beschreibt ausführlich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellung von Lageberichten, sowohl nach dem HGB als auch nach IAS, einschließlich der Unterschiede in den Anforderungen an kleine, mittelgroße und große Kapitalgesellschaften. Es beleuchtet die Funktion des Lageberichts, seine Adressaten und die grundlegenden Prinzipien (Richtigkeit, Vollständigkeit, Klarheit, Vorsicht) seiner Erstellung, sowie den inhaltlichen Aufbau, inklusive der verschiedenen Berichtsteile wie Wirtschafts-, Risiko-, Nachtrags-, Prognose- und Forschungsbericht. Die Kapitel 2.1 bis 2.5 geben einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Erstellung von Lageberichten im Rahmen der privatwirtschaftlichen Rechnungslegung.
3. Beispiele aus der freien Wirtschaft: Dieses Kapitel (angedeutet im Ausgangstext, aber ohne detaillierte Zusammenfassung) würde konkrete Beispiele aus der Privatwirtschaft analysieren und aufzeigen, wie dort Lageberichte gestaltet und verwendet werden. Diese Beispiele würden als Vergleichsgrundlage für den öffentlichen Sektor dienen.
4. Der Lagebericht in der Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten der Lageberichtserstellung im öffentlichen Sektor. Es analysiert die Herausforderungen und Unterschiede im Vergleich zur Privatwirtschaft und untersucht mögliche Anwendungsmethoden und die praktische Umsetzung in der öffentlichen Verwaltung. Ein konkretes Beispiel wie der Lagebericht der Wohnungsförderungsanstalt wird hier vermutlich näher betrachtet und analysiert. Das Kapitel beleuchtet den Stellenwert des Lageberichts im Kontext der öffentlichen Finanzwirtschaft.
5. Die Bedeutung und der Stellenwert des Lageberichtes im öffentlichen Sektor: Dieses Kapitel (angedeutet im Ausgangstext, aber ohne detaillierte Zusammenfassung) würde die Bedeutung des Lageberichts für Transparenz, Rechenschaftspflicht und Kontrolle im öffentlichen Sektor bewerten. Es würde die Vorteile und Nachteile einer Übernahme des Modells aus der Privatwirtschaft diskutieren und den Stellenwert im Kontext der öffentlichen Finanzwirtschaft erörtern.
Schlüsselwörter
Lagebericht, öffentliche Verwaltung, Rechnungslegung, HGB, IAS, Transparenz, Kontrolle, öffentliche Finanzen, Jahresabschluss, Kameralistik, doppelte Buchführung, Risikobericht, Wirtschaftsbericht, Prognosebericht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Der Lagebericht in der öffentlichen Verwaltung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Lageberichts in der Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung. Sie analysiert die Anwendung von Prinzipien aus der Privatwirtschaft auf den öffentlichen Sektor und bewertet den Stellenwert des Lageberichts in diesem Kontext. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob und wie eine Anpassung an private Rechnungslegungsmethoden sinnvoll ist.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesetzlichen Grundlagen des Lageberichts (HGB und IAS), den inhaltlichen Aufbau und die Funktionen des Lageberichts, einen Vergleich zwischen Lageberichten in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor, Besonderheiten der Lageberichtserstellung im öffentlichen Sektor sowie die Bedeutung des Lageberichts für Transparenz und Kontrolle im öffentlichen Sektor.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel 1 führt in das Thema und die Problemstellung ein. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen des Lageberichts (gesetzliche Bestimmungen, Funktion, Adressaten, Grundsätze und Aufbau). Kapitel 3 (nur angedeutet) analysiert Beispiele aus der Privatwirtschaft. Kapitel 4 befasst sich mit dem Lagebericht in der öffentlichen Verwaltung, einschließlich Besonderheiten und einem Beispiel (Wohnungsförderungsanstalt). Kapitel 5 (nur angedeutet) bewertet die Bedeutung und den Stellenwert des Lageberichts im öffentlichen Sektor. Kapitel 6 bietet Anmerkungen und eine Schlussbetrachtung.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet die gesetzlichen Grundlagen des Lageberichts sowohl nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) als auch nach den International Accounting Standards (IAS). Sie berücksichtigt dabei die Unterschiede in den Anforderungen an Unternehmen verschiedener Größenordnungen.
Welche Bestandteile hat ein Lagebericht?
Der Lagebericht umfasst verschiedene Bestandteile, darunter den Wirtschaftsbericht, den Risikobericht, den Nachtragsbericht, den Prognosebericht, den Forschungsbericht und den Zweigniederlassungsbericht (je nach Anforderung).
Welche Besonderheiten weist der Lagebericht im öffentlichen Sektor auf?
Die Hausarbeit untersucht die Herausforderungen und Unterschiede bei der Erstellung von Lageberichten im öffentlichen Sektor im Vergleich zur Privatwirtschaft. Es werden mögliche Anwendungsmethoden und die praktische Umsetzung in der öffentlichen Verwaltung analysiert. Ein Beispiel hierfür ist der Lagebericht einer Wohnungsförderungsanstalt.
Welche Bedeutung hat der Lagebericht für den öffentlichen Sektor?
Der Lagebericht spielt eine wichtige Rolle für Transparenz, Rechenschaftspflicht und Kontrolle im öffentlichen Sektor. Die Hausarbeit diskutiert die Vorteile und Nachteile einer Übernahme des Modells aus der Privatwirtschaft und erörtert den Stellenwert im Kontext der öffentlichen Finanzwirtschaft.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Lagebericht, öffentliche Verwaltung, Rechnungslegung, HGB, IAS, Transparenz, Kontrolle, öffentliche Finanzen, Jahresabschluss, Kameralistik, doppelte Buchführung, Risikobericht, Wirtschaftsbericht, Prognosebericht.
- Citar trabajo
- Bastian Kaiser (Autor), 2006, Die Bedeutung des Lageberichtes in der Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64420