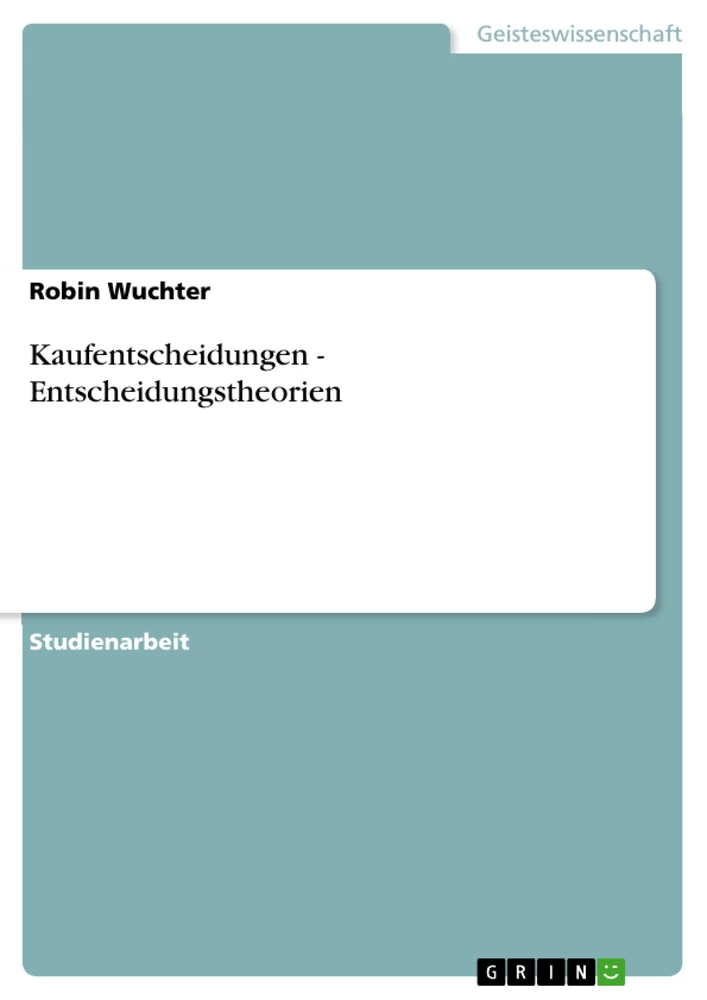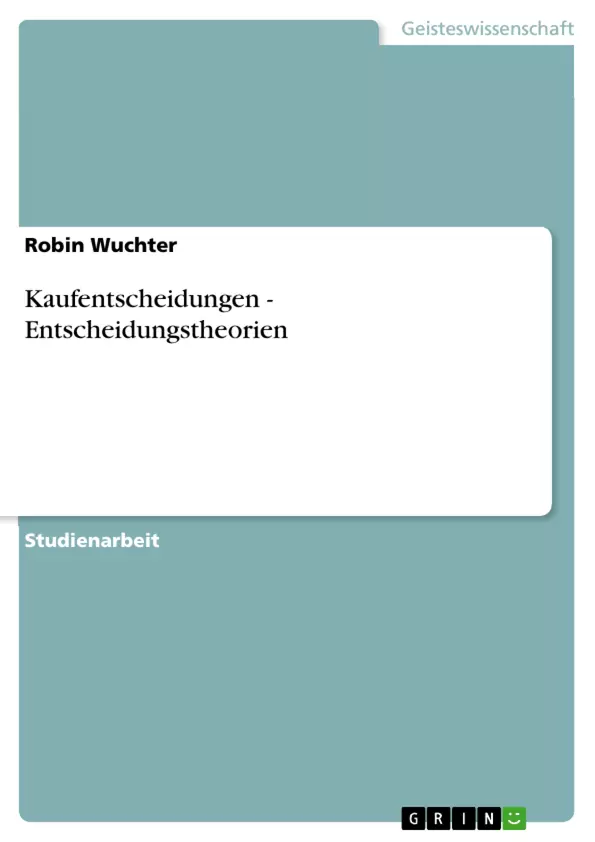Welcher Prozess führt dazu, dass beim Gang durch den Supermarkt ein Produkt gekauft wird, ein anderes jedoch nicht? Warum fällt es so viel schwerer, sich für ein neues Auto zu entscheiden, als für ein neues Waschmittel? In ihrer Arbeit über „Entscheidungs-Wellen“ unterteilen Lye, Shao, Rundle-Thiele und Fausnaugh (2005) die verschiedenen Entscheidungstheorien nach Forschungsansätzen in normative, behavioristische und naturalistische Theorien. Auf Grundlage dieser Unterscheidung sollen die verschiedenen Ansätze hier vorgestellt und diskutiert werden. Alle drei beschäftigen sich mit der Frage, welche Vorgänge im Organismus letztlich zur Kaufentscheidung führen, nähern sich dem Problem aber auf unterschiedliche Weise. Anhand wesentlicher Aspekte soll im Rahmen dieser Hausarbeit ein Eindruck über Stärken und Schwächen der Theorien und Modelle vermittelt werden. Die vorgenommene Kategorisierung soll dabei eine inhaltliche Entwicklung aufzeigen, die einen Ausblick auf die mögliche Richtung zukünftiger Forschungsarbeiten in der Entscheidungstheorie gibt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Normative Entscheidungstheorie
- Rationalität
- Dominanz
- Erwartungsnutzentheorie
- Behavioristische Entscheidungstheorie
- Deskriptiver Ansatz und Kritik an rational choice
- Entscheidungsziele
- Naturalistische Entscheidungstheorie
- Image-Theory
- Entscheidungsprozess
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den verschiedenen Entscheidungstheorien und deren Anwendung auf Kaufentscheidungen. Sie soll die drei Hauptströmungen - normative, behavioristische und naturalistische Entscheidungstheorie - vorstellen und diskutieren, indem sie die wichtigsten Aspekte und Modelle beleuchtet. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze zu vermitteln und einen Einblick in die Entwicklung der Entscheidungstheorie zu ermöglichen.
- Normative Entscheidungstheorie und ihre Grundlagen in der Rationalität
- Behavioristische Entscheidungstheorie und die Kritik am rational choice Modell
- Naturalistische Entscheidungstheorie und ihre Bedeutung für praktische Entscheidungsfindung
- Einflussfaktoren auf Kaufentscheidungen
- Entwicklungstrends in der Entscheidungstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Kaufentscheidungen und der verschiedenen Entscheidungstheorien ein. Es skizziert die drei Hauptströmungen - normative, behavioristische und naturalistische Entscheidungstheorie - und erläutert deren Herangehensweise an das Problem der Entscheidungsfindung.
Das zweite Kapitel widmet sich der normativen Entscheidungstheorie, die auf den Prinzipien der Rationalität und der Nutzenmaximierung basiert. Es diskutiert die Axiome des rational choice Modells, die Konzepte der prozeduralen Rationalität und der Konsistenz sowie verschiedene Dominanzkonzepte.
Das dritte Kapitel beleuchtet die behavioristische Entscheidungstheorie, die den deskriptiven Ansatz verfolgt und die Kritik am rational choice Modell aufzeigt. Es diskutiert die Entscheidungsziele und die Besonderheiten des menschlichen Entscheidungsverhaltens.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der naturalistischen Entscheidungstheorie, die sich auf die realen Entscheidungsprozesse in natürlichen Umgebungen konzentriert. Es stellt die Image-Theory vor und beleuchtet den Entscheidungsprozess in der Praxis.
Schlüsselwörter
Normative Entscheidungstheorie, Rationalität, Nutzenmaximierung, Homo Oeconomicus, Behavioristische Entscheidungstheorie, Deskriptiver Ansatz, Naturalistische Entscheidungstheorie, Image-Theory, Kaufentscheidungen, Entscheidungsprozesse, Entscheidungsziele, Forschungsansätze, Stärken und Schwächen, Entwicklungstrends.
Häufig gestellte Fragen
Was sind normative Entscheidungstheorien?
Diese Theorien basieren auf Rationalität und Nutzenmaximierung. Sie beschreiben, wie Entscheidungen getroffen werden sollten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen (Homo Oeconomicus).
Worin besteht die Kritik der behavioristischen Theorie am Rational Choice Modell?
Die behavioristische Theorie kritisiert, dass Menschen in der Realität oft nicht rein rational handeln, sondern von psychologischen Faktoren und begrenzter Informationsverarbeitung beeinflusst werden.
Was ist die naturalistische Entscheidungstheorie?
Sie konzentriert sich auf reale Entscheidungsprozesse in natürlichen Umgebungen und untersucht, wie Menschen unter Zeitdruck und mit unsicheren Informationen handeln.
Was besagt die 'Image-Theory' bei Kaufentscheidungen?
Die Image-Theory besagt, dass Menschen Entscheidungen danach treffen, ob eine Option zu ihren Werten, Zielen und Plänen (ihrem 'Image') passt, oft bevor eine detaillierte Nutzenanalyse stattfindet.
Warum fällt die Wahl eines Autos schwerer als die eines Waschmittels?
Dies liegt am unterschiedlichen Grad des 'Involvements'. Bei teuren, langlebigen Gütern ist das Risiko höher, was zu komplexeren und langwierigeren Entscheidungsprozessen führt.
- Quote paper
- Robin Wuchter (Author), 2006, Kaufentscheidungen - Entscheidungstheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64400