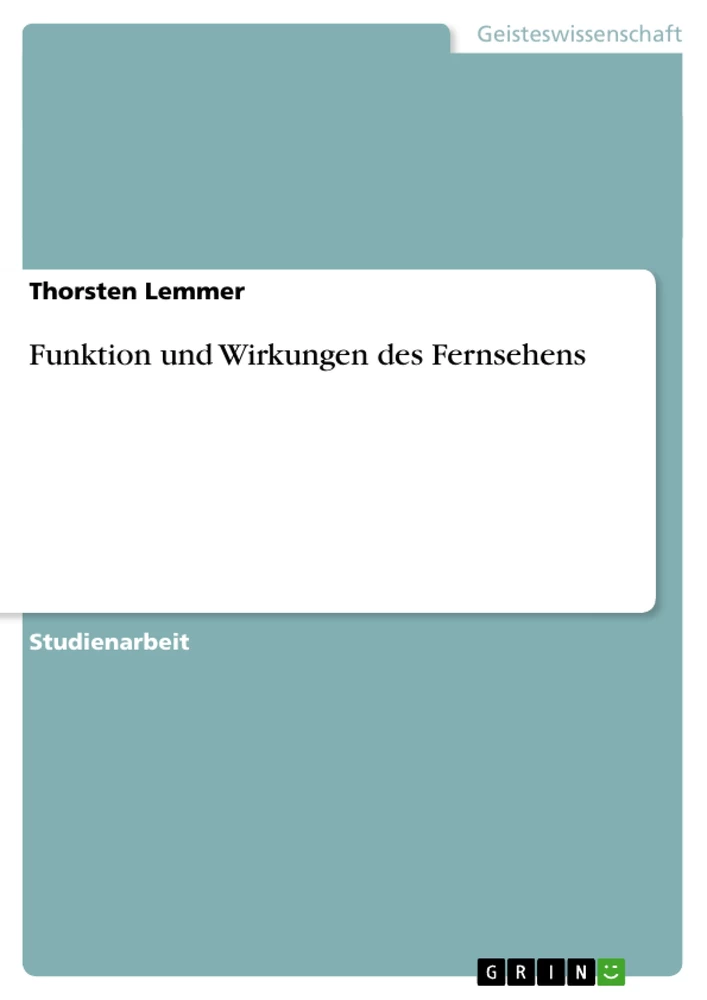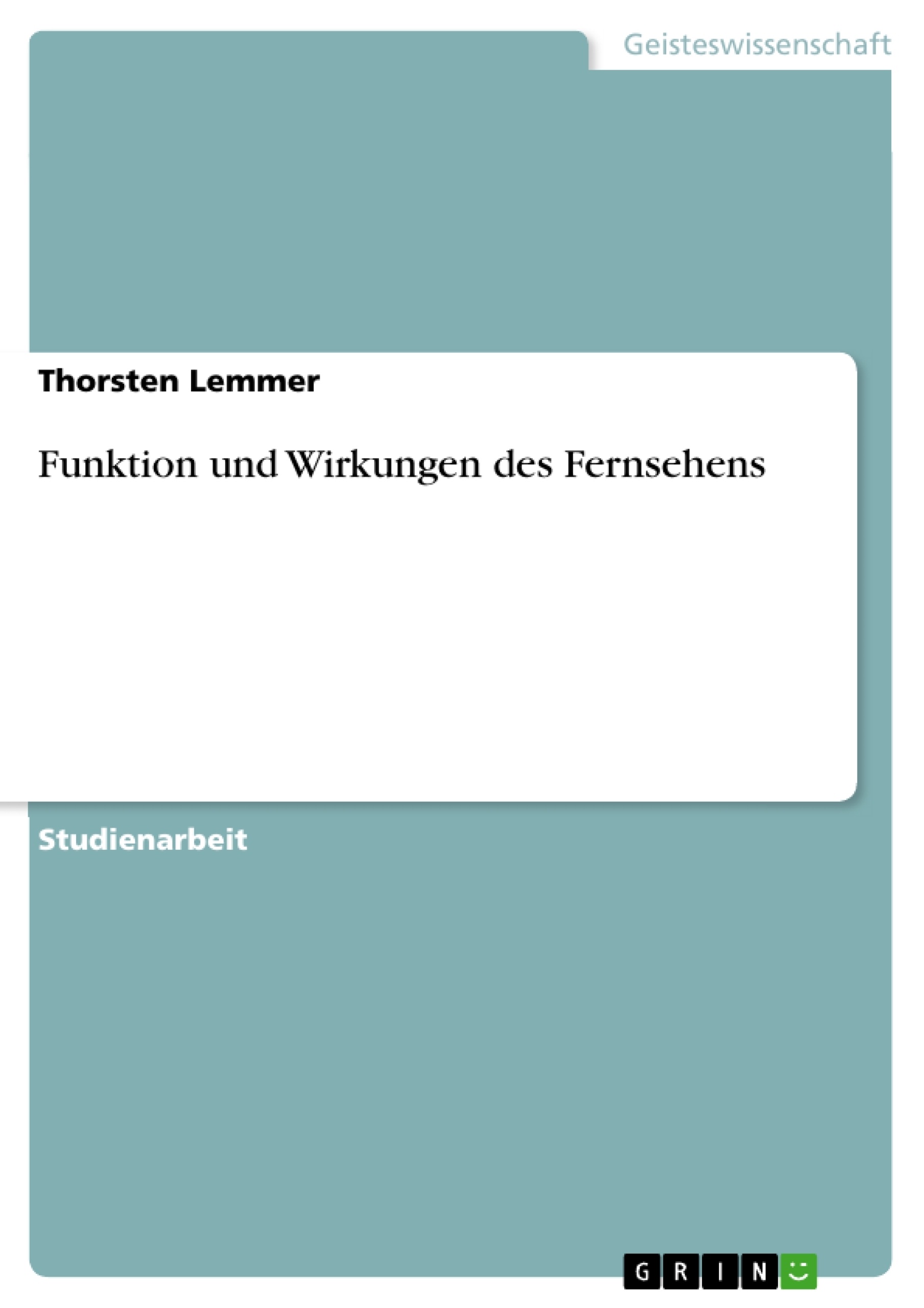W.Schramm erstellte 1979 eine 24-Stunden Uhr für die gesamte Geschichte der Menschheit bis heute. Dabei trat die Sprache um etwa 21.33 Uhr, die Schrift um 23.52 Uhr, das erste Buch um 23.59 und Rundfunk und Fernsehen um 13 Sekunden vor Mitternacht auf.
Obwohl es das Fernsehen im Vergleich zu anderen Massenmedien wie z.B. Buch oder Zeitung erst seit kurzer Zeit gibt, hat es doch unser Leben wie kein anderes Medium beeinflusst und verändert.
Sinn der vorliegenden Arbeit soll es nun sein, nach den tatsächlichen und vermuteten Veränderungen in unserem Leben zu fragen und verschiedene forschungsleitende Ansätze und Meinungen zu diesem Thema zu beleuchten. Die meisten dieser Grundsatzwerke sind in den 70er Jahren entstanden, einige auch in den 80er Jahren.
Keinesfalls ist diese Arbeit in der Lage, die Frage nach den Auswirkungen von Rundfunk und Fernsehen auf unser Leben zu beantworten: Eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf derartige Fragen gibt es (bislang) nicht , auch wenn es immer wieder Forscher/Autoren gibt, die in ihren Veröffentlichungen eine Antwort auf diese Frage zu geben versuchen, seien es dabei nun schädliche oder nützliche Auswirkungen, die sie dem Fernsehen zuschreiben.
Psychologie, Soziologie und Pädagogik haben in Bezug auf die Massenmedien, und schwerpunktmäßig auf das Fernsehen, da es das Medium ist, das die meisten Rezipienten erreicht, verschiedene Interessen:
Die Psychologie fragt mehr nach den kognitiven Vorgängen beim Rezipienten während der Informationsaufnahme-/verarbeitung (z.B. Behaltensleistung), während sich die Soziologie eher für den durch Massenmedien verursachten gesellschaftlichen Wandel bzw. für die Stabilisierung bestehender Verhältnisse interessiert (z.B. Gleichheit oder Ungleichheit durch Massenmedien). Die Pädagogik ist zum einen daran interessiert, sich das Fernsehen für ihre Zwecke nutzbar zu machen (z.B. Neue Medien i.d. Schule, Fernsehsendungen mit Lerneffekten), zum anderen wacht sie misstrauisch darüber, ob Einflüsse des Fernsehgebrauchs von Kindern und Jugendlichen nicht ihren eigenen Absichten zuwiderlaufen (z.B. Auswirkungen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf Kinder). Alle diese verschiedenen Interessen sind oft Gegenstand von eigenständigen Veröffentlichungen und Untersuchungen, die jeweils anderen Betrachtungsweise ausklammern.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Grundbegriffen
- Kommunikation
- Masse
- Massenkommunikation
- Ein Modell der Massenkommunikation
- Die gesellschaftliche Funktion der Massenkommunikation
- Die systemtheoretische Analyse von Massenkommunikation
- Die Funktionen der massenkommunikationsmittel
- Die Wirkungen der Massenmedien
- Das Medium ist die Botschaft - Marshall McLuhan
- Wirkungsforschung
- Die Kommunikatorvariablen
- Die Kanalvariable (Medium)
- Die Aussagevariablen
- Die Rezipientenvariablen
- Die agenda-setting"-Hypothese
- Gleichheit oder Ungleichheit durch Massenmedien
- Die Wissenskluft-Hypothese
- Sozialisation durch Fernsehen
- Nutzungsdauer und Funktion des Fernsehkonsums durch Kinder
- „Gute\" Fernsehwirkungen
- ,,Schlechte\" Fernsehwirkungen
- Der medienpädagogische Ausweg des elterlichen Medienkonzeptes
- Wir amüsieren uns zu Tode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Funktion und den Wirkungen des Fernsehens in unserer Gesellschaft. Sie analysiert verschiedene Forschungsansätze und Meinungen, um die tatsächlichen und vermuteten Veränderungen, die das Fernsehen im Laufe der Zeit bewirkt hat, zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf grundlegende Werke aus den 1970er und 1980er Jahren.
- Definition und Analyse von Grundbegriffen der Kommunikation und Massenkommunikation
- Die gesellschaftliche Funktion und Bedeutung der Massenkommunikation
- Die vielfältigen Wirkungen des Fernsehens auf die Gesellschaft und den Einzelnen
- Der Einfluss des Fernsehens auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
- Kritische Auseinandersetzung mit der Frage nach der Amüsiergesellschaft und deren Auswirkungen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung des Fernsehens in unserer Gesellschaft dar und erläutert den Zweck und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Fernsehens im Vergleich zu anderen Medien und betont die Relevanz der Forschung in den 1970er und 1980er Jahren.
- Definition von Grundbegriffen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Kommunikation, Masse und Massenkommunikation. Es analysiert verschiedene Modelle der Massenkommunikation, wie z.B. lineare Kommunikationsmodelle und transaktionale Modelle.
- Die gesellschaftliche Funktion der Massenkommunikation: Dieses Kapitel untersucht die systemtheoretische Analyse von Massenkommunikation und die verschiedenen Funktionen, die Massenmedien in der Gesellschaft erfüllen.
- Die Wirkungen der Massenmedien: Dieses Kapitel behandelt die Wirkungsforschung und die verschiedenen Faktoren, die den Einfluss von Massenmedien bestimmen, wie z.B. Kommunikatorvariablen, Kanalvariablen, Aussagevariablen und Rezipientenvariablen. Es stellt auch die "agenda-setting"-Hypothese vor.
- Gleichheit oder Ungleichheit durch Massenmedien: Dieses Kapitel widmet sich der Wissenskluft-Hypothese und untersucht, wie Massenmedien zur Gleichheit oder Ungleichheit in der Gesellschaft beitragen.
- Sozialisation durch Fernsehen: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung des Fernsehens für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Es analysiert die Nutzungsdauer und Funktion des Fernsehkonsums durch Kinder und beleuchtet sowohl "gute" als auch "schlechte" Fernsehwirkungen. Es stellt auch den medienpädagogischen Ausweg des elterlichen Medienkonzeptes vor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kommunikation, Massenkommunikation, Fernsehen, Medienwirkung, Sozialisation, Wissenskluft-Hypothese, Amüsiergesellschaft und medienpädagogische Konzepte. Sie befasst sich mit dem Einfluss des Fernsehens auf die Gesellschaft, den Einzelnen und insbesondere auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das Fernsehen bei der Sozialisation von Kindern?
Das Fernsehen beeinflusst die Wertebildung und das Lernen von Kindern. Die Forschung unterscheidet dabei zwischen förderlichen Bildungseffekten und negativen Einflüssen wie Gewaltrezeption.
Was besagt die Wissenskluft-Hypothese?
Die Hypothese besagt, dass Menschen mit höherem sozioökonomischem Status Informationen aus Massenmedien schneller aufnehmen als Menschen mit niedrigem Status, wodurch sich die Wissenskluft vergrößert.
Was bedeutet Marshall McLuhans Satz „Das Medium ist die Botschaft“?
McLuhan argumentiert, dass nicht nur der Inhalt, sondern die Form des Mediums selbst (z.B. das Fernsehen als technisches System) die Gesellschaft und das menschliche Denken grundlegend verändert.
Was ist die Agenda-Setting-Hypothese?
Sie besagt, dass Massenmedien zwar nicht vorschreiben, was wir denken sollen, aber sehr wohl bestimmen, über welche Themen (die Agenda) wir nachdenken und welche wir für wichtig halten.
Was wird unter der „Amüsiergesellschaft“ kritisiert?
In Anlehnung an Neil Postman („Wir amüsieren uns zu Tode“) wird kritisiert, dass die Tendenz des Fernsehens, alles als Unterhaltung darzustellen, die Fähigkeit zur ernsthaften öffentlichen Debatte untergräbt.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Lemmer (Autor:in), 2002, Funktion und Wirkungen des Fernsehens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6434