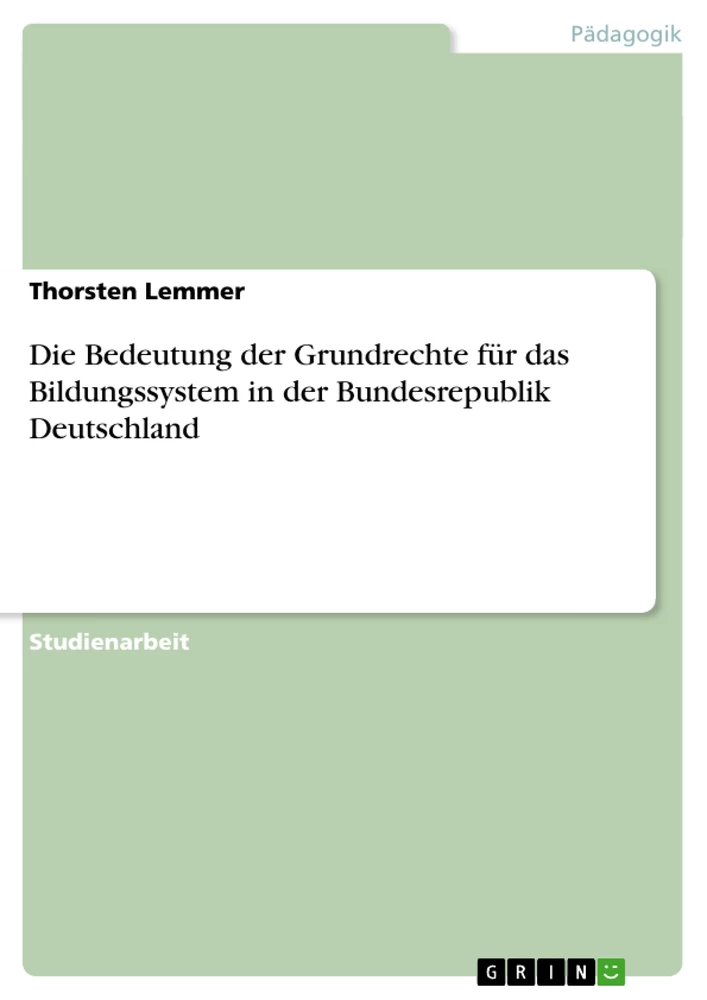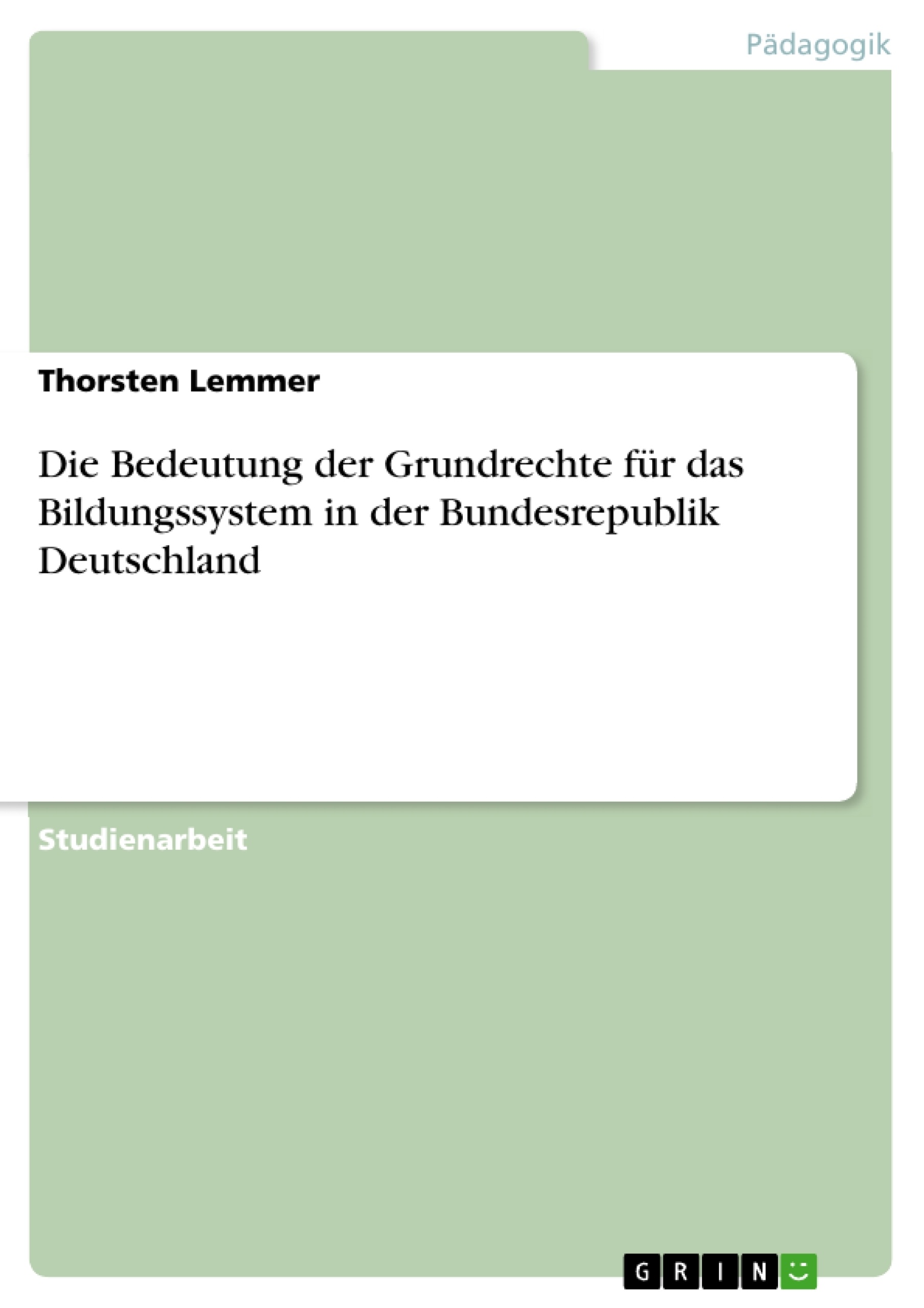Das Grundgesetz (GG) enthält nur wenige Artikel, die sich ausdrücklich mit dem Bildungswesen befassen. Trotzdem lassen sich die im GG niedergelegten Strukturen und Normen zu einer Bildungsverfassung der Bundesrepublik Deutschland zusammenfassen .
Im folgenden wird untersucht, welche Vorgaben das GG für die Entwicklung des Bildungswesens gemacht hat, wie diese umgesetzt wurden und welche Erscheinungen im Bildungswesen auf Grundrechtsnormen zurückzuführen sind.
Aus der Kulturhoheit der Länder in Verbindung mit dem Föderalismusgebot des GG erwachsen Spannungen, entstehen aber auch gewaltige Möglichkeiten für ein mannigfaltiges deutsches Bildungswesen.
Da Bildung nicht irgendwo, sondern eingebettet im staatlichen Gesamtzusammenhang stattfindet, muss sie sich auch an staatlichen Grundprinzipien orientieren. Bedeutet Bildung in der Staatsform der Demokratie nicht auch, daß demokratische Prinzipien wie Partizipation im Bildungswesen, und hier ist insbesondere die institutionalisierteste Form von Bildung, die Schule, angesprochen, Eingang finden müssen?
Wenn wir bisher von Bildungssystem und Bildungswesen gesprochen haben, so beziehen sich die folgenden Untersuchungen natürlich auf die ausgeformteste Institution von Bildung, auf das Schulsystem, das Schulwesen und die Schulverfassung.
Die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung ist also, welche Auswirkungen Grundrechtsbestimmungen auf das Schulwesen zeigen.
Da im Verlauf der Arbeit viel von Grundrechten und deren Bedeutung die Rede sein wird, ist ein Blick auf die allgemeinen Theorien von Grundrechtsverständnis nötig.
Grundrechte wurden bisher in liberalrechtsstaatlicher Gedankentradition als reine Abwehrrechte des Individuums gegen den Staat verstanden. Dieses Verständnis hat sich dahingehend gewandelt, als man nun Grundrechte vermehrt als soziale Teilhaberechte des Individuums am staatlichen Geschehen sieht. Teilhabe beinhaltet natürlich auch die Forderung an den Staat, Möglichkeiten zur Beteiligung zu schaffen, d.h. es entsteht ein Anspruch an den Staat, der sich durch sämtliche Bereiche gesellschaftlichen Lebens zieht und so natürlich auch den Schul- und Bildungsbereich berührt. Ohne das Verständnis der Grundrechte als Anspruchsrechte gegenüber dem Staat wären Diskussionen über Partizipation oder ein Recht auf Bildung sinnlos.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bestandsaufnahme des Bildungssystems nach 1945
- Die deutsche Schulverfassungstradition
- Reformposition der Nachkriegszeit
- Bedeutung der Grundrechte für das Bildungssystem
- Art. 6 GG, Art. 7 GG
- Art. 20 GG als Grundlage zur Differenzierung der Bildungsverfassung
- Allgemeine Grundrechte zur Differenzierung der Bildungsverfassung
- Das Grundrecht auf Bildung
- Grundrechtsbedingte Problemfelder
- Probleme vertikaler Gewaltenteilung - Bund contra Länder
- Die Partizipation der Bildungsakteure
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Grundgesetzes (GG) auf die Entwicklung des deutschen Bildungswesens. Sie analysiert, welche Vorgaben das GG für das Bildungssystem formuliert, wie diese umgesetzt wurden und welche Phänomene im Bildungssystem auf Grundrechtsnormen zurückzuführen sind. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Spannungen zwischen der Länderhoheit und dem föderalen Charakter des GG sowie auf der Bedeutung der Partizipation im Bildungsbereich.
- Die deutsche Schulverfassungstradition vor dem Hintergrund des Grundgesetzes
- Die Bedeutung von Art. 6 GG, Art. 7 GG und Art. 20 GG für das Bildungssystem
- Grundrechtsbedingte Problemfelder, insbesondere die vertikale Gewaltenteilung
- Das Grundrecht auf Bildung als soziales Teilhaberecht
- Partizipation der Bildungsakteure im Kontext des Grundgesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen von Grundrechtsbestimmungen auf das deutsche Schulwesen dar. Sie betont die Bedeutung des Grundgesetzes als Grundlage für das Bildungssystem und hebt die Ambivalenz zwischen der Länderhoheit und der Notwendigkeit einer einheitlichen Bildungspolitik hervor. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Grundrechten als nicht nur Abwehrrechte, sondern auch als Teilhaberechte, was die Diskussion um Partizipation und das Recht auf Bildung ermöglicht.
Bestandsaufnahme des Bildungssystems nach 1945: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des deutschen Bildungssystems nach 1945. Es analysiert die deutsche Schulverfassungstradition, beginnend mit dem preußischen Allgemeinen Landrecht, und zeigt die Entwicklung von einer kirchlich-ständischen zu einer staatlichen Schulorganisation auf. Die Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus werden kritisch beleuchtet, wobei die mangelnde Demokratisierung des Verhältnisses von Schule und Staat hervorgehoben wird. Der zweite Teil des Kapitels behandelt die Reformpositionen der Nachkriegszeit und den Einfluss der alliierten Direktiven auf die Bildungsreformen, im Kontext des Spannungsfelds zwischen den Zielen der Alliierten, der SPD und der CDU.
Schlüsselwörter
Grundgesetz, Bildungssystem, Grundrechte, Schulverfassung, Föderalismus, Länderhoheit, Partizipation, Bildungsgerechtigkeit, Demokratisierung, Nachkriegszeit, Reformpositionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Einfluss des Grundgesetzes auf das deutsche Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Grundgesetzes (GG) auf die Entwicklung des deutschen Bildungswesens. Sie analysiert die Vorgaben des GG für das Bildungssystem, deren Umsetzung und die auf Grundrechtsnormen zurückzuführenden Phänomene im Bildungssystem. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Spannungen zwischen Länderhoheit und föderalem Charakter des GG sowie auf der Bedeutung der Partizipation im Bildungsbereich.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die deutsche Schulverfassungstradition im Kontext des Grundgesetzes, die Bedeutung von Art. 6 GG, Art. 7 GG und Art. 20 GG für das Bildungssystem, grundrechtsbedingte Problemfelder (insbesondere die vertikale Gewaltenteilung), das Grundrecht auf Bildung als soziales Teilhaberecht und die Partizipation der Bildungsakteure im Kontext des Grundgesetzes.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Bestandsaufnahme des Bildungssystems nach 1945 (inkl. deutscher Schulverfassungstradition und Reformpositionen der Nachkriegszeit), ein Kapitel zur Bedeutung der Grundrechte für das Bildungssystem (inkl. Art. 6 GG, Art. 7 GG und Art. 20 GG), ein Kapitel zu grundrechtsbedingten Problemfeldern (insbesondere vertikale Gewaltenteilung und Partizipation der Bildungsakteure) und eine Zusammenfassung.
Wie wird die Bestandsaufnahme des Bildungssystems nach 1945 dargestellt?
Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des deutschen Bildungssystems nach 1945. Es analysiert die deutsche Schulverfassungstradition, beginnend mit dem preußischen Allgemeinen Landrecht, und zeigt die Entwicklung von einer kirchlich-ständischen zu einer staatlichen Schulorganisation auf. Die Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus werden kritisch beleuchtet, und der Einfluss der alliierten Direktiven auf die Bildungsreformen im Kontext des Spannungsfelds zwischen den Zielen der Alliierten, der SPD und der CDU wird betrachtet.
Welche Rolle spielen die Grundrechte im Kontext des Bildungssystems?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Art. 6 GG, Art. 7 GG und Art. 20 GG für das Bildungssystem. Sie analysiert, wie diese Grundrechte die Entwicklung und Gestaltung des Bildungssystems beeinflussen und welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Das Grundrecht auf Bildung als soziales Teilhaberecht wird ebenfalls thematisiert.
Welche grundrechtsbedingten Problemfelder werden angesprochen?
Ein Schwerpunkt liegt auf den Spannungen zwischen Länderhoheit und Bund im Bildungssystem (vertikale Gewaltenteilung). Weiterhin wird die Bedeutung und die Herausforderungen der Partizipation der verschiedenen Akteure im Bildungsbereich im Kontext des Grundgesetzes diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Grundgesetz, Bildungssystem, Grundrechte, Schulverfassung, Föderalismus, Länderhoheit, Partizipation, Bildungsgerechtigkeit, Demokratisierung, Nachkriegszeit, Reformpositionen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach den Auswirkungen von Grundrechtsbestimmungen auf das deutsche Schulwesen. Die Arbeit untersucht, wie das Grundgesetz als Grundlage für das Bildungssystem wirkt und die Ambivalenz zwischen Länderhoheit und der Notwendigkeit einer einheitlichen Bildungspolitik beleuchtet.
- Quote paper
- Thorsten Lemmer (Author), 2002, Die Bedeutung der Grundrechte für das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6401