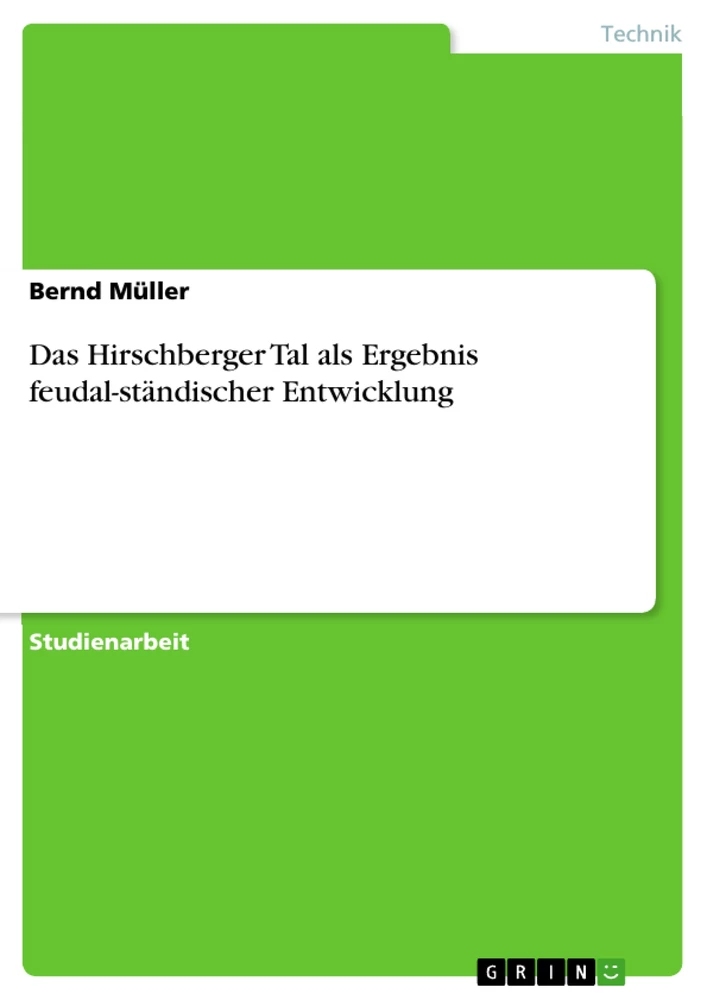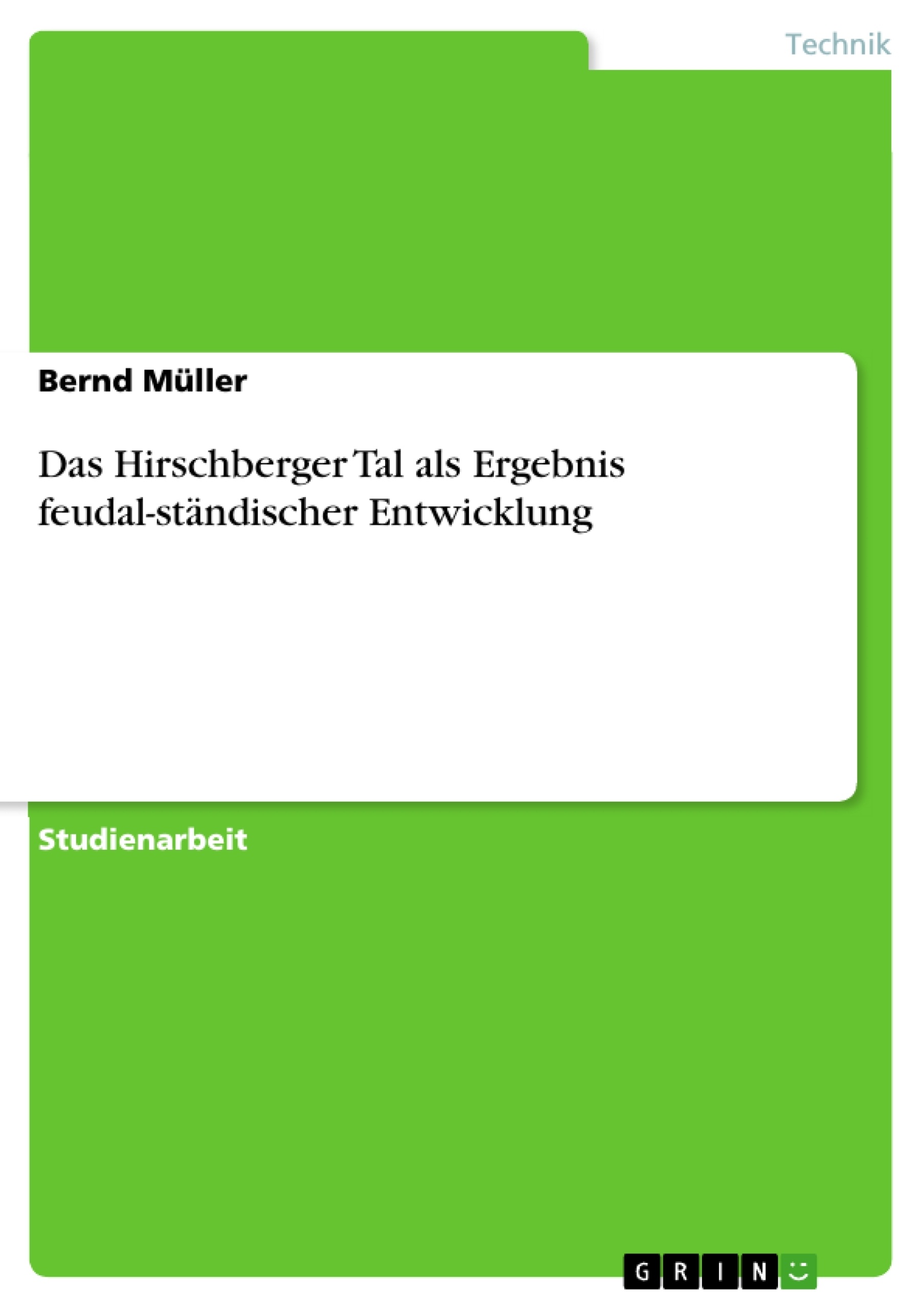Das Hirschberger Tal, wie wir es heute vorfinden, ist eine mit der Zeit gewachsene Kulturlandschaft. Als Talkessel wird es einerseits vom Riesengebirge und andererseits von der Schneekoppe begrenzt. Neben der natürlichen Schönheit hat es eine Fülle kultureller Sehenswürdigkeiten zu bieten. Mit einer kaum zu findenden hohen Dichte an Burgen und Landschlössern ist es ein ausgezeichnetes Denkmal kultureller Entwicklung. Damit ist das Hirschberger Tal als Kulturlandschaft durch die Natur und durch die menschliche Kultur geprägt. Das eine ohne das andere ist nicht zu denken - nur das Zusammentreffen beider Faktoren bestimmt das letztendliche Aussehen einer Kulturlandschaft. Die natürliche Entwicklung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Hier soll ein Beitrag zum Verständnis des Werdens der kulturellen Seite geleistet werden. Wovon ist dieses aber abhängig? Manche meinen, die Ideen, die Politik usw. bestimmen als Letztes das kulturelle Werden. Dem ist aber nicht so. Das Denken, und damit die Ideen oder die Politik, resultiert aus einer materiellen Grundlage. Das Leben des Menschen, wie er sein Leben produziert und reproduziert, bestimmt seine Ideen und Vorstellungen. Was hier untersucht werden soll, sind die sozio-ökonomischen Grundlagen dieser Entwicklung. Sie zu betrachten, bringt ein Ergebnis hervor, dass sehr umfangreich ist. Anfangs war geplant, in jener Zeit anzufangen, als die slawischen Stämme damit begannen, in das Gebiet vorzustoßen, welches von den Germanen verlassen wurde. Bis zur Elbe drangen die slawischen Stämme vor und herrschten dort über einige Jahrhunderte. Vom gesellschaftlichen Aufbau unterschieden sie sich kaum von den abgezogenen Germanen. Ihre Gesellschaft glich anfangs einer großen Genossenschaft 1 , in der es kein Privateigentum am Hauptproduktionsmittel - Grund und Boden - gab. Brandrodungen schufen die Grundlagen für den Getreideanbau und die Viehzucht. Eine hohe Mobilität war für die Stämme notwendig, da die Böden schnell erschöpften. Im Gegensatz zu den leichten Böden Großpolens und Masowiens konnte in Schlesien, in dem schwere und fruchtbare Böden vorherrschten, erst mit dem sich langsam verbreitenden eisenbeschlagenen Pflug beackert werden. Anfangs wurde in Einzelhöfen oder kleinen Hofgemeinschaften gesiedelt. Mit dem Anwachsen der Produktivkräfte geriet aber diese Einrichtung ins Wanken. Privateigentum am Grund und Boden und eine zunehmende soziale Differenzierung entstand. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzer Historischer Abriss
- Fronhof
- Das Lehnwesen
- Fehdewesen und Rittertum
- Die Burg
- Die Entstehung der Stadt
- Die Landwirtschaft in Preußen
- Die Schichtung der ländlichen Gesellschaft (um 1800)
- Der gutsbesitzende Adel
- Die Pächter
- Die Bauern und die ländlichen Unterschichten
- Die „Bauernbefreiung“
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sozio-ökonomischen Grundlagen der kulturellen Entwicklung des Hirschberger Tals. Sie zielt darauf ab, zu verstehen, wie die materielle Grundlage des Lebens, die Produktion und Reproduktion, die Ideen und die politische Entwicklung beeinflusst haben.
- Die Entstehung des Feudalismus aus der Urgemeinschaft
- Die Rolle der Ostkolonisation in der Entwicklung des Hirschberger Tals
- Die Bedeutung der Fronhöfe für die Entstehung von Burgen und Gutshöfen
- Die soziale Schichtung der ländlichen Gesellschaft in Preußen um 1800
- Die Folgen der „Bauernbefreiung“ für das Hirschberger Tal
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Hirschberger Tal als Kulturlandschaft vor und hebt die Bedeutung der sozio-ökonomischen Grundlagen für die kulturelle Entwicklung hervor.
- Kurzer Historischer Abriss: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Hirschberger Tals von der Urgemeinschaft bis zur Entstehung der Stadt. Es werden die Themen Fronhof, Lehnwesen, Fehdewesen und Rittertum sowie die Bedeutung der Burg behandelt.
- Die Landwirtschaft in Preußen: Dieses Kapitel beschreibt die Schichtung der ländlichen Gesellschaft in Preußen um 1800, die Rolle des Adels, der Pächter und der Bauern sowie die Auswirkungen der „Bauernbefreiung“.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Hirschberger Tal, Kulturlandschaft, Feudalismus, Ostkolonisation, Fronhof, Gutshof, soziale Schichtung, ländliche Gesellschaft, Bauernbefreiung, Preußen.
Häufig gestellte Fragen
Was prägt das Hirschberger Tal als Kulturlandschaft?
Das Tal ist durch das Zusammenspiel von natürlicher Schönheit (Riesengebirge, Schneekoppe) und einer hohen Dichte an kulturellen Denkmälern wie Burgen und Schlössern geprägt.
Welche sozio-ökonomischen Grundlagen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die materielle Basis der Entwicklung, beginnend bei der slawischen Besiedlung über den Feudalismus bis hin zur ländlichen Gesellschaft um 1800.
Was war die Bedeutung der Fronhöfe?
Fronhöfe bildeten die Keimzelle für die Entstehung von Burgen und späteren Gutshöfen im Zuge der feudal-ständischen Entwicklung.
Wie war die ländliche Gesellschaft in Preußen um 1800 geschichtet?
Die Schichtung bestand aus dem gutsbesitzenden Adel, den Pächtern sowie den Bauern und ländlichen Unterschichten.
Welchen Einfluss hatte die "Bauernbefreiung" auf das Hirschberger Tal?
Die Arbeit untersucht die Folgen dieser Reformen für die Landwirtschaft und die sozialen Strukturen in der Region.
Welche Rolle spielten die slawischen Stämme in der Frühzeit?
Slawische Stämme besiedelten das Gebiet nach dem Abzug der Germanen und etablierten anfangs genossenschaftliche Strukturen ohne Privateigentum an Grund und Boden.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Ingenieur Bernd Müller (Autor:in), 2006, Das Hirschberger Tal als Ergebnis feudal-ständischer Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64019