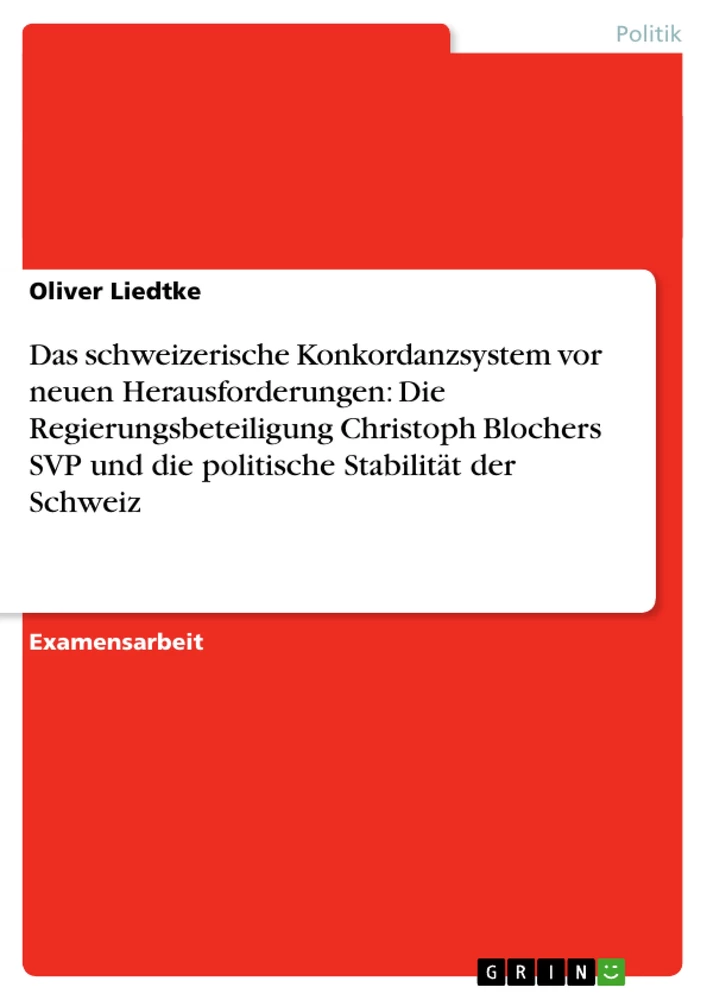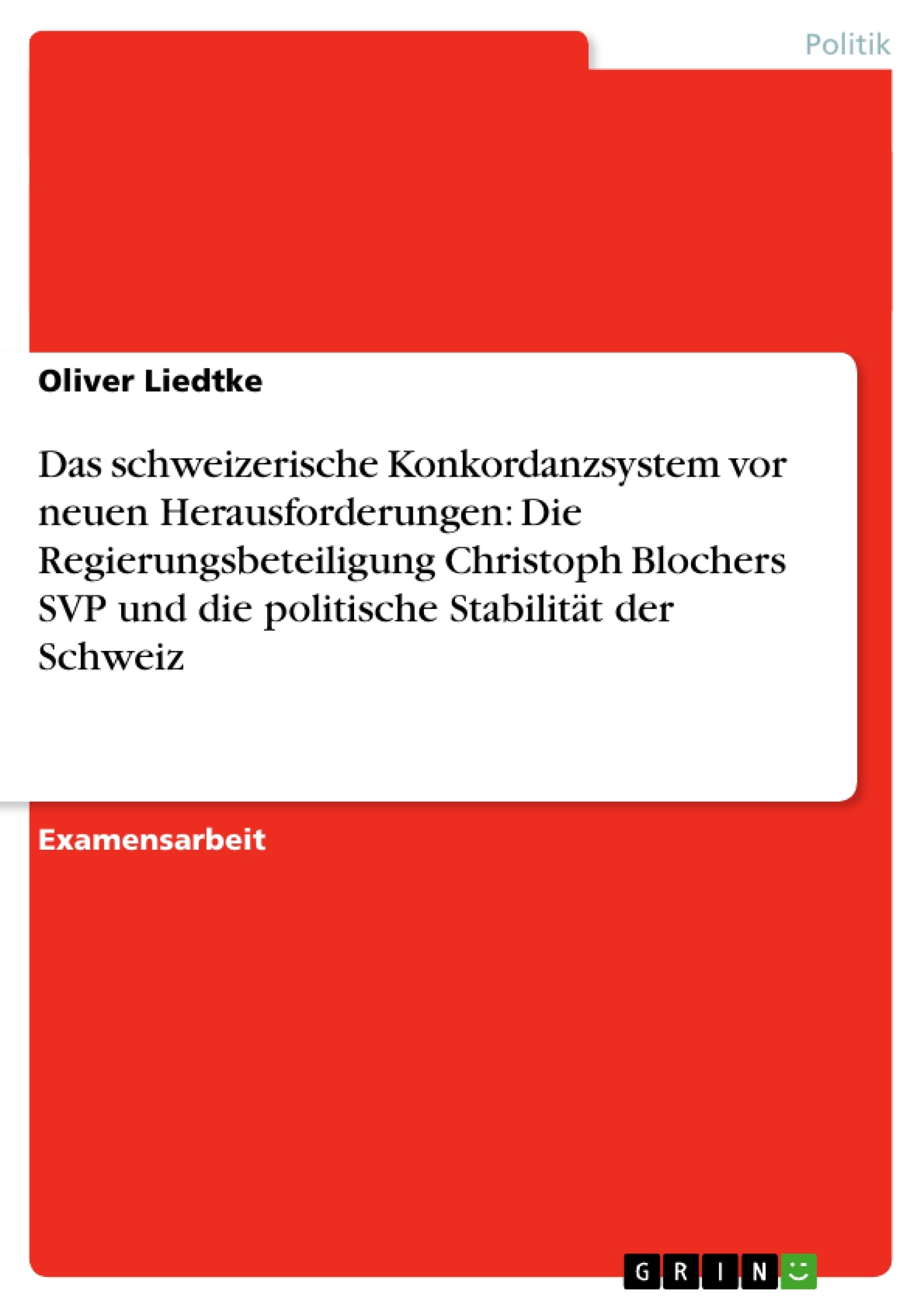Die politische Bühne der Schweiz wurde im Herbst 2003 mit der Wahl Christoph Blochers zum Bundesrat stark erschüttert. Vorausgegangen waren enorme Wählerzugewinne der rechts-konservativen SVP bei den Nationalratswahlen 1999 und 2003, in deren Folgte die Veränderung des seit 50 Jahren bestehenden Regierungsproporzes einherging. Aber welche Auswirkungen hat diese Veränderung auf das fein austarierte System der Regierungkonkordanz? Kann im Zusammenhang mit dieser formalen Modifikation der so geannten Zauberformel auch von einer inhaltlich veränderten Konkordanz gesprochen werden oder stehen die Weichen auf einen Umbau der Konkordanz? An diesen Fragen orientiert sich dieser Artikel, der sich auf die Theorie der Konkordanzdemokratie von Daalder und Lijphart stützt und drei zentrale Prinzipien für die schweizerische Regierungskonkordanz herausarbeitet: die inhaltlich-politische Integration der Bundesräte, das Zustandekommen von Aushandlungsprozessen als Entscheidungsfindung sowie die gemeinsame Vertretung der Regierungsposition nach außen. Ausgehend von einem hohen Erfüllungswert dieser drei Prinzipien, sind mit Blocher in der Regierung unterschidliche starke Veränderungen zu erkennen, die zusammengefasst auf eine Wandel der Regierungskonkordanz schließen lassen. Dieser Wandel erfordert jedoch eine äußerst differenzierte Bewertung. So kann diese Veränderung treffend als Neujustierung der schweizerischen Konkordanz bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemaufriss und Fragestellung
- 1.2 Gliederung der Arbeit und Materialien
- 1.3 Stand der Forschung
- 2. Das Verständnis von Konkordanz im politischen System
- 2.1 Grundzüge der Verhandlungsdemokratie
- 2.1.1 Die Idee der schweizerischen Konkordanz
- 2.1.2 Institutionalisierung der Konkordanz im politischen System
- 2.2 Identifikation geeigneter Konkordanzprinzipien und Bildung der Indikatoren
- 2.2.1 Konkordanzprinzip 1: Beteiligung der großen Parteien an der Regierung
- 2.2.2 Konkordanzprinzip 2: Entscheidungsfindung durch Aushandlungsprozesse
- 2.2.3 Konkordanzprinzip 3: Praktizierung von Kollegialität
- 2.3 Indikatorenbildung zu den Konkordanzprinzipien
- 3. Prüfung des empirischen Befunds anhand der Indikatoren
- 3.1 Indikator zum Konkordanzprinzip 1: Ausmaß der Diskussion um die Zauberformel
- 3.2 Indikatoren zum Konkordanzprinzip 2: Polarisierung der Positionen und Ausgewogenheit der Gesetzesvorlagen
- 3.2.1 Verortung von issues im politisch-ideologischen Raum
- 3.2.2 Totalrevision des Ausländergesetzes
- 3.2.2.1 Indikator 1: Polarisierung der Positionen
- 3.2.2.2 Indikator 2: Ausgewogenheit der Gesetzesvorlage
- 3.2.3 Das neue Asylgesetz
- 3.2.3.1 Indikator 1: Polarisierung der Positionen
- 3.2.3.2 Indikator 2: Ausgewogenheit der Gesetzesvorlage
- 3.2.4 Beitritt zum Schengen/Dublin-Abkommen
- 3.2.4.1 Indikator 1: Polarisierung der Positionen
- 3.2.4.2 Indikator 2: Ausgewogenheit der Vorlage
- 3.2.5 Das neue Partnerschaftsgesetz
- 3.2.5.1 Indikator 1: Polarisierung der Positionen
- 3.2.5.2 Indikator 2: Ausgewogenheit der Gesetzesvorlage
- 3.2.6 Zusammenfassung der Analyse der Indikatoren für das Konkordanzprinzip 2
- 3.3 Indikatoren zum Konkordanzprinzip 3: Intransparenz und öffentlich ausgetragener Dissens
- 3.3.1 Indikator 1: Ausmaß an Indiskretionen
- 3.3.2 Indikator 2: Ausmaß der Austragung von Dissens in der Öffentlichkeit
- 4. Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
- 4.1 Ergebnis der Prüfung des Prinzips 1: Beteiligung der großen Parteien an der Regierung
- 4.2 Ergebnis der Prüfung des Prinzips 2: Entscheidungsfindung durch Aushandlungsprozesse
- 4.3 Ergebnis der Prüfung des Prinzips 3: Praktizierung von Kollegialität
- 4.4 Beurteilung der Arbeitshypothese anhand des Stabilitätsdreiecks der Regierungskonkordanz
- 4.5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen für das schweizerische Konkordanzsystem durch die Regierungsbeteiligung der SVP unter Christoph Blocher und deren Auswirkungen auf die politische Stabilität der Schweiz. Die Analyse basiert auf der empirischen Prüfung von drei Konkordanzprinzipien.
- Beteiligung der großen Parteien an der Regierung
- Entscheidungsfindung durch Aushandlungsprozesse
- Praktizierung von Kollegialität
- Einfluss der SVP auf die politische Stabilität
- Analyse der Konkordanz im Kontext der Herausforderungen durch die SVP
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt den Problemaufriss und die Forschungsfrage, erläutert die methodische Vorgehensweise und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum schweizerischen Konkordanzsystem. Es wird die zentrale Fragestellung formuliert, wie sich die Regierungsbeteiligung der SVP unter Christoph Blocher auf die Stabilität des Konkordanzsystems auswirkt. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die verwendeten Materialien.
2. Das Verständnis von Konkordanz im politischen System: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Konkordanz im schweizerischen Kontext und beschreibt die Grundzüge der Verhandlungsdemokratie. Es werden die Prinzipien der Konkordanz – die Beteiligung großer Parteien an der Regierung, die Entscheidungsfindung durch Aushandlung und die Kollegialität – präzisiert und operationalisiert, um sie später empirisch prüfen zu können. Der Fokus liegt auf der Identifizierung geeigneter Indikatoren für die Messung dieser Prinzipien.
3. Prüfung des empirischen Befunds anhand der Indikatoren: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Analyse anhand der im vorherigen Kapitel entwickelten Indikatoren. Es werden verschiedene politische Entscheidungen und Gesetzesvorlagen (z.B. Totalrevision des Ausländergesetzes, Asylgesetz, Schengen/Dublin-Abkommen, Partnerschaftsgesetz) im Hinblick auf die drei Konkordanzprinzipien untersucht. Die Analyse fokussiert die Polarisierung der Positionen und die Ausgewogenheit der Gesetzesvorlagen sowie das Ausmaß an Intransparenz und öffentlich ausgetragenem Dissens.
Schlüsselwörter
Schweizer Konkordanzsystem, Verhandlungsdemokratie, Christoph Blocher, SVP, politische Stabilität, Regierungskonkordanz, Empirische Analyse, Indikatoren, Polarisierung, Aushandlungsprozesse, Kollegialität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Herausforderungen für das Schweizer Konkordanzsystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen für das schweizerische Konkordanzsystem durch die Regierungsbeteiligung der SVP unter Christoph Blocher und deren Auswirkungen auf die politische Stabilität der Schweiz. Die Analyse basiert auf der empirischen Prüfung von drei Konkordanzprinzipien.
Welche Konkordanzprinzipien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht folgende drei Konkordanzprinzipien: 1. Beteiligung der großen Parteien an der Regierung; 2. Entscheidungsfindung durch Aushandlungsprozesse; 3. Praktizierung von Kollegialität.
Wie wird die empirische Analyse durchgeführt?
Die empirische Analyse erfolgt anhand von Indikatoren, die für jedes der drei Konkordanzprinzipien entwickelt wurden. Verschiedene politische Entscheidungen und Gesetzesvorlagen (z.B. Totalrevision des Ausländergesetzes, Asylgesetz, Schengen/Dublin-Abkommen, Partnerschaftsgesetz) werden im Hinblick auf diese Indikatoren untersucht. Die Analyse fokussiert die Polarisierung der Positionen und die Ausgewogenheit der Gesetzesvorlagen sowie das Ausmaß an Intransparenz und öffentlich ausgetragenem Dissens.
Welche konkreten Gesetzesvorlagen werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Totalrevision des Ausländergesetzes, das neue Asylgesetz, den Beitritt zum Schengen/Dublin-Abkommen und das neue Partnerschaftsgesetz. Diese Vorlagen werden hinsichtlich Polarisierung der Positionen und Ausgewogenheit der Gesetzesvorlagen untersucht.
Welche Indikatoren werden verwendet?
Die Indikatoren umfassen beispielsweise das Ausmaß der Diskussion um die Zauberformel (Prinzip 1), die Polarisierung der Positionen und die Ausgewogenheit der Gesetzesvorlagen (Prinzip 2), sowie das Ausmaß an Indiskretionen und das Ausmaß der Austragung von Dissens in der Öffentlichkeit (Prinzip 3).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Konkordanz und der Entwicklung von Indikatoren, ein Kapitel zur empirischen Analyse anhand der Indikatoren und ein abschließendes Kapitel mit Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit. Die Einleitung umfasst den Problemaufriss, die Forschungsfrage, die methodische Vorgehensweise und einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Das zentrale Ergebnis ist eine Bewertung der Auswirkungen der Regierungsbeteiligung der SVP unter Christoph Blocher auf die Stabilität des Schweizer Konkordanzsystems, basierend auf der empirischen Prüfung der drei definierten Konkordanzprinzipien. Die Arbeit analysiert, inwiefern die drei Konkordanzprinzipien durch die SVP-Beteiligung beeinflusst wurden und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die politische Stabilität der Schweiz ziehen lassen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schweizer Konkordanzsystem, Verhandlungsdemokratie, Christoph Blocher, SVP, politische Stabilität, Regierungskonkordanz, Empirische Analyse, Indikatoren, Polarisierung, Aushandlungsprozesse, Kollegialität.
- Quote paper
- Oliver Liedtke (Author), 2005, Das schweizerische Konkordanzsystem vor neuen Herausforderungen: Die Regierungsbeteiligung Christoph Blochers SVP und die politische Stabilität der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63702