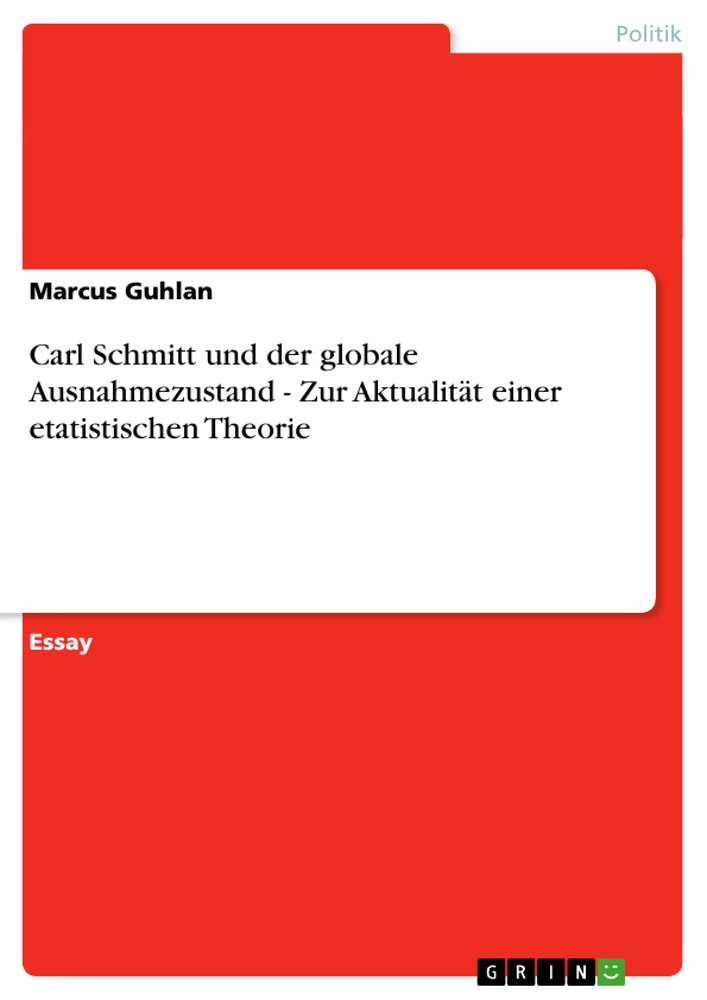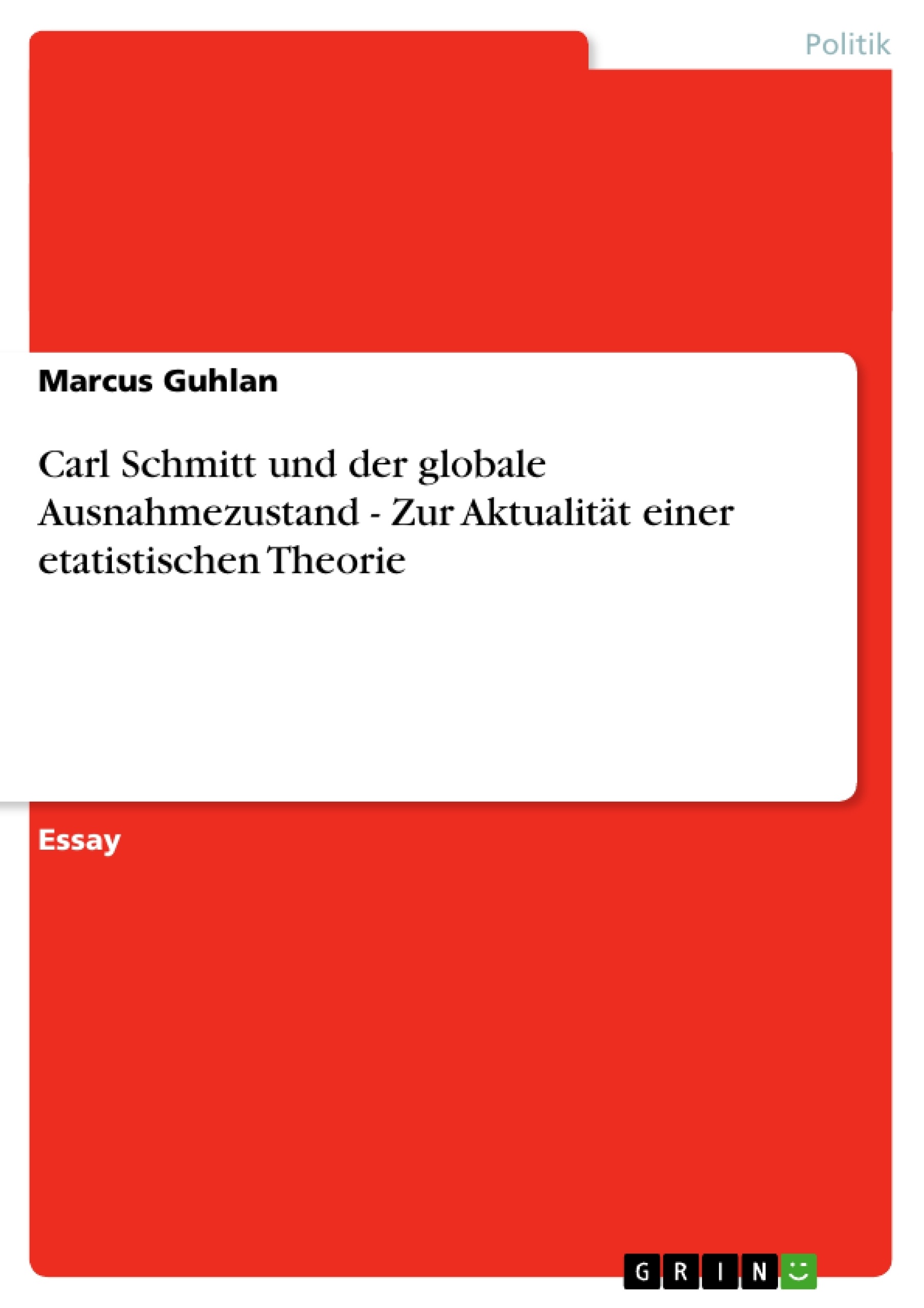Carl Schmitt war ein Meister der Begriffsbildung. Seine Fähigkeit polemische, sich ins Gedächtnis haftende Formeln an die Hand zu liefern, ist sicher ein, wenngleich nicht der entscheidende Umstand für die umfassende Rezeptionsgeschichte seines Oeuvres. Die Schmittsche Definition der Souveränität zählt zweifellos in diese Kategorie. „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ (Schmitt 1993, 11) Mit dieser einprägsamen Formulierung beginnt Schmitt seine Politische Theologie, um in dieser selbst festzustellen, dass Souveränität „nicht als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol“ zu definieren ist (Schmitt 1993, 19). Dieses Entscheidungsmonopol scheint in einer Welt im Ausnahmezustand eine Renaissance zu erfahren, gerade dann, wenn wir uns die Worte des amerikanischen Präsidenten Goerge W. Bush nach dem Anschlag vom 11. September 2001 ins Gedächtnis rufen, mit denen er - ganz in schmittscher Tradition - die Welt in Freund und Feind teilte. Und diese Bipolarität scheint sich nun immer mehr zu verfestigen. In diesem Widerhall scheint sich die Formel der Souveränität, wie sie Schmitt anbietet, als eine postmoderne Lehre zu etablieren, die uns wieder genauer beschäftige sollte. Es bietet sich also an, den Souveränitätsbegriff Schmitts näher zu beleuchten, um die bipolar politische Welt unserer Zeit besser zu verstehen. Der folgende Essay widmet sich dieser Aufgabe und projeziert die schmittsche Idee von Souveränität auf die politische Folie der Gegenwart. Doch soll zunächst auf einen speziellen ideengeschichtlichen Bezug in Schmitts Theorie eingegangen werden, zu dem sich Parallelen ziehen lassen, nämlich zum Souveränitätsbegriff bei Jean Bodin.
Die Souveränität wird von Bodin als „absolute und zeitlich unbegrenzte Gewalt“ verstanden (Bodin 1981, 205) . Es geht Bodin vorrangig darum, eine mit höchster Gewalt ausgestattete staatliche Autorität zu legitimieren, die imstande ist, die Bürgerkriegs-
situationen zu beenden und einen Friedens- und Rechtszustand - ohne Rücksicht auf die verschiedenen Meinungen darüber - herbeizuführen. Um die Parallelen zur Definition von Schmitt zu erkennen, ist es wichtig vor allem den Aspekt der Herstellung von Ordnung zu betrachten. Wenn wir uns den von Schmitt vorgeschlagenen Begriff des Ausnahmezustandes heranziehen - und als nichts anderes ist ein Bürgerkrieg zu begreifen -, so erkennen wir die schmittsche Formel durchaus wieder.
Inhaltsverzeichnis
- Die Souveränität bei Bodin und Schmitt
- Der Ausnahmezustand und die Freund-Feind-Unterscheidung
- Der Ausnahmezustand nach dem 11. September 2001
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert Carl Schmitts Theorie des Ausnahmezustands im Kontext der globalen Politik und beleuchtet die Aktualität seiner etatistischen Konzeption. Dabei wird die Bedeutung des Souveränitätsbegriffs bei Schmitt und Bodin herausgestellt und die Freund-Feind-Unterscheidung als prägender Faktor für das Politische untersucht.
- Die Souveränität als Entscheidungsmonopol im Ausnahmezustand
- Der Ausnahmezustand als Status quo, der Recht und Ordnung aussetzt
- Die Freund-Feind-Unterscheidung als Bedingung für das Politische
- Die Relevanz der schmittschen Theorie im Kontext der Ereignisse nach dem 11. September 2001
- Die Herausforderungen der globalen Politik im Lichte der schmittschen Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel vergleicht die Souveränitätsbegriffe von Jean Bodin und Carl Schmitt, wobei der Fokus auf der Legitimierung staatlicher Gewalt zur Herstellung von Ordnung liegt. Die Parallelen zwischen den beiden Denkern werden insbesondere im Hinblick auf den Ausnahmezustand und die Entbindung des Souveräns von rechtlichen Verpflichtungen im Notfall betrachtet.
- Das zweite Kapitel beleuchtet Schmitts Freund-Feind-Unterscheidung und ihre Verbindung zum Ausnahmezustand. Die Bedeutung des Kampfes als Bedingung für das Politische wird erläutert und die historische und aktuelle Relevanz dieser Unterscheidung im Kontext von Ideologien und globalen Konflikten diskutiert.
- Das dritte Kapitel untersucht die Aktualität der schmittschen Theorie im Lichte der Ereignisse nach dem 11. September 2001. Die Reaktion der US-amerikanischen Regierung auf die Anschläge von New York und die Deklaration des Ausnahmezustands werden als Beispiele für die schmittsche Konzeption der Souveränität analysiert. Die Kritik an der unilateralen Politik der USA und die Frage nach der Legitimität von militärischen Eingriffen im globalen Kontext werden aufgegriffen.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit den zentralen Begriffen der politischen Theorie von Carl Schmitt, insbesondere mit der Souveränität, dem Ausnahmezustand und der Freund-Feind-Unterscheidung. Wichtige Themen sind die Legitimierung staatlicher Gewalt, die Herausforderungen des globalen Konflikts, die Auswirkungen des 11. Septembers 2001 auf die politische Ordnung, die Kritik an unilateralen Interventionen und die Bedeutung des internationalen Rechts im Spannungsfeld zwischen nationaler und globaler Souveränität.
- Quote paper
- Marcus Guhlan (Author), 2006, Carl Schmitt und der globale Ausnahmezustand - Zur Aktualität einer etatistischen Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63010