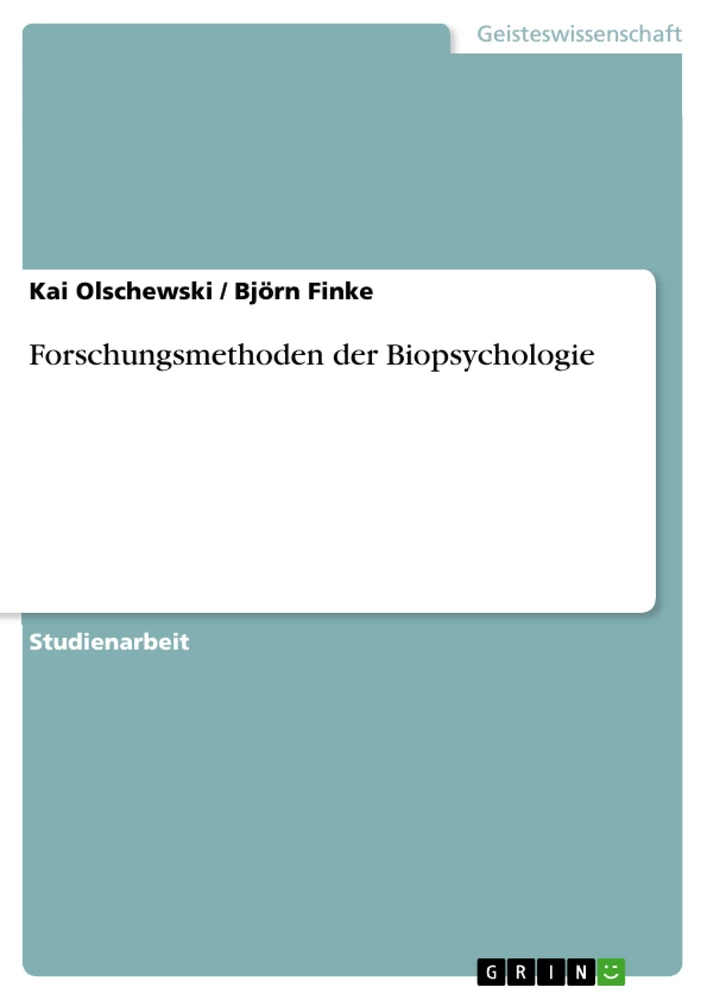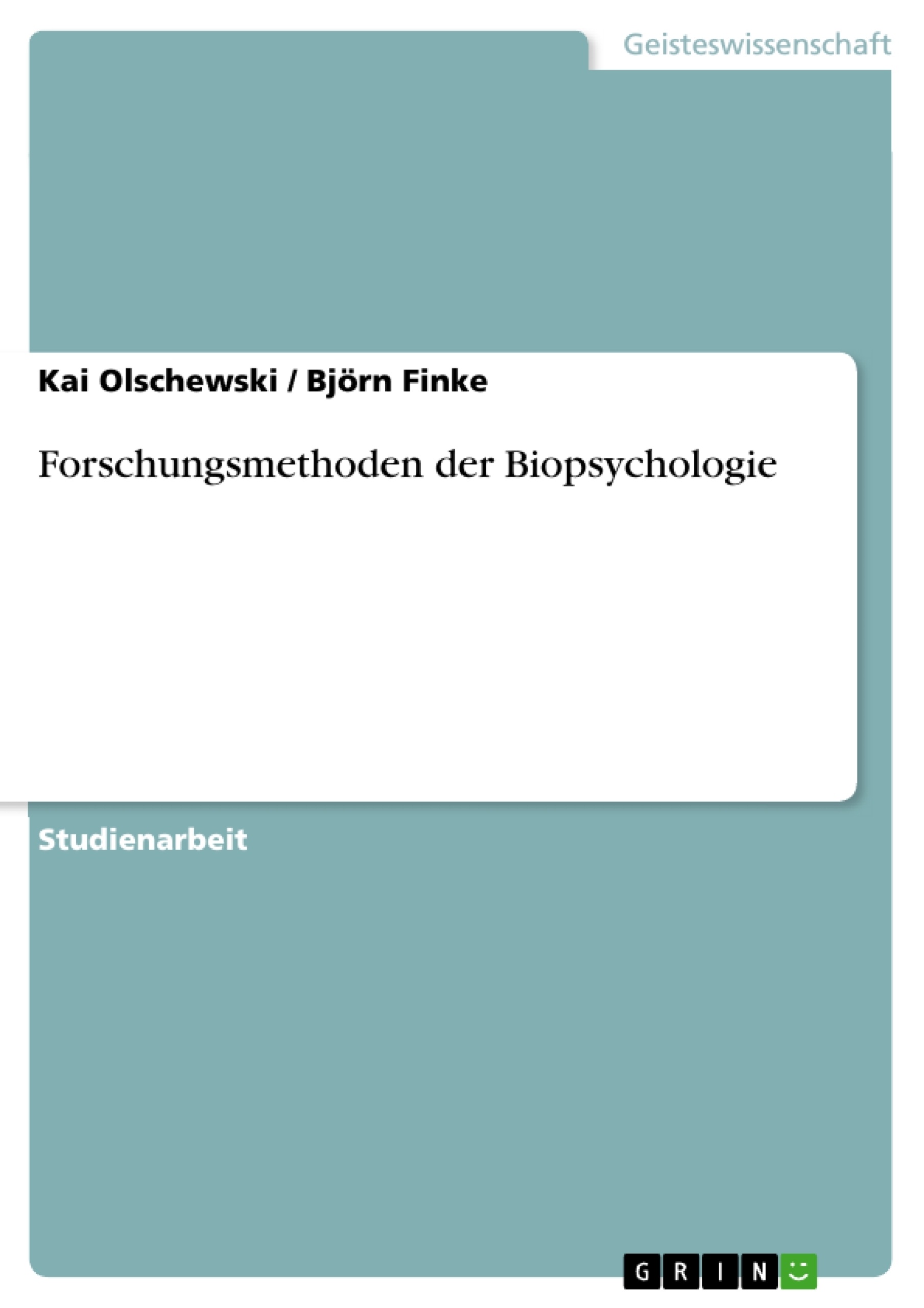Die Biopsychologie ist ein Teilgebiet der Neurowissenschaften. Sie untersucht Zusammenhänge zwischen biologischen Prozessen und Verhalten. Als interdisziplinäres Forschungsfeld stellt sie den biologischen Ansatz im Rahmen der psychologischen Forschung dar. Dabei bleibt festzuhalten, dass die Psychologie ihren zentralen Stellenwert behält. Gleichzeitig bedienen sich die Wissenschaftler dabei jedoch bei den biologischen Erklärungsansätzen für das Verhalten. Die Aufgabe der Biopsychologie ist also die Untersuchung und Darstellung der Interdependenzen physiologischer und psychologischer Abläufe unter psychologischen Gesichtspunkten. Dazu werden experimentelle und klinische Methoden sowie Instrumente angewendet. Die Biopsychologie ist eine sehr junge Forschungsdisziplin. Ihre Entstehung lässt sich nicht genau datieren, jedoch hat die Veröffentlichung des Buches „Organization of Behavior“ von D. O. Hebb im Jahre 1949 eine wichtige Rolle gespielt (vgl. Pinel 2001: 3). Darin wird erstmals eine umfassende Theorie entwickelt, wie komplexe psychologische Phänomene, wie zum Beispiel Gefühle und Erinnerungen, durch Gehirnaktivitäten hervorgerufen werden können. Als geradezu revolutionär wurde damals empfunden, dass psychologische Funktionen offenbar doch mit der Physiologie und Chemie des Gehirns erklärt werden können. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung der Biopsychologie noch in den Kinderschuhen steckt. Gleichzeitig entwickelt sie sich jedoch rasant weiter und macht immer wieder neue, wichtige Entdeckungen. Dabei ist die Biopsychologie eng an die Entwicklung neuer Forschungsmethoden gebunden (vgl. Birbaumer/ Schmidt: 1996: 4). Diese Forschungsmethoden sollen in den folgenden Kapiteln ausführlich gewürdigt und diskutiert werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die Biopsycholgie - Einleitung und Definition
- Vorstellung der biopsychologischen Methoden
- Teilgebiete der Biopsychologie und konvergierende Forschung
- Physiologische Psychologie
- Psychopharmakologie
- Neuropsychologie
- Psychophysiologie
- Kognitive Neurowissenschaft
- Vergleichende Psychologie
- Bildgebende Verfahren – Die Abbildung des lebenden menschlichen Gehirns
- Röntgenaufnahmen – grundlegende Basis und Begrenztheit der Methode
- Computertomographie
- Kernspintomographie
- Positronen-Emissions-Tomographie
- Funktionelle Kernspintomographie
- Nichtinvasive Messung psychophysiologischer Aktivität
- Elektro-Encephalographie
- Entstehung/Geschichte
- Funktionsweise des EEG
- Wellenformen des EEG
- Das ereigniskorrelierende Potential
- Wozu dient das EEG
- Elektromyographie
- Das Nadel EMG
- Das Oberflächen EMG
- Nutzen der Elektromyographie
- Elektro-Encephalographie
- Elektrooculographie / Videooculographie
- Elektrodermale Aktivität
- Kardiovaskuläre Aktivität
- Tierversuche - der wissenschaftliche Betrug
- Tierversuche - ein Resümee
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Biopsychologie, einem Teilgebiet der Neurowissenschaften, das die Zusammenhänge zwischen biologischen Prozessen und Verhalten untersucht. Sie gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Forschungsmethoden der Biopsychologie, insbesondere bildgebende Verfahren und nichtinvasive Messungen der psychophysiologischen Aktivität. Die Arbeit betrachtet auch die verschiedenen Teilgebiete der Biopsychologie und die Bedeutung konvergierender Forschung.
- Die Einführung in die Biopsychologie und ihre Forschungsmethoden
- Die Darstellung verschiedener bildgebender Verfahren zur Abbildung des Gehirns
- Die Erläuterung nichtinvasiver Messmethoden der psychophysiologischen Aktivität
- Die Untersuchung der Teilgebiete der Biopsychologie und ihrer konvergierenden Forschung
- Der kritische Blick auf Tierversuche in der Biopsychologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Biopsychologie ein und definiert ihre Forschungsgegenstände und -methoden. Es stellt verschiedene bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen, Computertomographie, Kernspintomographie, Positronen-Emissions-Tomographie und funktionelle Kernspintomographie vor. Kapitel 3 widmet sich nichtinvasiven Messungen der psychophysiologischen Aktivität und erklärt die Funktionsweise und Anwendung von Elektroenzephalographie (EEG) und Elektromyographie (EMG). Das zweite Kapitel beschreibt verschiedene Teilgebiete der Biopsychologie und erläutert die Bedeutung konvergierender Forschung.
Schlüsselwörter
Biopsychologie, Forschungsmethoden, bildgebende Verfahren, nichtinvasive Messungen, psychophysiologische Aktivität, EEG, EMG, Teilgebiete der Biopsychologie, konvergierende Forschung, Tierversuche.
- Citation du texte
- Kai Olschewski (Auteur), Björn Finke (Auteur), 2005, Forschungsmethoden der Biopsychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62567