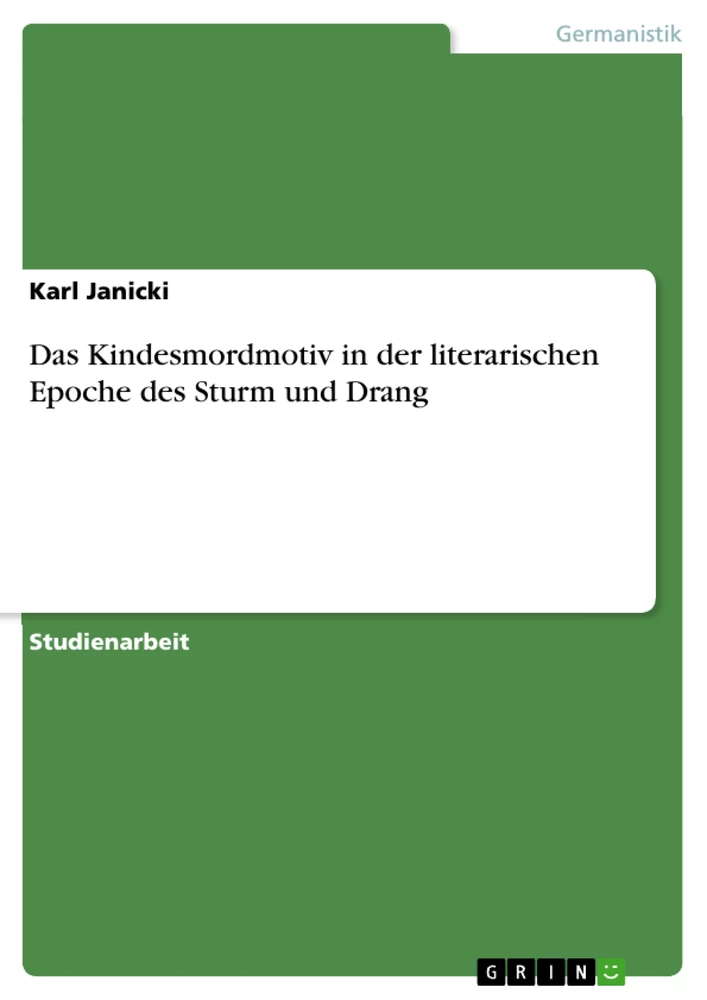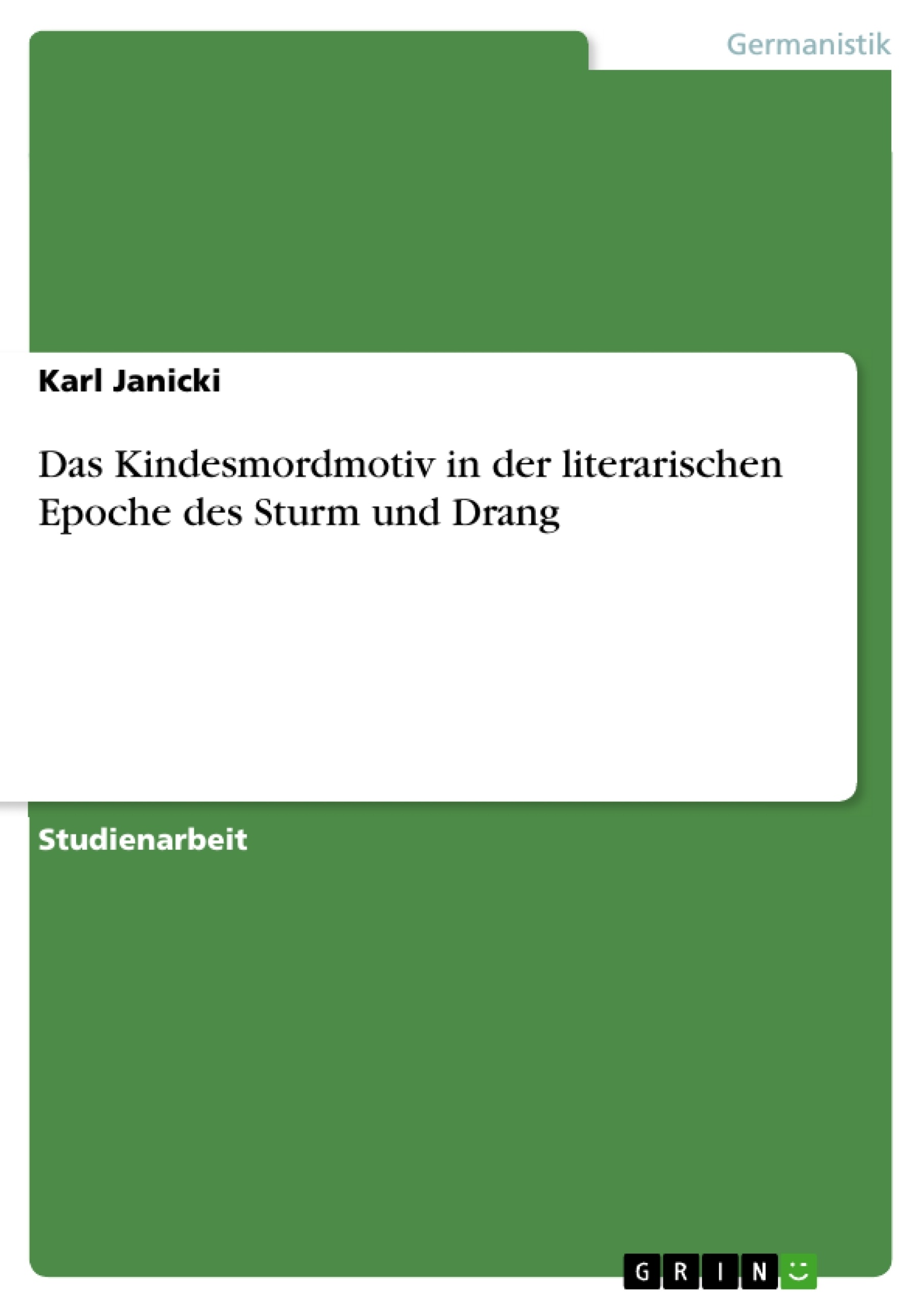Mehr als 22 Jahre lang herrschten in Afghanistan Krieg und Bürgerkrieg. Bis heute leidet das Land unter den typischen Folgen wie schweren Zerstörungen, Verminderung ganzer Landstriche, ethnisch motivierten Spannungen und organisierter Kriminalität. Dabei einigten sich bereits im November und Dezember 2001 nach dem Sturz des Taliban- Regimes die größten ethnischen Gruppen anlässlich der „Petersberger Konferenz“ auf „eine Vereinbarung über Regierungsinstitutionen in Afghanistan bis zum Aufbau dauerhafter Regierungsinstitutionen“ (vgl. Bonner Vereinbarung 2001). Dadurch wurde unter anderem die Grundlage für eine internationale Sicherheitsbeistandstruppe ISAF gelegt, deren Aufstellung am 20.12.2001 durch den Weltsicherheitsrat beschlossen wurde. Der Kampf gegen das terroristische Netzwerk Al- Qaida und gegen die Taliban ist bis heute nicht abgeschlossen, obwohl seit Mandatierung Ende 2001 erhebliche Mühen unternommen wurden, die terroristischen Netzwerke zu zerschlagen und Frieden in Afghanistan zu konsolidieren.
Das Ziel meiner Arbeit ist es aufzuzeigen, dass Friedensschaffende Einsätze mit einer Qualität derer in Afghanistan immer auf lange Zeit hin ausgelegt sein müssen und dass kurze Maßnahmen nur sehr kurzfristige Wirkung zeigen. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich kurz auf die grundlegenden Definitionen von Krise, Krieg, Terrorismus eingehen, um die Situation in Afghanistan genau beschreiben zu können. Leider ist es ein stetiges Versäumnis der Medien ihre Berichterstattung gemäß der üblichen Definitionen auszurichten, so dass oftmals Meldungen über Zustände und aktuelle Begebenheiten verfälscht werden. Gleichzeitig werde ich auf die Problematik eingehen, die aus Mandatierungen der Einsätze hervorgehen und die die Grundlage für ein nation- building deutlich gefährden können. Bezüglich der Konsolidierung einer eigenen und handlungsfähigen Regierung Afghanistans werde ich kurz das Regierungssystem anhand der politischen Amtsträger erläutern und dabei darauf aufmerksam machen, dass meines Erachtens wesentlich zu früh eine Abgabe der Interimsverwaltung in eine eigene Regierung erfolgt ist und dass dadurch zwangsläufig Probleme entstehen werden. Ebenfalls thematisiert wird der Appell, Krisen in Entwicklungsländern, hier am Beispiel von Afghanistan, nicht ausschließlich militärisch zu lösen, sondern explizit durch wirtschaftliche Änderungsmaßnahmen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die gesellschaftliche Situation im 18. Jahrhundert
- 2.1 Sturm und Drang
- 2.2 Rechtslage
- 3. Analyse der Beispielwerke
- 3.1 Johann Wolfgang Goethe - Faust, Der Tragödie Erster Teil
- 3.1.1 „Am Brunnen“
- 3.1.2 „Dom“
- 3.1.3 „Kerker“
- 3.2 Johann Wolfgang Goethe - Vor Gericht
- 3.3 Friedrich Schiller - Die Kindesmörderin
- 4. Vergleich der Frauengestalten
- 5. Gegenwartsbezug
- 6. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Motiv des Kindesmordes in der literarischen Epoche des Sturm und Drang. Ziel ist es, die gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen des 18. Jahrhunderts zu beleuchten, die dieses Motiv beeinflussten, und die Darstellung des Themas in ausgewählten Werken von Goethe und Schiller zu analysieren. Dabei wird auch der Vergleich der weiblichen Protagonistinnen und deren jeweilige Charakterisierung im Kontext der Epoche betrachtet.
- Die gesellschaftliche Situation im 18. Jahrhundert und die Rolle der Aufklärung.
- Das Kindesmordmotiv als Spiegel der sozialen und rechtlichen Bedingungen.
- Analyse der Darstellung des Kindesmordes in den Werken Goethes und Schillers.
- Vergleich der weiblichen Charaktere und ihrer Motivationen.
- Der Bezug des Themas zur Gegenwart (ohne Berücksichtigung des Schlusskapitels).
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Kindesmordes in Goethes Faust ein und stellt die zentrale Frage nach den Intentionen Goethes und dem gesellschaftlichen Kontext des 18. Jahrhunderts. Sie begründet die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der gesellschaftlichen Situation und der Charakteristika des Sturm und Drang, bevor die Analyse der literarischen Beispielwerke erfolgt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Themas innerhalb des Gesamtwerks und der Frage nach der Behandlung dieses Motivs in anderen literarischen Werken dieser Epoche und darüber hinaus.
2. Die gesellschaftliche Situation im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen des 18. Jahrhunderts, die das Motiv des Kindesmordes prägten. Der Abschnitt 2.1, "Sturm und Drang", beschreibt die literarische Bewegung und ihren Fokus auf gefühlsbetonte Selbstwahrnehmung, Geniekult und den Rückgriff auf antike Helden. Abschnitt 2.2, "Rechtslage", erörtert die harte Rechtslage bezüglich Kindesmord im 18. Jahrhundert, basierend auf der Constitutio Criminalis Carolina (CCC), die drakonische Strafen vorsah. Es werden gängige Beweismethoden wie die Lungenprobe und die gesellschaftliche Stigmatisierung unverheirateter Mütter behandelt. Die Reformen Friedrichs II. werden als ein Schritt zur Humanisierung des Strafrechts erwähnt, die Todesstrafe für Kindesmord wurde aber erst im 19. Jahrhundert abgeschafft. Das Kapitel verdeutlicht die komplexen sozialen und rechtlichen Faktoren, die zu diesem verbreiteten Verbrechen führten und seine Darstellung in der Literatur beeinflussten.
Schlüsselwörter
Kindesmord, Sturm und Drang, 18. Jahrhundert, Goethe, Schiller, Gesellschaftliche Situation, Rechtslage, Constitutio Criminalis Carolina, Frauengestalten, Literaturanalyse, Neonatizid, Infantizid.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Kindesmord im Sturm und Drang
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Motiv des Kindesmordes in der literarischen Epoche des Sturm und Drang, insbesondere in Werken von Goethe und Schiller. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen des 18. Jahrhunderts, die dieses Motiv beeinflussten, und analysiert die Darstellung des Themas in ausgewählten literarischen Beispielwerken.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vor allem Goethes Faust, Der Tragödie Erster Teil (mit Fokus auf Szenen wie „Am Brunnen“, „Dom“ und „Kerker“) und Goethes Vor Gericht, sowie Schillers Die Kindesmörderin. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der weiblichen Protagonistinnen und deren Charakterisierung im Kontext der Epoche.
Welche Aspekte des 18. Jahrhunderts werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche Situation des 18. Jahrhunderts, inklusive der literarischen Bewegung des Sturm und Drang mit ihrem Fokus auf Gefühl, Geniekult und antiken Helden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rechtslage, insbesondere die drakonischen Strafen des Kindesmordes gemäß der Constitutio Criminalis Carolina (CCC), inklusive gängiger Beweismethoden wie der Lungenprobe und der gesellschaftlichen Stigmatisierung unverheirateter Mütter. Die Reformen Friedrichs II. und der spätere Abbau der Todesstrafe werden ebenfalls erwähnt.
Wie werden die weiblichen Figuren verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht die weiblichen Protagonistinnen der analysierten Werke und untersucht deren Motivationen und Charakterisierungen im Kontext der gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen des 18. Jahrhunderts und der literarischen Strömung des Sturm und Drang.
Gibt es einen Gegenwartsbezug?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen Gegenwartsbezug, der die Relevanz des Themas Kindesmord über die historische Epoche hinaus verdeutlicht (ohne Berücksichtigung des Schlusskapitels).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die gesellschaftliche Situation im 18. Jahrhundert (mit Unterkapiteln zu Sturm und Drang und Rechtslage), Analyse der Beispielwerke (Goethe: Faust, Vor Gericht; Schiller: Die Kindesmörderin), Vergleich der Frauengestalten, Gegenwartsbezug und Schlusswort.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Kindesmord, Sturm und Drang, 18. Jahrhundert, Goethe, Schiller, Gesellschaftliche Situation, Rechtslage, Constitutio Criminalis Carolina, Frauengestalten, Literaturanalyse, Neonatizid, Infantizid.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Motiv des Kindesmordes im Sturm und Drang umfassend zu untersuchen, die gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen des 18. Jahrhunderts zu beleuchten und die Darstellung des Themas in den ausgewählten Werken von Goethe und Schiller zu analysieren.
- Citation du texte
- Karl Janicki (Auteur), 2006, Das Kindesmordmotiv in der literarischen Epoche des Sturm und Drang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62449