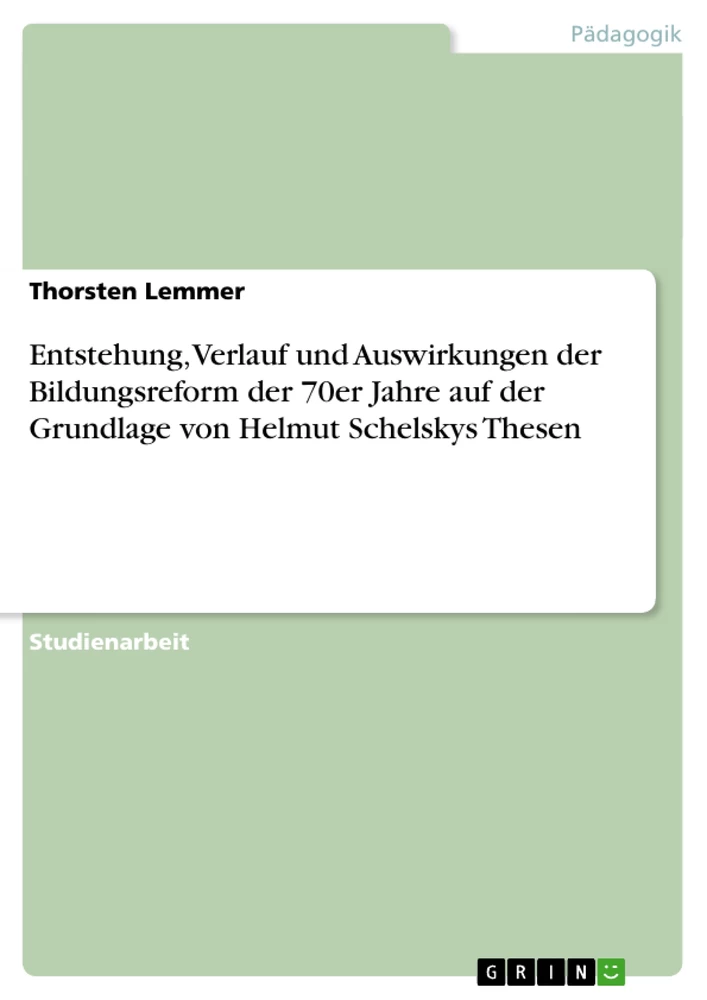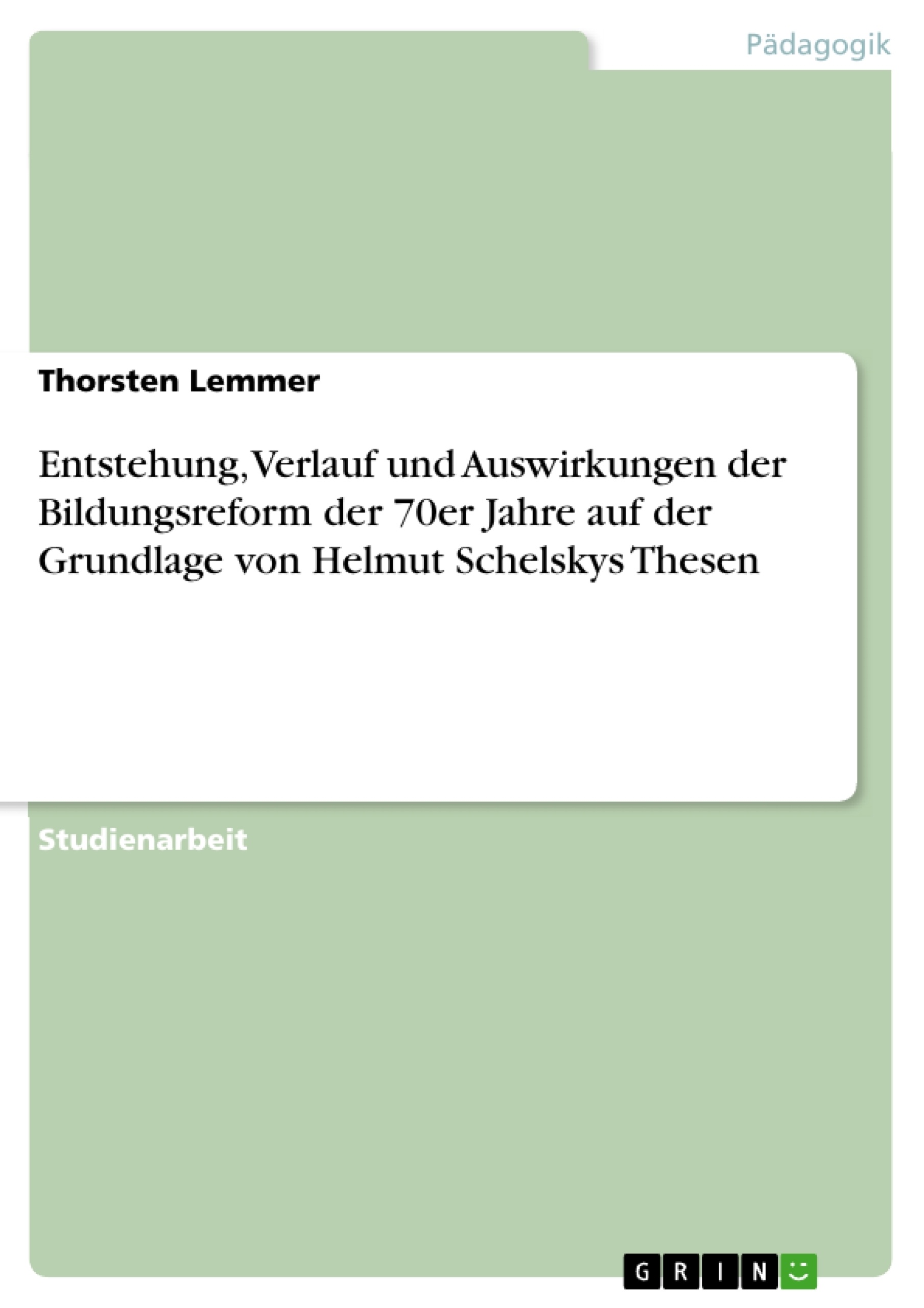Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Entstehung, der Verlauf und die Auswirkungen der in den 60er und 70er Jahren stattgefundenen Bildungsreform/Bildungsexpansion. Drei Fragestellungen waren für diese Arbeit forschungsleitend:
(1) Ist Schelsky heute noch aktuell?
(2) Was hat die Bildungsexpansion damit zu tun, was war sie überhaupt
und welche Folgen hatte sie und
(3) Was hat das Bildungssystem mit der Sozialstruktur zu tun oder welche
Auswirkungen gehen vom einen zum anderen aus. Diese sehr komplexen Zusammenhänge sollen im Folgenden versucht werden, etwas zu erhellen, in Beziehung zu setzen und auf einige Fragen nach Antworten gesucht werden.
Ausgegangen werden soll dabei von Helmut Schelskys These der Schule als zentraler Dirigierungsstelle für Lebenschancen, die in den 60er Jahren für viel Aufregung sorgte. Anhand dieser These sollen die Funktionen der Schule in unserer Gesellschaft verdeutlicht und das Konzept der Lebenschancen näher untersucht werden. Zuvor soll noch eine der wesentlichsten Grundvoraussetzungen der These Schelskys, die von ihm angenommene "nivellierte Mittelstands-Gesellschaft" kritisch beleuchtet werden.
Im Folgenden wird dann die sogenannte Bildungsexpansion näher untersucht und ihre Intention vor allem aus dem Blickwinkel gesellschaftlicher Ungleichheit betrachtet und nach Ungleichheiten im Zugang und Erfolg beim Besuch der Schule gefragt, da dieses Konzept der Idee Schelskys gleichsam gegenüber steht.
Die Folgen der Bildungsexpansion werden im Anschluss daran hinsichtlich der Bildungsgerechtigkeit und der Bildungsbeteiligung betrachtet und dann gelingen auch Antworten auf die These Schelskys und der Frage nach dem Erfolg der Bildungsexpansion.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Helmut Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft
- Nivellierte Mittelstandsgesellschaft oder antagonistische Klassengesellschaft?
- Die Schule als zentrale Dirigierungsstelle von Lebenschancen
- Funktionen von Schule
- Schule und Lebenschancen
- Bildungskatastrophe und katholisches Arbeitermädchen vom Lande: Die Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre
- Ausgangslage und Motivation der Bildungsexpansion Ende der 60er Jahre
- Die Folgen der Bildungsexpansion oder „Wem hat die Bildungsexpansion genutzt?"
- Ansätze zur Erklärung des Verlaufs und Endes der Bildungsexpansion
- Konsequenzen der Bildungsexpansion (I): Ungleichheiten bestehen weiter
- Familiale Sozialisation und schichtenspezifische Auslese
- Versuch des Chancenausgleichs durch kompensatorische Erziehung und Gesamtschule
- Konsequenzen der Bildungsexpansion (II): Erhöhte Bildungsbeteiligung und „Verwertungsprobleme"
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, den Verlauf und die Auswirkungen der Bildungsreform/Bildungsexpansion der 1960er und 1970er Jahre. Die Forschungsfragen konzentrieren sich auf die Aktualität von Schelskys Thesen, den Zusammenhang zwischen Bildungsexpansion und gesellschaftlicher Entwicklung sowie die Wechselwirkungen zwischen Bildungssystem und Sozialstruktur. Die Arbeit beleuchtet die Funktionen der Schule, insbesondere im Kontext der von Schelsky postulierten nivellierten Mittelstandsgesellschaft, und analysiert die Folgen der Bildungsexpansion für die Bildungsbeteiligung und -gerechtigkeit.
- Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle für Lebenschancen
- Die Konzeption der nivellierten Mittelstandsgesellschaft
- Die Intention und Folgen der Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre
- Ungleichheiten im Bildungssystem und deren Persistenz
- Der Zusammenhang zwischen Bildungssystem und Sozialstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Forschungsfragen der Arbeit: die Aktualität von Schelskys Thesen, die Analyse der Bildungsexpansion und deren Folgen sowie die Beziehung zwischen Bildungssystem und Sozialstruktur. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den methodischen Ansatz, der auf Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle für Lebenschancen aufbaut.
Helmut Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft: Dieses Kapitel analysiert Schelskys These über die Schule als zentrale Instanz zur Vermittlung von Lebenschancen in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Es beleuchtet die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der nivellierten Mittelstandsgesellschaft und untersucht die Funktionen der Schule im Kontext sozialer Ungleichheit und Mobilität. Der Vergleich zwischen der Rolle der Schule in der Klassengesellschaft und der nivellierten Gesellschaft verdeutlicht Schelskys Argumentation.
Bildungskatastrophe und katholisches Arbeitermädchen vom Lande: Die Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre: Dieses Kapitel untersucht die Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre. Es analysiert die Ausgangslage und Motivationen hinter dieser Expansion, beleuchtet die Folgen für verschiedene gesellschaftliche Gruppen und untersucht verschiedene Erklärungsansätze für ihren Verlauf und ihr Ende. Das Kapitel setzt sich kritisch mit dem Begriff der "Bildungskatastrophe" auseinander und untersucht, wem die Bildungsexpansion letztendlich genutzt hat.
Konsequenzen der Bildungsexpansion (I): Ungleichheiten bestehen weiter: Dieses Kapitel analysiert die anhaltenden Ungleichheiten im Bildungssystem trotz der Bildungsexpansion. Es untersucht den Einfluss der familiären Sozialisation und schichtenspezifischer Auslesemechanismen auf den Bildungserfolg. Weiterhin wird der Versuch des Chancenausgleichs durch kompensatorische Erziehung und die Einführung der Gesamtschule beleuchtet und dessen Wirkung kritisch evaluiert.
Konsequenzen der Bildungsexpansion (II): Erhöhte Bildungsbeteiligung und „Verwertungsprobleme": Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen der erhöhten Bildungsbeteiligung, die durch die Bildungsexpansion erreicht wurde. Es analysiert die sich daraus ergebenden „Verwertungsprobleme“ auf dem Arbeitsmarkt und untersucht, inwieweit die Bildungsexpansion tatsächlich zu mehr Chancengleichheit geführt hat oder ob neue Ungleichheiten entstanden sind.
Schlüsselwörter
Bildungsexpansion, Bildungssystem, Sozialstruktur, Helmut Schelsky, Nivellierte Mittelstandsgesellschaft, Chancengleichheit, soziale Ungleichheit, Schulsystem, Lebenschancen, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bildungsexpansion und soziale Ungleichheit
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung, den Verlauf und die Auswirkungen der Bildungsreform/Bildungsexpansion der 1960er und 1970er Jahre in Deutschland. Sie analysiert die Aktualität von Schelskys Thesen zur Schule als zentrale Dirigierungsstelle für Lebenschancen und den Zusammenhang zwischen Bildungsexpansion, gesellschaftlicher Entwicklung und der Sozialstruktur.
Welche Thesen von Helmut Schelsky werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle für Lebenschancen in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Es wird kritisch hinterfragt, ob diese These auch im Kontext der Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre Gültigkeit besitzt und wie die Schule in diesem Zusammenhang soziale Ungleichheit reproduziert oder abbaut.
Was versteht man unter "nivellierter Mittelstandsgesellschaft" im Kontext dieser Arbeit?
Der Begriff "nivellierte Mittelstandsgesellschaft" beschreibt eine Gesellschaft, in der die sozialen Unterschiede zwischen den Klassen scheinbar abnehmen, aber dennoch Mechanismen bestehen bleiben, die soziale Ungleichheit reproduzieren. Die Arbeit untersucht kritisch, ob diese Vorstellung zutrifft und welche Rolle die Schule dabei spielt.
Welche Folgen der Bildungsexpansion werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Folgen der Bildungsexpansion für die Bildungsbeteiligung und -gerechtigkeit. Es wird untersucht, ob die Bildungsexpansion tatsächlich zu mehr Chancengleichheit geführt hat oder ob sie bestehende Ungleichheiten verstärkt oder neue Ungleichheiten geschaffen hat. Besondere Aufmerksamkeit gilt den anhaltenden Ungleichheiten trotz der erhöhten Bildungsbeteiligung und den damit verbundenen "Verwertungsproblemen" auf dem Arbeitsmarkt.
Welche Rolle spielt die Familie in der Analyse der Bildungsungleichheit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der familiären Sozialisation und schichtenspezifischer Auslesemechanismen auf den Bildungserfolg. Es wird analysiert, inwieweit familiäre Ressourcen und der soziale Hintergrund die Bildungschancen von Kindern beeinflussen und ob und wie kompensatorische Maßnahmen diesem entgegenwirken können.
Welche Rolle spielt die Gesamtschule in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den Versuch des Chancenausgleichs durch kompensatorische Erziehung und die Einführung der Gesamtschule. Sie evaluiert kritisch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zur Reduktion von Bildungsungleichheit.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit baut auf Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle für Lebenschancen auf und analysiert die Bildungsexpansion und deren Folgen im Kontext dieser These. Der genaue methodische Ansatz wird in der Einleitung detaillierter beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bildungsexpansion, Bildungssystem, Sozialstruktur, Helmut Schelsky, Nivellierte Mittelstandsgesellschaft, Chancengleichheit, soziale Ungleichheit, Schulsystem, Lebenschancen, Bildungsgerechtigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Helmut Schelskys These von der Schule als zentrale Dirigierungsstelle, Bildungskatastrophe und Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre, Konsequenzen der Bildungsexpansion (I): anhaltende Ungleichheiten, Konsequenzen der Bildungsexpansion (II): erhöhte Bildungsbeteiligung und "Verwertungsprobleme", und Zusammenfassung.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Lemmer (Autor:in), 2002, Entstehung, Verlauf und Auswirkungen der Bildungsreform der 70er Jahre auf der Grundlage von Helmut Schelskys Thesen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6239