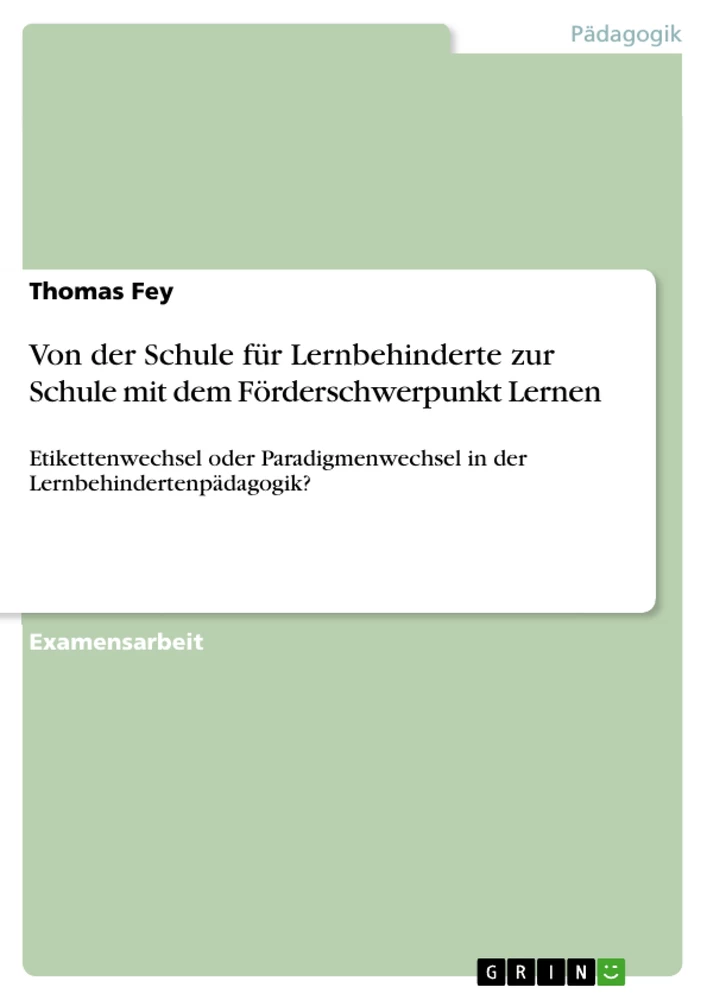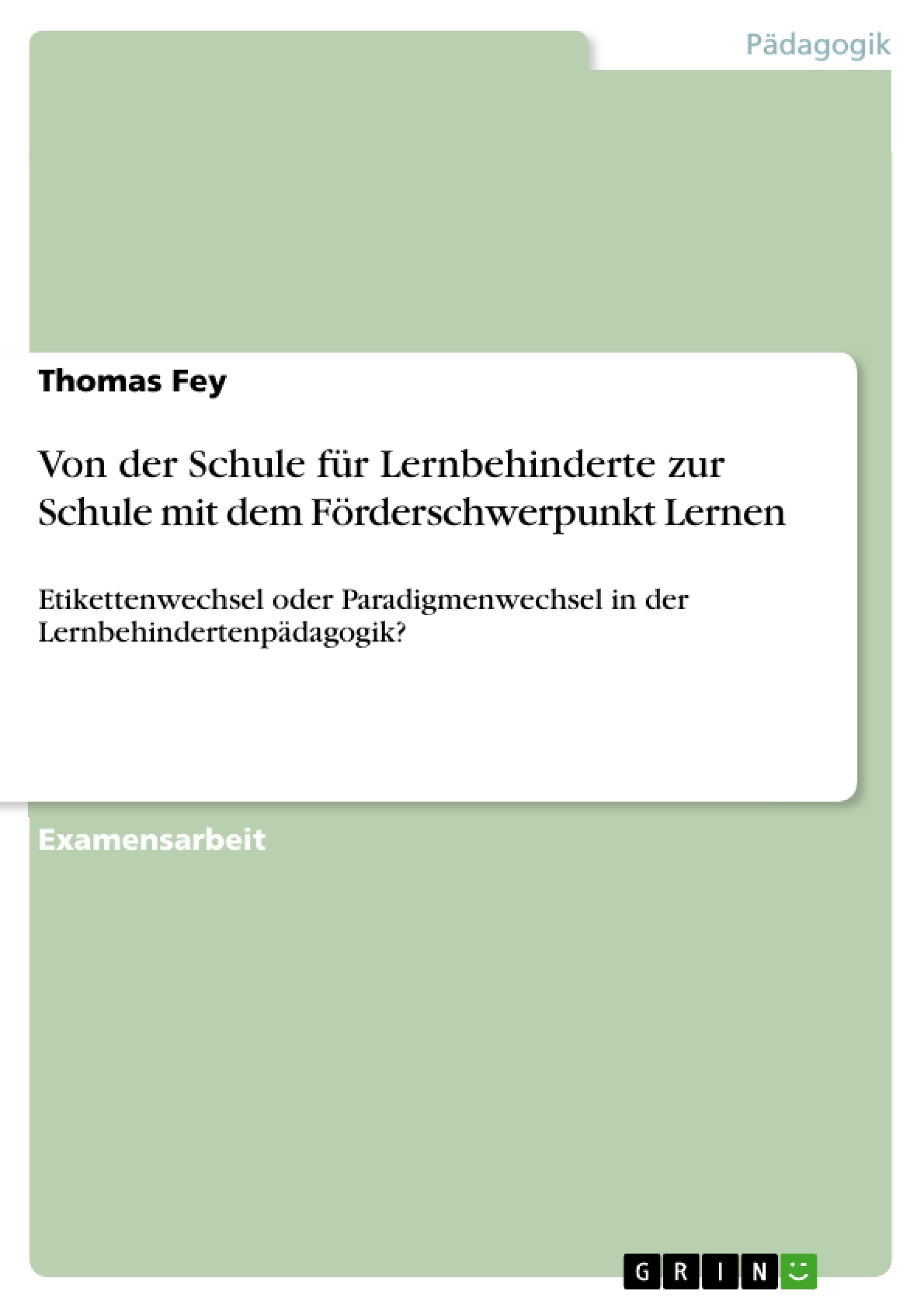Schule für Lernbehinderte, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Hilfsschule, Schule für Schwachbegabte, ... die Liste der Namen für diese Schulart könnte um einige weitere ergänzt werden. Aber warum ist dies so? Wieso findet man keine einheitliche Bezeichnung für eine Schülergruppe, die an einer Sonderschule unterrichtet wird, an der zu einem großen Teil Kinder sind, die in der Regelschule nicht dem Unterricht folgen können und einen unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten aufweisen?
Der Lernbehindertenpädagogik fällt es sichtlich schwer, eine Definition dieser Schülerschaft zu finden, was sich meines Erachtens auch auf die Namengebung der Schulart auswirkt. Sehen wir - die Sonderpädagogen - die Behinderung als Eigenschaft, die an einem Kind festzumachen ist oder sehen wir Behinderung als Störung in der Interaktion zwischen Person und Umwelt? Sind diese Kinder also wirklich "behindert" oder werden sie durch Schule, Gesellschaft und Familie behindert?
Die folgende Arbeit soll zeigen, in welchem Dilemma sich die Lernbehindertenpädagogik nicht erst seit knapp dreißig Jahren befindet, und wie es dazu kam, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, eine Stigmatisierung und Etikettierung von Kindern zu vermeiden, die die "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen" besuchen.
Wichtig hierzu ist der wissenschaftliche Hintergrund, also das Fach Lernbehindertenpädagogik, welches sich seit nun fast 130 Jahren mit diesen Kindern beschäftigt. Seit der ersten Stunde gab es Kritik an der - damals so genannten - Hilfsschule. Sie sei aussondernd, behebe nicht die Ursache des Problems, sondern forciere eine gesellschaftliche Aussonderung der Schüler, die diese Schule besuchen.
Um die Entwicklung dieser Schulart und der Lernbehindertenpädagogik zu verstehen, ist eine historische Betrachtung von Nöten. Schon KLEBER stellte fest, dass die Lernbehindertenpädagogik "weitgehend nur historisch gedeutet und verstanden werden" kann (KLEBER 1980, Seite 84).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung der ersten Hilfsschulen in Deutschland
- Die Hilfsschulen in der Zeit bis 1933
- Die Zeit des Nationalsozialismus
- Zwischenbilanz
- Die Zeit von 1945 bis in die 1960er
- Die veränderte Sichtweise in den 70er Jahren
- Paradigma - ein Definitionsversuch
- Paradigmata in der Sonderpädagogik
- Der Paradigmenbegriff bei Ulrich BLEIDICK
- Das individualtheoretische Paradigma – Behinderung als medizinische Kategorie
- Das interaktionstheoretische Paradigma – Behinderung als Etikett
- Das systemtheoretische Paradigma – Behinderung als Systemfolge
- Das gesellschaftstheoretische Paradigma – Behinderung als Gesellschaftsprodukt
- Analyse der vier Paradigmata aus heutiger Sicht
- Der Paradigmenbegriff bei Walter THIMM
- Analyse des Stigma – Paradigmas von THIMM
- Der Paradigmenbegriff bei Emil KOBI
- Das Caritative Model
- Das Exorzistische Modell
- Das Rehabilitations - Modell
- Das Medizinische Modell
- Das Interaktionsmodell
- Analyse der fünf Paradigmen von KOBI
- Der Paradigmenbegriff bei Markus MÜLLER
- Primär die Behinderung analysierende, kausalorientierte Determination
- Primär am Berufsstand orientierte Determination
- Primär an einem ideologischen Überzeugungssystem orientierte Determination
- Behinderungsorientierte Ansätze
- Der Individualansatz
- Der Mikrosoziologische Ansatz
- Der makrosoziologische Ansatz
- Berufsständisch orientierte Ansätze
- Der medizinische Ansatz
- Der psychologische Ansatz
- Der soziologische Ansatz
- Ideologisch orientierte Ansätze
- Der humanistische Ansatz
- Der kritisch – materialistische Ansatz
- Der anthroposophische Ansatz
- Der theologische Ansatz
- Der analytisch - realwissenschaftliche Ansatz
- Analyse der elf Paradigmen von MÜLLER
- Das integrationspädagogische Paradigma von Hans EBERWEIN
- Analyse des integrationspädagogischen Paradigmas von EBERWEIN
- Vergleich der Paradigmenansätze
- Folgerungen für die Lernbehindertenpädagogik
- Die Schule für Lernbehinderte heute
- Der Weg zur Namensänderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Prüfungsarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Schulen für Lernbehinderte in Deutschland und dem Wandel von „Schule für Lernbehinderte“ zu „Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen“. Dabei wird der Fokus auf die Frage gerichtet, ob dieser Wandel nur einen Etikettenwechsel oder einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Lernbehindertenpädagogik darstellt.
- Historische Entwicklung der Hilfsschulen in Deutschland
- Analyse unterschiedlicher Paradigmen in der Sonderpädagogik
- Bedeutung von Etiketten und Paradigmen für die Lernbehindertenpädagogik
- Folgerungen für die heutige Lernbehindertenpädagogik
- Diskussion des Wegs zur Namensänderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Entstehung der ersten Hilfsschulen in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der Hilfsschulen in Deutschland und die Entstehung des Konzeptes der Sonderpädagogik für Lernbehinderte.
- Die Hilfsschulen in der Zeit bis 1933: In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Hilfsschulen im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Zeit bis zum Beginn des Nationalsozialismus betrachtet.
- Die Zeit des Nationalsozialismus: Hier wird die Ideologie und Praxis der NS-Zeit in Bezug auf die Hilfsschulen analysiert und deren Folgen für die Lernbehindertenpädagogik aufgezeigt.
- Zwischenbilanz: Dieses Kapitel fasst die Entwicklung der Hilfsschulen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen und zeichnet ein Zwischenfazit.
- Die Zeit von 1945 bis in die 1960er: Dieser Abschnitt behandelt die Veränderungen in der Lernbehindertenpädagogik nach dem Zweiten Weltkrieg und die allmähliche Hinwendung zu integrativen Ansätzen.
- Die veränderte Sichtweise in den 70er Jahren: Dieses Kapitel beleuchtet die veränderten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Strömungen der 1970er Jahre und deren Einfluss auf die Lernbehindertenpädagogik.
- Paradigma - ein Definitionsversuch: In diesem Kapitel wird der Begriff „Paradigma“ definiert und verschiedene wissenschaftliche Ansätze dazu dargestellt.
- Paradigmata in der Sonderpädagogik: Hier werden verschiedene Paradigmen der Sonderpädagogik vorgestellt und analysiert, unter anderem von Ulrich BLEIDICK, Walter THIMM, Emil KOBI und Markus MÜLLER.
- Vergleich der Paradigmenansätze: Dieses Kapitel vergleicht die verschiedenen Paradigmen und untersucht ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Folgerungen für die Lernbehindertenpädagogik: Ausgehend von der Analyse der Paradigmen werden hier wichtige Erkenntnisse für die aktuelle Lernbehindertenpädagogik abgeleitet.
- Die Schule für Lernbehinderte heute: Dieses Kapitel schildert die Situation der Schulen für Lernbehinderte im heutigen Kontext und die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen.
- Der Weg zur Namensänderung: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Gründen und Auswirkungen der Namensänderung von „Schule für Lernbehinderte“ zu „Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen“.
Schlüsselwörter
Die wissenschaftliche Prüfungsarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Lernbehindertenpädagogik, Hilfsschule, Sonderpädagogik, Inklusion, Integration, Paradigmenwechsel, Etikettenwechsel, Stigma, Behinderung, Integrationspädagogik.
- Der Paradigmenbegriff bei Ulrich BLEIDICK
- Quote paper
- Thomas Fey (Author), 2001, Von der Schule für Lernbehinderte zur Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6219