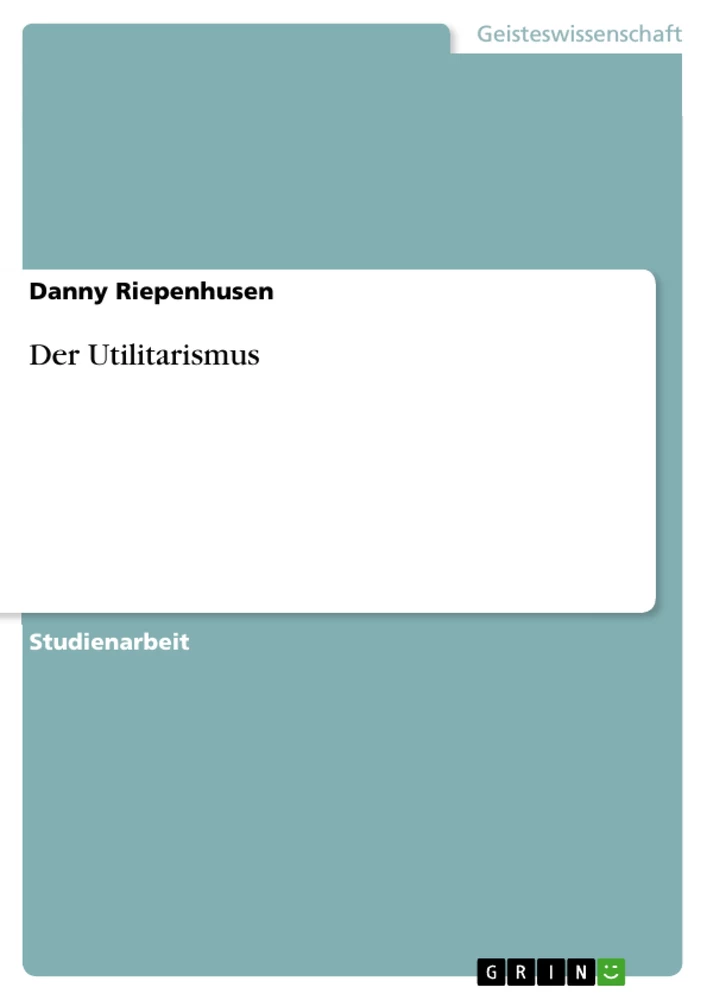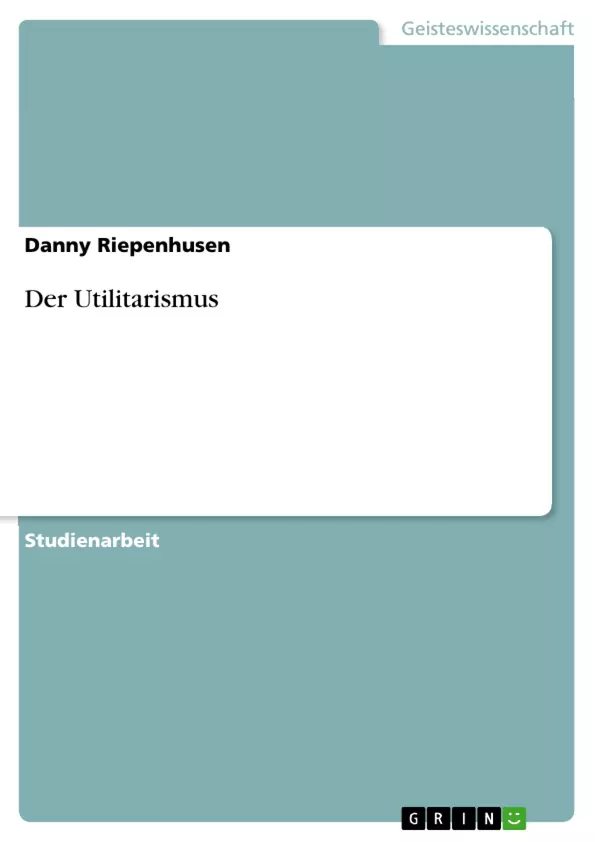Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer tut das.Nietzsche, Götzen-Dämmerung, S. 6. Die Überlegung, eine Handlung nach ihren Handlungsfolgen und im besonderen nach dem Glück, das diese mit sich bringen, zu beurteilen, ist nicht neu. Bereits die antike griechische Philosophie kannte solche ethischen Konzepte. Später als die antike Philosophie in Vergessenheit geriet, war das Christentum Maß aller Dinge in ethischen Fragen. Jetzt kam es nicht mehr auf die Handlungsfolgen an, sondern nur noch auf die Befolgung von Handlungsvorschriften wie den Zehn Geboten. Erst in der Neuzeit, als die Philosophie der Antike wiederentdeckt wurde und die Kirche langsam an Autorität verlor, erwachte auch die Idee einer säkularen konsequentialistischen Ethik wieder zum Leben. Einen ersten Höhepunkt hatte diese Idee in der Zeit der Aufklärung, als man sich die Vernunft auf die Fahnen schrieb und wagte die bisherigen moralischen und politischen Ideen zu hinterfragen. Ziel der damaligen Philosophen war, eine Ethik zu schaffen, welche sich nicht mehr auf Gott und die Bibel berief, sondern auf die Fähigkeit des Menschen sich seines Verstandes zu bedienen. Außerdem entwickelte sich in jener Zeit die Gleichheit aller Menschen, welche eine Idee des Christentums ist, zu einer politischen Maxime. Die Menschen sollten vor dem Gesetz gleich sein unabhängig von ihrer Herkunft und ihres Vermögens. So entwickelte sich in jener Zeit eine Ethik die, wie in der Antike, das Glück zum Ziel hatte, allerdings nicht mehr das individuelle Glück, sondern das Glück aller Menschen. Diese Ethik, der Utilitarismus, berief sich nicht mehr auf einen Gott und die Gesetze der Kirche, sondern auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Wenn sich diese Ethik in den darauf folgenden Jahrhunderten auch nicht als allgemeine Moral durchgesetzt hat, so lohnt es sich dennoch sie näher zu betrachten, denn auch heute noch bildet sie eine interessante Alternative oder Ergänzung zu unserem bestehenden System. Daher werde ich im Folgenden den Utilitarismus, seine Vor- und Nachteile und seine Hauptvarianten vorstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des klassischen Handlungsutilitarismus
- Problemfelder des klassischen Handlungsutilitarismus
- Entscheidung zwischen Hedonismus und Eudaimonismus
- Gewichtung von Eigennutzen gegenüber Gemeinnutzen
- zentrale und dezentrale Glücksbestimmung
- Das Glückskalkül
- Varianten des Utilitarismus
- Regel-Utilitarismus
- Gerechtigkeitsutilitarismus nach Trapp
- negativer Utilitarismus
- theologischer Utilitarismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Utilitarismus, eine ethische Theorie, die Handlungen nach ihren Folgen bewertet und das Glück als oberstes Ziel betrachtet. Sie analysiert die Definition des klassischen Handlungsutilitarismus und beleuchtet kritische Punkte, wie die Abgrenzung von Hedonismus und Eudaimonismus, die Gewichtung von Eigennutzen gegenüber Gemeinnutzen, die Frage nach der zentralen oder dezentralen Glücksbestimmung und das Problem des Glückskalküls.
- Definition und Kernprinzipien des Utilitarismus
- Kritikpunkte und Problemfelder des klassischen Handlungsutilitarismus
- Varianten des Utilitarismus und ihre spezifischen Ansätze
- Bewertung des Utilitarismus als ethisches Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Utilitarismus ein und erläutert die historische Entwicklung des Konzepts. Sie stellt den Utilitarismus als eine säkulare konsequentialistische Ethik vor, die im Kontext der Aufklärung entstand und das Glück aller Menschen als Ziel verfolgt.
Definition des klassischen Handlungsutilitarismus
Dieses Kapitel definiert den klassischen Handlungsutilitarismus als eine Theorie, die Handlungen nach ihrem Gesamtnutzenzuwachs bewertet. Es wird auf die unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Utilitarismus hinsichtlich der Bestimmung des Nutzens und der Gewichtung von Glück eingegangen.
Problemfelder des klassischen Handlungsutilitarismus
Das dritte Kapitel beleuchtet die Problemfelder des klassischen Handlungsutilitarismus, wie die Entscheidung zwischen Hedonismus und Eudaimonismus, die Gewichtung von Eigennutzen gegenüber Gemeinnutzen, die Frage nach der zentralen oder dezentralen Glücksbestimmung und das Problem des Glückskalküls.
Varianten des Utilitarismus
Dieses Kapitel stellt verschiedene Varianten des Utilitarismus vor, darunter den Regel-Utilitarismus, den Gerechtigkeitsutilitarismus nach Trapp, den negativen Utilitarismus und den theologischen Utilitarismus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Utilitarismus als ethischer Theorie, die das Glück maximieren möchte. Sie analysiert die Definition des klassischen Handlungsutilitarismus, dessen Problemfelder und die verschiedenen Varianten des Utilitarismus. Zu den zentralen Begriffen gehören Hedonismus, Eudaimonismus, Gesamtnutzen, Glückskalkül, Regel-Utilitarismus und Gerechtigkeitsutilitarismus.
- Quote paper
- M.A. Danny Riepenhusen (Author), 2002, Der Utilitarismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62163