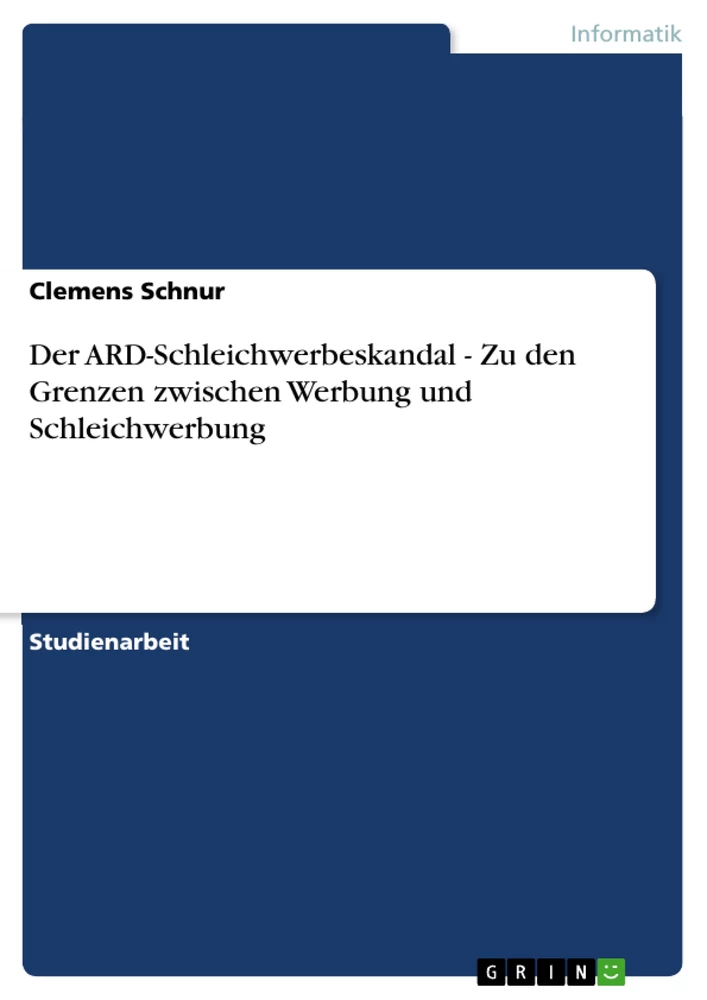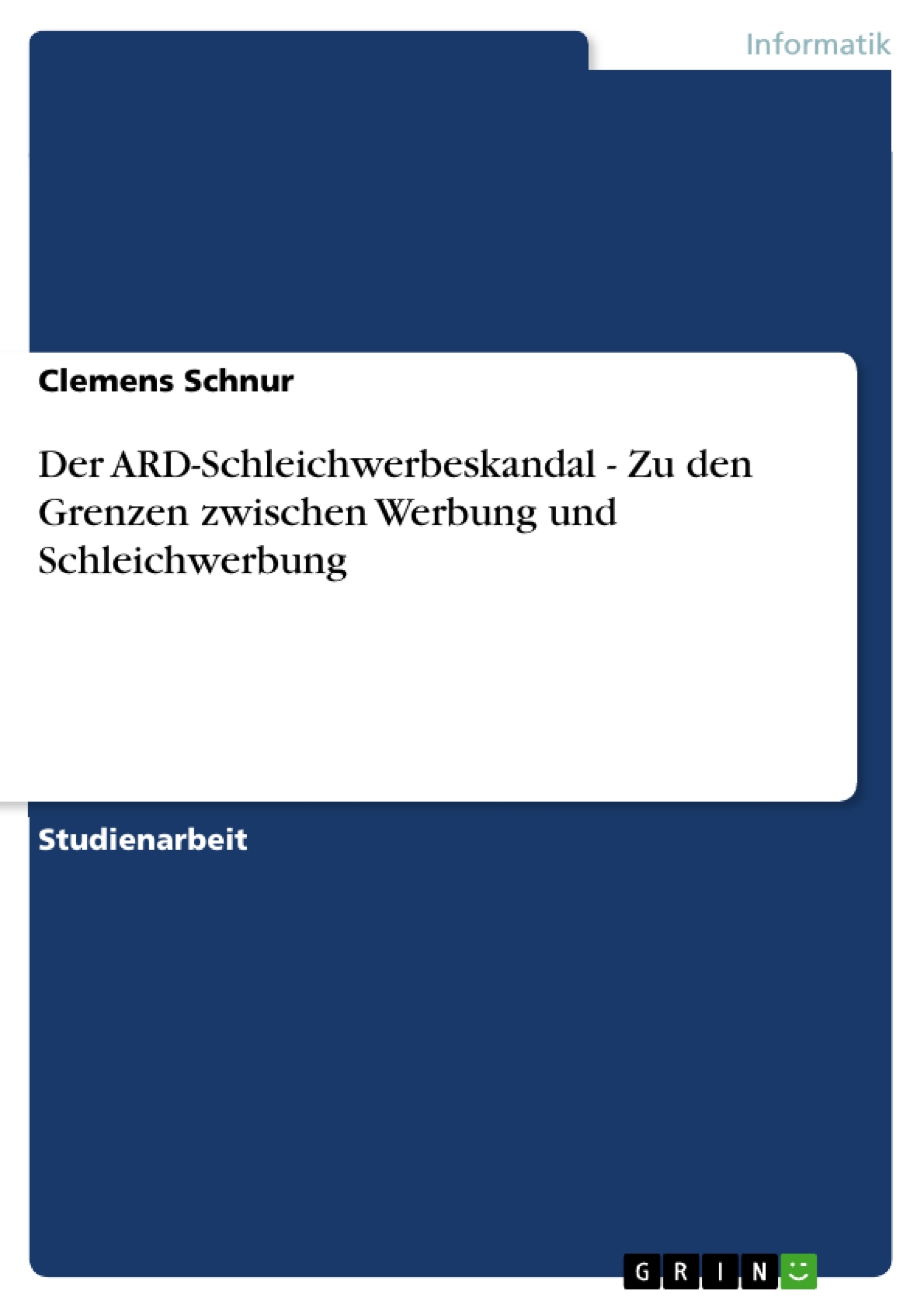„Jetzt hat die ARD ihr Watergate“ titelte Hanfeld (2005a, S. 1) im Juni 2005 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Schleichwerbeskandal scheint in der Tat zu den größten Herausforderungen zu zählen, mit denen die ARD in ihrer Geschichte bislang konfrontiert wurde. Das Phänomen Schleichwerbung ist in der Fernsehbranche nicht neu. Immer wieder tauchen vereinzelte Fälle von Produktplatzierungen in redaktionellen Programmen auf. Der ARD-Schleichwerbeskandal ist aber von einer neuen Qualität. Hanfeld (2005a, S.1) beschreibt die Beweislage hier als „extrem und erdrückend.“
Über zehn Jahre lang wurde in ARD-Produktionen schleichgeworben, besonders betroffen waren dabei die Vorabend-Serie „Marienhof“ und die Krimi-Reihe „Tatort“. Kapitel 2 fasst die Recherchen des epd-Redakteurs Lilienthal zu diesen Vorgängen zusammen und liefert eine knappe Chronologie der Ereignisse im ARD-Schleichwerbeskandal. Im Blickpunkt stehen dabei die Zusammenhänge zwischen der ARD, den verantwortlichen Produktionsfirmen und den Placement Agenturen, die den Kontakt zur geldgebenden Privatwirtschaft herstellten.
Anschließend soll die Frage beantwortet werden, was genau hinter den Begriffen „Werbung“ und „Schleichwerbung“ steht und wie diese voneinander abzugrenzen sind. Dazu werden Definitionen gewählt, die verschiedene Ansätze verfolgen, z.B. aus den Bereichen Rechtswissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft. In Abschnitt 3 werden zudem einige prägnante Fälle von Schleichwerbung detailliert dargestellt. Kapitel 4 liefert eine rechtswissenschaftliche Betrachtung des Themas „Schleichwerbung“. Die Bestandsaufnahme der berufsethischen Richtlinien und der nationalen und europaweiten Rundfunkgesetzgebung beschäftigt sich insbesondere mit dem Trennungsgebot von Werbung und Programm und den Fragen nach journalistischer Glaubwürdigkeit und der Transparenz von redaktioneller Arbeit. Hier wird außerdem diskutiert, über welchen regulierenden Einfluss die bestehenden Kontrollgremien und Sanktionserwartungen auf die aktuellen (Schleich-)Werbemethoden in der deutschen Fernsehlandschaft verfügen.
Aktuelle Zahlen zur Mediennutzung und zu den Werbeumsätzen der öffentlichrechtlichen und privaten TV-Sender werden in Kapitel 5 vorgestellt. Sie belegen einerseits, dass Fernsehen ein wichtiges Medium zur Verbreitung werberelevanter Informationen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Chronologie der aktuellen Ereignisse im ARD-Schleichwerbeskandal
- Begriffsklärungen und Abgrenzungen zwischen Werbung und Schleichwerbung
- Der Begriff „Werbung“
- Die Definition von „Werbung“ im wirtschaftswissenschaftlichen und medienpolitischen Kontext
- Die konstituierenden Kriterien für Werbung
- Mögliche Erscheinungsformen von Werbung im Fernsehen
- Der Begriff „Schleichwerbung“ („Placement“)
- Die Definition von „Schleichwerbung“
- Mögliche Erscheinungsformen von Schleichwerbung im Fernsehen
- Klassifikationsschema zum Product Placement
- Ausgewählte Beispiele von Product Placement im ARD-Schleichwerbeskandal
- Visual und Verbal Placement in der ARD-Serie „Marienhof“
- Verbal Placement in der ARD-Krimi-Reihe „Tatort“
- Product Placement im Programm des ZDF
- Der Begriff „Werbung“
- Der rechtliche Rahmen zur Rundfunkwerbung im Überblick
- Die berufsethischen Richtlinien im deutschen Fernsehen zur Trennung von Werbung und Programm
- Die DRPR-Richtlinien über Product Placement und Schleichwerbung
- Die Werberichtlinien von ARD und ZDF
- Der Rundfunkrat als Kontrollgremium innerhalb der ARD-Anstalten
- Die nationale und internationale Mediengesetzgebung zur Trennung von Werbung und Programm
- Die EU-Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“
- Die Rundfunkstaatsverträge
- Die Werberichtlinien der Landesmedienanstalten als Konkretisierung der rundfunkstaatlichen Anforderungen
- Aufsichtsorgane, Kontrollverfahren und mögliche Sanktionen zur Durchsetzung des Trennungsgebots von Werbung und Programm
- Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Grundlage der Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts
- Die berufsethischen Richtlinien im deutschen Fernsehen zur Trennung von Werbung und Programm
- Aktuelle Zahlen zur Medienrezeption und zu den Werbeumsätzen der TV-Sender
- Die Mediennutzungsdauer pro Tag im Jahr 2005
- Die durchschnittliche Fernsehnutzung im Tagesverlauf im Jahr 2004
- Die Werbeumsätze der Medienbranchen im Jahr 2004
- Aktuelle Umfragen zum Thema Schleichwerbung im deutschen Fernsehen
- Umfrage von EMNID und „auf einen Blick“ zum Thema „Auffälligkeit und Legalisierung von Schleichwerbung im Fernsehen“
- Umfrage von EMNID und des ddp zum Thema „Auffälligkeit von Schleichwerbung im Fernsehen“
- Die Rezeption von Fernsehwerbung durch den Zuschauer
- Das Werbewirkungsmodell nach MacInnis & Jaworski
- Die Ebenen kommunikativer Abgrenzungen zwischen Werbung und Programm
- Die Systematik werblicher Erscheinungsformen
- Mögliche Abgrenzungsprobleme zwischen Werbung und Programm
- Das Verhalten der Zuschauer bei Fernsehwerbung
- Die Beurteilung von TV- Werbeformen durch den Zuschauer
- Die „Theorie der Reaktanz“ als Erklärungsmodell für die negative Beurteilung von Fernsehwerbung durch den Rezipienten
- Das Elaboration-Likelihood-Modell nach Petty & Cacioppo
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den ARD-Schleichwerbeskandal und zielt darauf ab, die Grenzen zwischen Werbung und Schleichwerbung klar zu definieren und die Ursachen für das Entstehen von Schleichwerbung zu analysieren. Es wird ein interdisziplinärer Ansatz verwendet, der rechtswissenschaftliche, medienpsychologische und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte berücksichtigt.
- Begriffliche Abgrenzung von Werbung und Schleichwerbung
- Analyse der wirtschaftlichen Interessen als Ursache für Schleichwerbung
- Untersuchung des Zuschauerverhaltens im Kontext von Fernsehwerbung
- Bewertung des rechtlichen Rahmens und der Kontrollmechanismen
- Auswirkungen von Schleichwerbung auf die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht den ARD-Schleichwerbeskandal, der als eine der größten Herausforderungen in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gilt. Sie beleuchtet die lange Dauer der Praktiken, die Beteiligung verschiedener Akteure (ARD, Produktionsfirmen, Placement-Agenturen) und die Notwendigkeit einer klaren begrifflichen Abgrenzung von Werbung und Schleichwerbung. Die Arbeit untersucht auch die wirtschaftlichen und psychologischen Aspekte des Phänomens.
Die Chronologie der aktuellen Ereignisse im ARD-Schleichwerbeskandal: Dieses Kapitel dokumentiert die Abläufe und Hintergründe des Skandals, basierend auf den Recherchen von Lilienthal. Es beleuchtet die Verbindungen zwischen der ARD, den Produktionsfirmen und den Placement-Agenturen, die für die Vermittlung der Werbedeals zuständig waren.
Begriffsklärungen und Abgrenzungen zwischen Werbung und Schleichwerbung: Dieses Kapitel analysiert die Definitionen von „Werbung“ und „Schleichwerbung“ aus verschiedenen Perspektiven (Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaft, Medienpolitik) und arbeitet die Kriterien für die Unterscheidung heraus. Es präsentiert verschiedene Erscheinungsformen und Beispiele aus dem ARD-Schleichwerbeskandal, insbesondere aus „Marienhof“ und „Tatort“. Es betrachtet auch Product Placement im ZDF zum Vergleich.
Der rechtliche Rahmen zur Rundfunkwerbung im Überblick: Dieses Kapitel analysiert den rechtlichen Rahmen, der die Rundfunkwerbung in Deutschland regelt. Es beleuchtet berufsethische Richtlinien, nationale und internationale Mediengesetzgebung (inkl. EU-Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ und Rundfunkstaatsverträge), Kontrollgremien und Sanktionsmöglichkeiten. Der Fokus liegt auf dem Trennungsgebot von Werbung und Programm sowie den Aspekten der journalistischen Glaubwürdigkeit und Transparenz.
Aktuelle Zahlen zur Medienrezeption und zu den Werbeumsätzen der TV-Sender: Dieses Kapitel präsentiert Daten zur Mediennutzung und Werbeumsätzen im deutschen Fernsehen. Die Zahlen sollen die Bedeutung des Fernsehens als Werbemedium belegen und die wirtschaftlichen Motive hinter Schleichwerbung im Kontext des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verdeutlichen. Zusätzlich werden Umfragen zur Zuschauerwahrnehmung von Schleichwerbung und zur Frage der Legalisierung von Product Placement vorgestellt.
Die Rezeption von Fernsehwerbung durch den Zuschauer: Dieses Kapitel analysiert die Rezeption von Fernsehwerbung aus medienpsychologischer Sicht. Es untersucht die Wahrnehmung und Beurteilung von Werbeformen durch den Zuschauer, unter Bezugnahme auf verschiedene Modelle wie das Werbewirkungsmodell nach MacInnis & Jaworski und das Elaboration-Likelihood-Modell nach Petty & Cacioppo. Die „Theorie der Reaktanz“ wird herangezogen, um das ausweichende Verhalten der Zuschauer gegenüber Werbung zu erklären.
FAQ: ARD-Schleichwerbeskandal – Eine umfassende Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den ARD-Schleichwerbeskandal umfassend. Sie untersucht die Grenzen zwischen Werbung und Schleichwerbung, die Ursachen des Skandals und die beteiligten Akteure (ARD, Produktionsfirmen, Placement-Agenturen). Dabei werden rechtswissenschaftliche, medienpsychologische und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter: die Chronologie des Skandals, die begriffliche Abgrenzung von Werbung und Schleichwerbung (inkl. verschiedener Erscheinungsformen wie Visual und Verbal Placement), den rechtlichen Rahmen (berufsethische Richtlinien, nationale und internationale Gesetzgebung, Kontrollmechanismen und Sanktionen), aktuelle Daten zur Medienrezeption und Werbeumsätze, die medienpsychologische Rezeption von Fernsehwerbung durch den Zuschauer (inkl. relevanter Modelle wie MacInnis & Jaworski und Petty & Cacioppo) und die Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Kapitel: Einleitung, Chronologie des ARD-Schleichwerbeskandals, Begriffliche Abgrenzung von Werbung und Schleichwerbung, Rechtlicher Rahmen zur Rundfunkwerbung, Aktuelle Zahlen zur Medienrezeption und Werbeumsätze, Rezeption von Fernsehwerbung durch den Zuschauer und Zusammenfassung und Ausblick.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einer detaillierten Darstellung der Ereignisse im ARD-Schleichwerbeskandal. Es folgt eine gründliche Klärung der Begriffe „Werbung“ und „Schleichwerbung“ mit verschiedenen Beispielen. Der rechtliche Rahmen wird ausführlich beleuchtet, gefolgt von einer Präsentation relevanter Statistiken zur Mediennutzung und Werbeumsätzen. Die Arbeit schließt mit einer medienpsychologischen Analyse der Zuschauerrezeption und einer abschließenden Zusammenfassung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der rechtswissenschaftliche, medienpsychologische und wirtschaftswissenschaftliche Perspektiven integriert. Sie stützt sich auf Recherchen, statistische Daten und die Analyse medienpsychologischer Modelle.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den ARD-Schleichwerbeskandal umfassend zu analysieren, die Grenzen zwischen Werbung und Schleichwerbung klar zu definieren und die Ursachen für das Entstehen von Schleichwerbung zu untersuchen. Sie möchte ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen, rechtlichen und psychologischen Aspekte dieses Phänomens ermöglichen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Recherchen von Lilienthal und weitere Quellen, die im Text explizit genannt werden (z.B. EMNID-Umfragen, EU-Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“, Rundfunkstaatsverträge, Werberichtlinien von ARD und ZDF).
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich mit den Themen Schleichwerbung, Medienrecht, Medienpsychologie, öffentlichem Rundfunk und Medienökonomie beschäftigen. Dies umfasst Wissenschaftler, Studierende, Medienmacher und alle interessierten Bürger.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln sind im Inhaltsverzeichnis der Arbeit enthalten (siehe oben).
- Quote paper
- Clemens Schnur (Author), 2006, Der ARD-Schleichwerbeskandal - Zu den Grenzen zwischen Werbung und Schleichwerbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61446