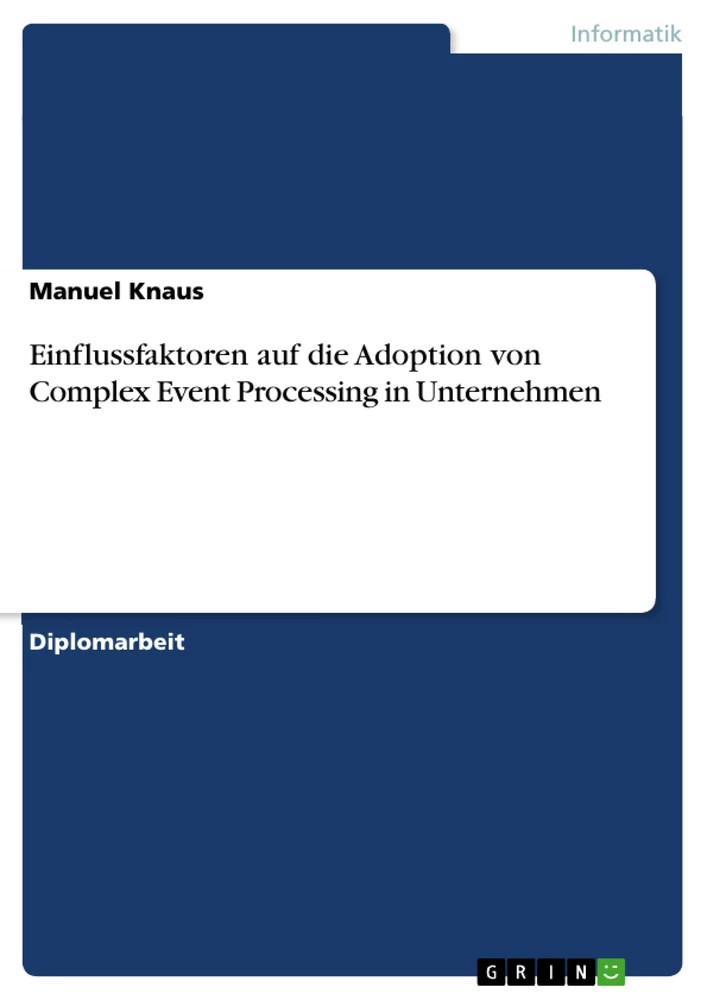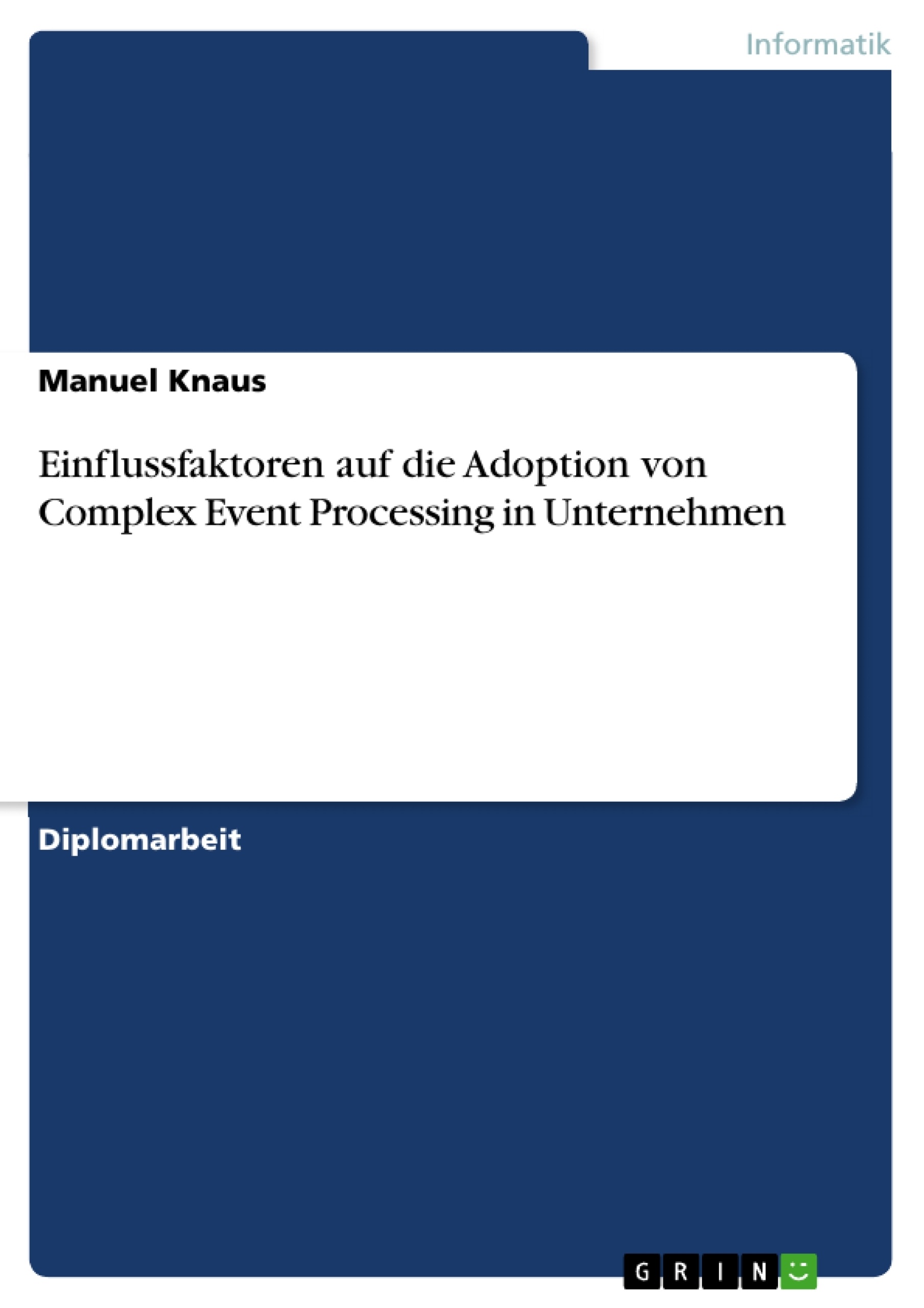Flexible, standardisierte und prozessorientierte Architekturen in der IT stellen für immer mehr Unternehmen ein Bestandteil einer zukunftsweisenden IT-Strategie dar. Mit Konzepten wie Enterprise Application Integration (EAI) und Service Oriented Architecture (SOA) haben viele Unternehmen bereits diesen Weg eingeschlagen.
Neben diesen Konzepten rückt in Wissenschaft und Praxis seit kurzem auch das Konzept des Complex Event Processing (CEP) in den Vordergrund, eine neue IT-Technologie, mit deren Hilfe Informationen aus einem IT-System extrahiert werden, um eine Echtzeit-Bewältigung von IT-Managementaufgaben in Unternehmen erreichen zu können. CEP kann sowohl basierend auf einer EAI- bzw. SOA-Architektur, als auch ohne eine dieser Architekturen umgesetzt werden, und ist dadurch sehr flexibel. CEP wird bereits von einigen Unternehmen eingesetzt und könnte für viele Unternehmen einen interessanten Ansatz für ihre zukünftige IT-Strategie darstellen.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist CEP ein sehr interessantes Konzept, da es erst vor kurzem entwickelt wurde, vorhandene Ideen und Konzepte aus der Wirtschaftinformatik aufgreift und einbindet, sowie eine mögliche Erweiterung von SOA darstellt. Die wenigen, bisher vorhandenen Arbeiten zum Thema CEP beschäftigen sich überwiegend mit Einzelanwendungen, mit der zugrunde liegenden Entscheidungstechnologie und mit dem Event Processing Netzwerk (EPN), einem Kernmodul von CEP, das mit Hilfe von Agenten die Events verarbeitet und Ausgaben produziert. Im Bereich der Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten sowie bei Problemstellungen bzgl. der Einführung von CEP gibt es noch großen Forschungsbedarf.
Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Faktoren die Einführung von CEP in Unternehmen fördern bzw. hemmen, ob eine Einführung von CEP empfehlenswert ist, welche Punkte ein Unternehmen bei der Einführung beachten muss und wie CEP in eine vorhandene IT-Strategie eingebunden werden kann.
Für Praktiker ist diese Arbeit mit ihren Ergebnissen relevant, da sie einen Überblick über CEP und dessen Einbindung in IT-Architekturen gibt sowie eine Unterstützung bei der Planung und Einführung von CEP in Unternehmen bietet. Der Entscheidungsfindungsprozess, ob eine CEP-Einführung im Unternehmen stattfinden soll, kann ebenso durch diese Arbeit unterstützt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Relevanz
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Informationstechnologie im Unternehmen
- 2.1.1 Strategie
- 2.1.2 Architektur
- 2.1.3 Architekturmodelle
- 2.2 Verteilte Systeme und Middleware
- 2.2.1 Verteilte Systeme
- 2.2.2 Middleware
- 2.3 Enterprise Application Integration
- 2.3.1 Einführung
- 2.3.2 Enterprise Service Bus
- 2.3.3 EAI-Modell
- 2.4 Service Oriented Architecture
- 2.4.1 Geschäftsprozessorientierung
- 2.4.2 Serviceorientierung
- 2.4.3 Aufbau einer SOA
- 2.5 Complex Event Processing
- 2.5.1 Events und deren Eigenschaften
- 2.5.2 Definition und Zielsetzung
- 2.5.3 Eventverarbeitende Agenten
- 2.5.4 Eventverarbeitende Netzwerke
- 2.5.5 Event-Service
- 2.5.6 Anzeige- und Analysemöglichkeiten
- 2.5.7 Architektur
- 2.5.8 Implementationen auf dem Softwaremarkt
- 2.5.9 Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten
- 3 Einflussfaktoren auf die Adoption von CEP
- 3.1 Forschungsmethodik
- 3.2 Grundlegende Theorien
- 3.2.1 Innovation Diffusion Theory
- 3.2.2 Technology Acceptance Model
- 3.2.3 Prozess der technologischen Innovation
- 3.2.4 Ansatz der Wissensbarrieren
- 3.3 Literatursynopse
- 3.3.1 Einflussfaktoren auf die Adoption von IT-Technologien
- 3.3.2 Erkenntnisse
- 3.4 Aufstellen der Propositionen
- 3.4.1 Wissensbarrieren bzgl. CEP
- 3.4.2 Einstellung des Unternehmens bzgl. Innovationen
- 3.4.3 Notwendigkeit von Geschäftsunterstützung in Echtzeit
- 3.4.4 Notwendigkeit von Event-Mining
- 3.4.5 Notwendigkeit von dynamischem Monitoring
- 3.4.6 Technische Kompatibilität
- 3.4.7 Kompatibilität bzgl. Anforderungen
- 3.4.8 Leichte Verwaltbarkeit
- 3.5 Theoretischer Bezugsrahmen
- 4 Fallstudien
- 4.1 Vorgehensweise
- 4.2 Fallstudie Bank A
- 4.2.1 Einführung
- 4.2.2 Adoptionsabsicht
- 4.2.3 Wissensbarrieren bzgl. CEP
- 4.2.4 Einstellung bzgl. Innovationen
- 4.2.5 Notwendigkeit von Geschäftsunterstützung in Echtzeit
- 4.2.6 Notwendigkeit von Event-Mining
- 4.2.7 Notwendigkeit für dynamisches Monitoring
- 4.2.8 Technische Kompatibilität
- 4.2.9 Kompatibilität bzgl. Anforderungen
- 4.2.10 Leichte Verwaltbarkeit
- 4.3 Fallstudie Bank B
- 4.3.1 Einführung
- 4.3.2 Adoptionsabsicht
- 4.3.3 Wissensbarrieren bzgl. CEP
- 4.3.4 Einstellung bzgl. Innovationen
- 4.3.5 Notwendigkeit für Echtzeit
- 4.3.6 Notwendigkeit für Event-Mining
- 4.3.7 Notwendigkeit für dynamisches Monitoring
- 4.3.8 Technische Kompatibilität
- 4.3.9 Kompatibilität bzgl. Anforderungen
- 4.3.10 Leichte Verwaltbarkeit
- 4.4 Fallstudie Bank C
- 4.4.1 Einführung
- 4.4.2 Adoptionsabsicht
- 4.4.3 Wissensbarrieren bzgl. CEP
- 4.4.4 Einstellung bzgl. Innovationen
- 4.4.5 Notwendigkeit für Echtzeit
- 4.4.6 Notwendigkeit für Event-Mining
- 4.4.7 Notwendigkeit für dynamisches Monitoring
- 4.4.8 Technische Kompatibilität
- 4.4.9 Kompatibilität bzgl. Anforderungen
- 4.4.10 Leichte Verwaltbarkeit
- 4.5 Fallstudie Bank D
- 4.5.1 Einführung
- 4.5.2 Adoptionsabsicht
- 4.5.3 Wissensbarrieren bzgl. CEP
- 4.5.4 Einstellung bzgl. Innovationen
- 4.5.5 Notwendigkeit für Echtzeit
- 4.5.6 Notwendigkeit für Event-Mining
- 4.5.7 Notwendigkeit für dynamisches Monitoring
- 4.5.8 Technische Kompatibilität
- 4.5.9 Kompatibilität bzgl. Anforderungen
- 4.5.10 Leichte Verwaltbarkeit
- Analyse der relevanten theoretischen Modelle zur Erklärung der IT-Adoption
- Identifizierung von Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Implementierung von CEP
- Bewertung der Einsatzmöglichkeiten von CEP in verschiedenen Geschäftsbereichen
- Untersuchung der Herausforderungen und Chancen der CEP-Adoption
- Analyse der empirischen Daten aus Fallstudien zur Bestätigung der theoretischen Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Adoption von Complex Event Processing (CEP) in Unternehmen. Sie untersucht die Einflussfaktoren, die Unternehmen bei der Entscheidung für oder gegen die Implementierung von CEP-Systemen beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet die relevanten theoretischen Rahmenbedingungen und erforscht anhand von Fallstudien die Praxis der CEP-Adoption in der Finanzbranche.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung der Diplomarbeit ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext der Digitalisierung. Das zweite Kapitel bietet eine detaillierte Darstellung der relevanten begrifflichen Grundlagen, insbesondere der Bereiche Informationstechnologie, verteilter Systeme, Enterprise Application Integration und Service Oriented Architecture. Es beleuchtet zudem die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten von Complex Event Processing im Detail.
Kapitel drei beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren, die Unternehmen bei der Entscheidung für oder gegen die Adoption von CEP-Systemen beeinflussen. Hier werden relevante Theorien wie die Innovation Diffusion Theory und das Technology Acceptance Model vorgestellt. Zudem werden anhand einer Literatursynopse relevante Erkenntnisse aus der Forschung zum Thema IT-Adoption zusammengefasst. Die Kapitel gipfeln in der Aufstellung von Propositionen, die als Grundlage für die anschließende Analyse der Fallstudien dienen.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Fallstudien, die in vier verschiedenen Banken durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der Fallstudien werden anhand der zuvor aufgestellten Propositionen analysiert und in Bezug auf die relevanten Einflussfaktoren interpretiert.
Schlüsselwörter
Complex Event Processing (CEP), IT-Adoption, Einflussfaktoren, Fallstudien, Finanzbranche, Innovation Diffusion Theory, Technology Acceptance Model, Wissensbarrieren, Echtzeit-Geschäftsunterstützung, Event-Mining, Dynamisches Monitoring, Technische Kompatibilität, Anforderungen, Verwaltbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Complex Event Processing (CEP)?
CEP ist eine IT-Technologie zur Echtzeit-Verarbeitung von Informationen aus IT-Systemen, um Managementaufgaben sofort bewältigen zu können.
Welche Faktoren hemmen die Einführung von CEP in Unternehmen?
Wissensbarrieren, mangelnde technische Kompatibilität und hohe Anforderungen an die Verwaltbarkeit können die Adoption behindern.
In welcher Branche wurden die Fallstudien durchgeführt?
Die empirischen Untersuchungen und Fallstudien dieser Arbeit konzentrieren sich auf den Bankensektor bzw. die Finanzbranche.
Wie hängen SOA und CEP zusammen?
CEP kann als eine Erweiterung der Service Oriented Architecture (SOA) betrachtet werden, die ereignisgesteuerte Reaktionen in Echtzeit ermöglicht.
Welche theoretischen Modelle werden zur Erklärung der Adoption genutzt?
Die Arbeit nutzt unter anderem die Innovation Diffusion Theory und das Technology Acceptance Model (TAM).
- Citar trabajo
- Manuel Knaus (Autor), 2006, Einflussfaktoren auf die Adoption von Complex Event Processing in Unternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61443