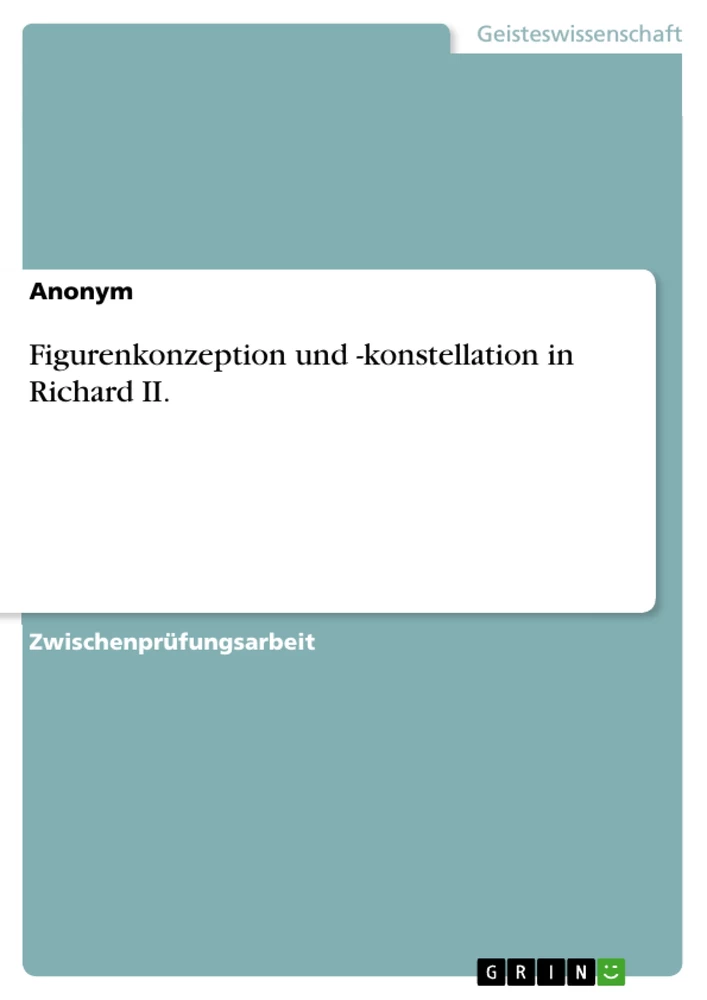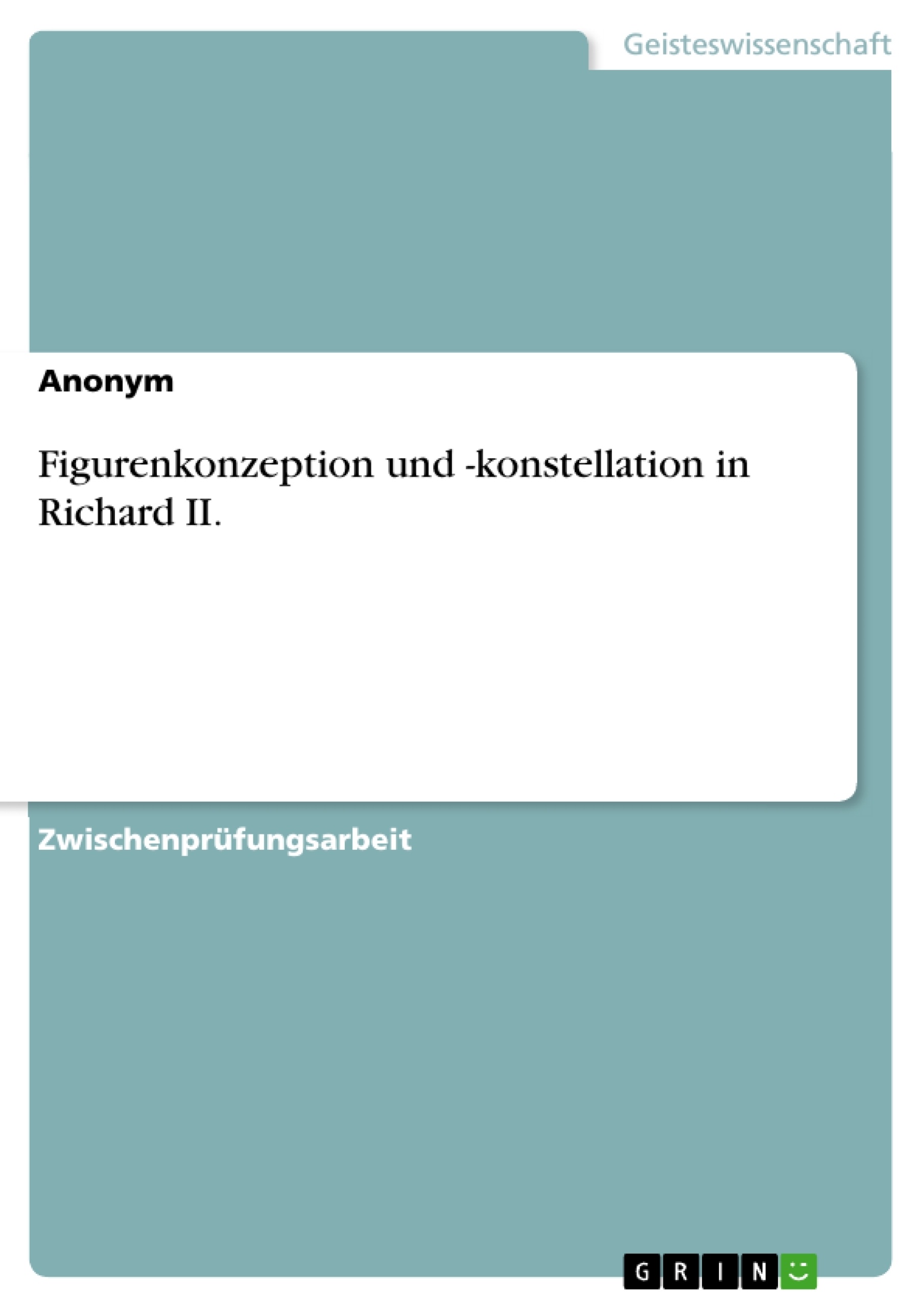William Shakespeare (1564-1616), Dichter und Dramatiker, war einer der bekanntesten Literaten seiner Zeit und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Seine Werke spiegeln das elisabethanische Denken, das Weltbild und die Liebe zur Sprache wider. Will man Shakespeare verstehen, so ist es sinnvoll, diese Dinge zu kennen. So war zum Beispiel das Theater der Elisabethaner das Unterhaltungsmedium der einfachen Massen. Die Zuschauer finanzierten mit ihrem Eintrittsgeld diese Theater, da sie nicht staatlich unterhalten wurden. Das Interesse der Geistlichkeit und des kommunalpolitischen Bürgertums war ganz anderer Natur. Sie sahen in den Theatern einen Ort der Sünde und des Sittenverfalls, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Im Gegensatz dazu wurden die damals sehr beliebten Tierhetzjagden, in denen Tiere grausam gequält wurden, ohne jegliche Kritik gebilligt, was für das heutige Verständnis kaum denkbar ist. Der Wunsch der Elisabethaner nach Unterhaltung war immens. Von der Komödie bis zur Tragödie mußte der Unterhaltungsanspruch befriedigt werden. So kam es, daß die Literaten der damaligen Zeit den Zuschauer von vornherein in die Konzeption ihrer Stücke mit einbezogen. Dies zeigte sich zum Beispiel darin, daß der Zuschauer größtenteils mehr wußte als die Protagonisten auf der Bühne und diese den Zuschauer teilweise auch direkt ansprachen. Ebenfalls wichtig für das Verständnis der Stücke Shakespeares ist das Wissen um die Weltanschauung der Elisabethaner, da Shakespeare in seinen Stücken gerne darauf hinwies. Das Weltbild der Elisabethaner reduzierte sich auf einen gemeinsamen Wissensstand der Zeit. Ihre Welt wurde als eine allumfassende Ordnung, den sog. „frame of order“ angesehen. Diese Ordnung galt als „von Gott geschaffen“, sie mußte daher anerkannt werden. Gott, der Urheber allen Seins und der Seinszusammenhänge hatte neben dem „frame of order“ auch das Prinzip des „degree“ geschaffen. Diese Rangordnung wies dem Menschen anhand seines sozialen Ranges einen Platz innerhalb der Hierarchie zu. Der Platz definierte die Stellung des Menschen in der Gesellschaft, die unter keinen Umständen verändert werden durfte. Somit zeigt sich ein streng hierarchisch gegliedertes Gesellschaftssystem, welches zugleich religiös geprägt ist. Gott bestimmt nicht nur die Stellung des Menschen, sondern er lenkt auch die politische Macht. Er bestimmt einen König und verleitet somit zu einer monarchistischen Weltanschauung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inhaltsangabe
- 3. Figurenkonzeption
- 3.1. Allgemein
- 3.2. Richard
- 3.3. Bolingbroke
- 3.4. Mowbray
- 3.5. Johann von Gaunt / Edmund von Langley
- 3.6. Henry Green / John Bushy / John Bagot
- 3.7. Herzog von Aumerle
- 3.8. Die sonstigen Personen
- 4. Figurenkonstellation
- 5. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figurenkonzeption und -konstellation in Shakespeares Richard II. Ziel ist es, die Charaktere im Kontext des elisabethanischen Weltbildes und Denkens zu analysieren und ihre Beziehungen zueinander zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der zentralen Figuren und deren Interaktionen, um ein tieferes Verständnis des Dramas zu ermöglichen.
- Das elisabethanische Weltbild und seine Auswirkungen auf die Figuren
- Die Charakterisierung Richards II. und seiner Widersacher
- Die Machtstrukturen und Konflikte im Stück
- Die Rolle der Sprache in Shakespeares Drama
- Die Figurenbeziehungen und ihre Dynamik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Werk Shakespeares und den Kontext seiner Entstehung ein. Sie beleuchtet das elisabethanische Theater, die gesellschaftlichen und religiösen Einflüsse der Zeit sowie die Bedeutung der Sprache in Shakespeares Dramen. Die Autorin betont die Notwendigkeit, diese Aspekte zu verstehen, um Shakespeares Werke adäquat zu interpretieren. Die Einleitung schafft den Rahmen für die anschließende Analyse der Figuren und ihrer Konstellation in Richard II., indem sie den historischen und kulturellen Hintergrund des Dramas skizziert und die Bedeutung des elisabethanischen Weltbildes hervorhebt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des „frame of order“ und des „degree“ als prägende Prinzipien der damaligen Gesellschaft.
3. Figurenkonzeption: Dieses Kapitel analysiert die Figurenkonzeption des Dramas. Es beschreibt die einzelnen Charaktere – Richard II., Bolingbroke, Mowbray, Johann von Gaunt, Edmund von Langley, Henry Green, John Bushy, John Bagot, den Herzog von Aumerle und die sonstigen Personen – detailliert. Die Analyse bezieht sich auf die Definition von Manfred Pfister und die im Seminar erarbeiteten Inhalte. Es wird die individuelle Charakterisierung jeder Figur beleuchtet und deren Bedeutung für die Handlung und die Gesamtaussage des Stückes herausgearbeitet. Die Interaktionen und Beziehungen zwischen den Figuren werden vorbereitet für die Analyse in Kapitel 4.
4. Figurenkonstellation: Dieses Kapitel analysiert die Beziehungen und Interaktionen zwischen den einzelnen Figuren, aufbauend auf den Einzelanalysen im vorherigen Kapitel. Es wird die Dynamik der Machtverhältnisse und Konflikte zwischen den Protagonisten untersucht, wobei die Bedeutung der jeweiligen Charaktereigenschaften und deren Einfluss auf die Handlung im Mittelpunkt steht. Die Analyse wird die Verbindungen und Abhängigkeiten der Figuren verdeutlichen und so ein umfassenderes Verständnis der Handlung und der politischen Intrigen in Shakespeares Richard II. ermöglichen. Die Konstellation der Figuren wird im Kontext des elisabethanischen Weltbildes und der damals vorherrschenden Machtstrukturen interpretiert.
Schlüsselwörter
Shakespeare, Richard II., Figurenkonzeption, Figurenkonstellation, elisabethanisches Weltbild, Gottesgnadentum, Macht, Rangordnung, Sprache, Drama, Konflikt, Tragödie.
Häufig gestellte Fragen zu: Shakespeare's Richard II - Figurenkonzeption und -konstellation
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Figurenkonzeption und -konstellation in Shakespeares Richard II. Sie untersucht die Charaktere im elisabethanischen Kontext, ihre Beziehungen und die Auswirkungen des elisabethanischen Weltbildes auf das Drama. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Figurencharakterisierung, eine Analyse der Figurenkonstellation und ein Nachwort. Kapitelübersichten und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung, 2. Inhaltsangabe, 3. Figurenkonzeption (mit Unterkapiteln zu einzelnen Figuren), 4. Figurenkonstellation und 5. Nachwort. Die Kapitel 3 und 4 bilden den Kern der Analyse.
Welche Figuren werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die folgenden Figuren detailliert: Richard II., Bolingbroke, Mowbray, Johann von Gaunt, Edmund von Langley, Henry Green, John Bushy, John Bagot, den Herzog von Aumerle und weitere Nebenfiguren. Die Analyse berücksichtigt die Charakterisierung jeder Figur und deren Bedeutung für die Handlung.
Wie wird die Figurenkonzeption analysiert?
Die Figurenkonzeption wird anhand der Definition von Manfred Pfister und den im Seminar erarbeiteten Inhalten analysiert. Es wird die individuelle Charakterisierung jeder Figur beleuchtet und deren Bedeutung für die Handlung und die Gesamtaussage des Stückes herausgearbeitet.
Wie wird die Figurenkonstellation analysiert?
Die Figurenkonstellation wird durch die Analyse der Beziehungen und Interaktionen zwischen den einzelnen Figuren untersucht. Die Dynamik der Machtverhältnisse und Konflikte zwischen den Protagonisten steht im Mittelpunkt. Die Analyse verdeutlicht die Verbindungen und Abhängigkeiten der Figuren und ermöglicht ein umfassenderes Verständnis der Handlung und der politischen Intrigen.
Welchen Kontext berücksichtigt die Analyse?
Die Analyse berücksichtigt den Kontext des elisabethanischen Weltbildes, das elisabethanische Theater, die gesellschaftlichen und religiösen Einflüsse der Zeit und die Bedeutung der Sprache in Shakespeares Dramen. Die Konzepte von "frame of order" und "degree" als prägende Prinzipien der damaligen Gesellschaft spielen eine wichtige Rolle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit beschreiben, sind: Shakespeare, Richard II., Figurenkonzeption, Figurenkonstellation, elisabethanisches Weltbild, Gottesgnadentum, Macht, Rangordnung, Sprache, Drama, Konflikt, Tragödie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Figurenkonzeption und -konstellation in Shakespeares Richard II. zu untersuchen und die Charaktere im Kontext des elisabethanischen Weltbildes und Denkens zu analysieren. Die Beziehungen der Figuren zueinander werden beleuchtet, um ein tieferes Verständnis des Dramas zu ermöglichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themenschwerpunkte: Das elisabethanische Weltbild und seine Auswirkungen auf die Figuren, die Charakterisierung Richards II. und seiner Widersacher, die Machtstrukturen und Konflikte im Stück, die Rolle der Sprache in Shakespeares Drama und die Figurenbeziehungen und ihre Dynamik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1999, Figurenkonzeption und -konstellation in Richard II., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60515