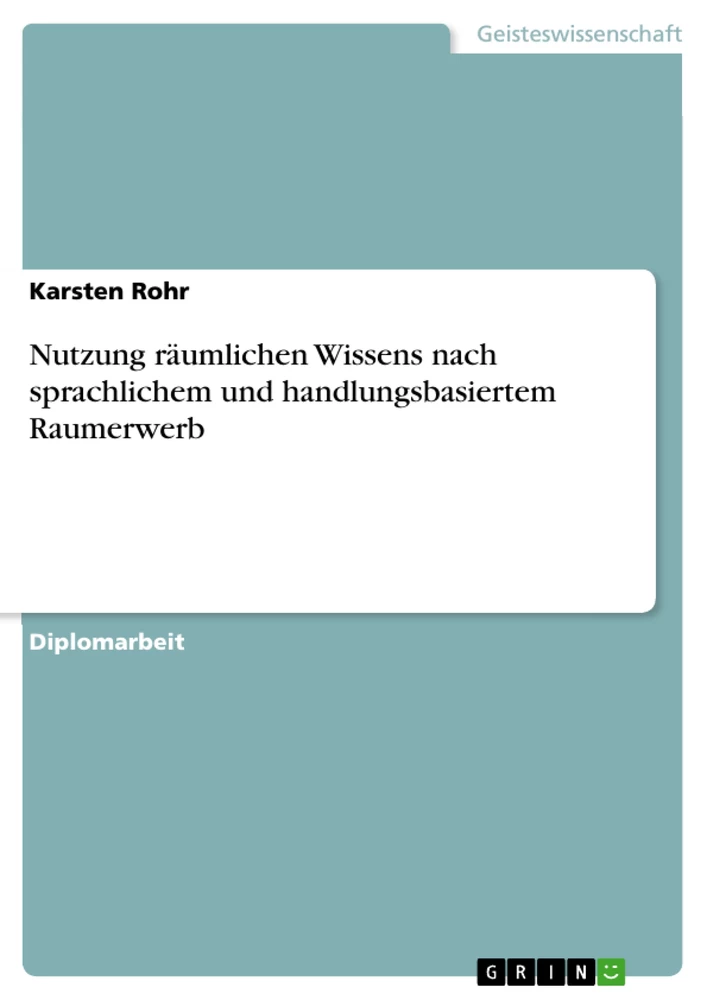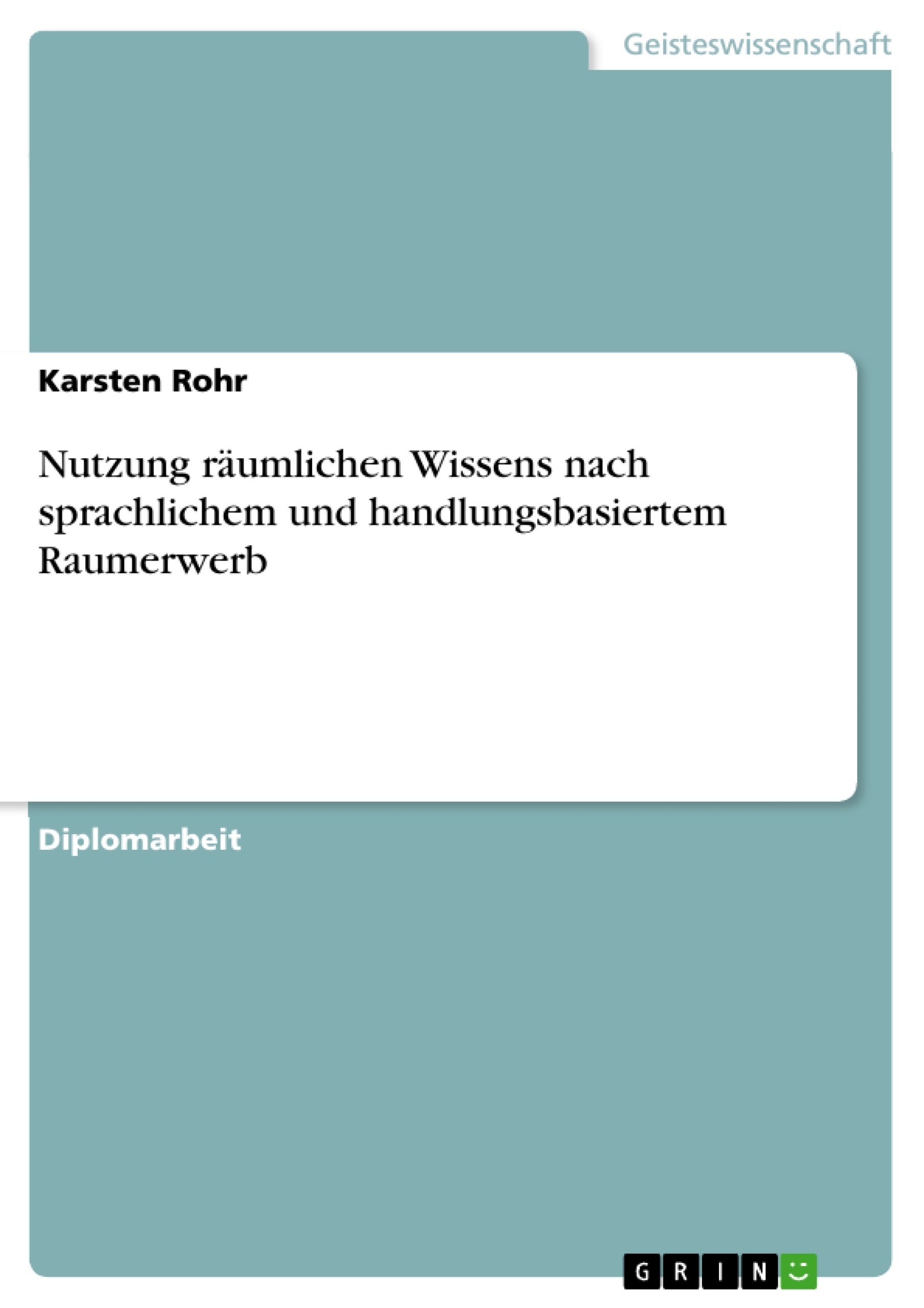Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie beobachten einen Bekannten, der hochkonzentriert vor dem Bildschirm seines Computers sitzt, die Maus mit seiner rechten Hand fest umklammert hält und mit der linken die Tastatur bedient. Sie stellen sich hinter ihrem Bekannten auf, schauen ihm über die Schulter und sehen links vom Bildschirm einen Stapel leerer Coladosen. Vor dem Dosenstapel steht ein prall gefüllter, gelber Plastikaschenbecher in Griffweite ihres Bekannten, an dessen Vorderseite die blaue Silhouette eines Kamels prangt. Sie blicken auf den Bildschirm und erkennen den Grund, warum ihr Bekannter ihre Anwesenheit bisher ignoriert hat. Er ist in ein Spiel vertieft, was zum Ziel hat, andere Mitspieler durch ein ganzes Arsenal an (virtuellen) Hieb-, Stich- und Schusswaffen zum (natürlich virtuellen) Ableben zu bewegen; kurz: ein sogenannter ‚Egoshooter’. Obschon Sie Gewalt in Videospielen nicht gutheißen, beobachten sie den Spielverlauf einige Zeit. Dabei fällt ihnen auf, dass ihr Bekannter jedes Mal, wenn sein virtuelles Alter Ego eine Zeit lang vor einer Hausecke stehen bleibt, seinen Oberkörper von links nach rechts bewegt und seltsam anmutende Kopfdrehungen vollführt. Auf ihre Frage, warum er sich so vor dem Bildschirm abmühe, antwortet er - nachdem er kurz über ihre Anwesenheit erschrickt -: ‚Ich muss um die Hausecke schauen, ob dort ein Scharfschütze ist.’ [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 PROBLEMSTELLUNG
- 2.1 Wissen und Können im Raum
- 2.1.1 Wissen und Können in der Theorie des menschlichen Gedächtnisses
- 2.1.2 Räumliches Wissen und räumliches Können – ein Arbeitsmodell
- 2.2 Mentale Raumrepräsentationen als Forschungsproblem
- 2.2.1 Eigenschaften mentaler Raumrepräsentationen
- 2.2.2 Wahrnehmungs-handlungsbasierte mentale Raumrepräsentationen
- 2.2.3 Sprachbasierte mentale Raumrepräsentationen
- 2.2.4 Konvergenzen und Divergenzen sprachlich und per Interaktion erworbenen Raumwissens
- 2.3 Raumaktualisierung und Perspektivenwechsel
- 2.3.1 Pfadintegration
- 2.3.1.1 Experimentelles Paradigma und Befunde
- 2.3.1.2 Modellannahmen zur Pfadintegration
- 2.3.2 Vorgestellte und ausgeführte räumliche Perspektivenwechsel
- 2.3.2.1 Experimentelles Paradigma und Befunde
- 2.3.2.2 Modellannahmen zugrunde liegender Mechanismen
- 2.3.1 Pfadintegration
- 2.4 Die Annahme einer funktionellen Äquivalenz
- 2.5 Fragestellung, Modellannahmen und Hypothesen
- 2.1 Wissen und Können im Raum
- 3 METHODE
- 3.1 Erstellung des Versuchsdrehbuchs und Vorversuche
- 3.2 Versuchspersonen
- 3.3 Apparate und Materialien
- 3.4 Versuchsablauf
- 3.4.1 Instruktionsphase
- 3.4.2 Lernphase
- 3.4.2.1 Lernmodus Sprache
- 3.4.2.2 Lernmodus Handlung
- 3.4.3 Übungsphase
- 3.4.3.1 Verwendung der Tastatur bei den Richtungsurteilen
- 3.4.3.2 Perspektivenwechsel
- 3.4.4 Testphase
- 3.4.5 Abschlussphase
- 3.4.6 Experimentelles Design
- 4 ERGEBNISSE
- 4.1 Vorgeschaltete Auswertungsschritte
- 4.1.1 Ausschluss von Probanden
- 4.1.2 Antwortverhalten
- 4.1.3 Ausreißereliminierung
- 4.1.4 Kontrollvariable wiederholte Wissenstests
- 4.2 Zentrale Resultate
- 4.2.1 Entscheidungslatenz
- 4.2.2 Fehler der Richtungsanzeigen
- 4.2.3 Untersuchung des Effektes der Perspektive auf die Entscheidungslatenzen
- 4.2.4 Ergebniszusammenfassung der eigenen Untersuchung
- 4.3 Interexperimentelle Vergleiche
- 4.3.1 Vergleich der Versuchsbedingungen
- 4.3.2 Ergebniserwartungen
- 4.3.3 Entscheidungslatenzen des Vorgängerexperiments
- 4.3.4 Interexperimentelle Ergebniszusammenfassung
- 4.1 Vorgeschaltete Auswertungsschritte
- 5 DISKUSSION
- 5.1 Zusammenfassung der Befunde
- 5.2 Wissensnutzung nach lokomotorischen Perspektivenwechseln
- 5.3 Wissensnutzung bei imaginierten Perspektivenwechseln
- 5.3.1 Die Modellvorstellung eines integrativen Kodes
- 5.3.2 Die Modellvorstellung einer separaten Kodierung
- 5.4 Weitere Effekte
- 5.4.1 Hauptachsen-Nebenachsen-Effekt
- 5.4.2 Korrelation Repositionierungszeit – Entscheidungslatenz
- 5.5 Fazit und Ausblick auf weitere Untersuchungen
- 6 ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Nutzung räumlichen Wissens nach sprachlichem und handlungsbasiertem Raumerwerb. Sie analysiert, ob und inwiefern sich die Art und Weise, wie räumliches Wissen erworben wird, auf die spätere Nutzung dieses Wissens auswirkt.
- Räumliches Wissen und Können
- Mentale Raumrepräsentationen
- Pfadintegration und Perspektivenwechsel
- Funktionelle Äquivalenz von sprachlichem und handlungsbasiertem Raumerwerb
- Empirische Untersuchung zur Nutzung räumlichen Wissens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Nutzung räumlichen Wissens ein und beschreibt den aktuellen Stand der Forschung. Kapitel 2 stellt die Problemstellung der Arbeit dar, definiert wichtige Begriffe und erläutert die theoretischen Grundlagen des Forschungsproblems. Dabei werden die Konzepte von Wissen und Können im Raum, mentale Raumrepräsentationen sowie die Mechanismen der Raumaktualisierung und des Perspektivenwechsels im Detail betrachtet. Die Fragestellung, die Modellannahmen und die Hypothesen der Arbeit werden ebenfalls in diesem Kapitel dargelegt. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Untersuchung, einschließlich des Versuchsdesigns, der Versuchspersonen, der Materialien und des Versuchsablaufs. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und analysiert. Die Diskussion in Kapitel 5 setzt sich mit den Ergebnissen auseinander, interpretiert die Befunde im Kontext der theoretischen Grundlagen und beleuchtet die Implikationen für die Forschung. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Räumliches Wissen, Mentale Raumrepräsentationen, Pfadintegration, Perspektivenwechsel, Lokomotion, Imagination, Sprachlicher Raumerwerb, Handlungsbasierter Raumerwerb, Funktionelle Äquivalenz, Empirische Untersuchung, Experiment, Entscheidungslatenzen, Fehleranalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen sprachlichem und handlungsbasiertem Raumerwerb?
Sprachlicher Raumerwerb erfolgt durch Beschreibungen, während handlungsbasierter Raumerwerb durch physische Interaktion oder Bewegung im Raum (z.B. in Videospielen) geschieht.
Was bedeutet "funktionelle Äquivalenz" in der Raumkognition?
Die Annahme besagt, dass räumliches Wissen, egal ob durch Sprache oder Handlung erworben, in ähnlichen mentalen Repräsentationen gespeichert und genutzt wird.
Was ist Pfadintegration?
Pfadintegration ist die Fähigkeit, die eigene Position und Orientierung im Raum allein durch die Verrechnung von Eigenbewegungen (lokomotorische Reize) ständig zu aktualisieren.
Wie beeinflusst ein Perspektivenwechsel die Nutzung von Raumwissen?
Vorgestellte Perspektivenwechsel führen oft zu längeren Entscheidungslatenzen und mehr Fehlern als tatsächlich ausgeführte Drehungen, da die mentale Umrechnung kognitiv anspruchsvoll ist.
Was sind Entscheidungslatenzen in diesem Experiment?
Entscheidungslatenzen messen die Zeit, die eine Person benötigt, um eine Richtung in einem gelernten Raum korrekt anzugeben. Sie dienen als Indikator für die Effizienz der mentalen Raumrepräsentation.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Päd. Karsten Rohr (Autor:in), 2006, Nutzung räumlichen Wissens nach sprachlichem und handlungsbasiertem Raumerwerb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59996