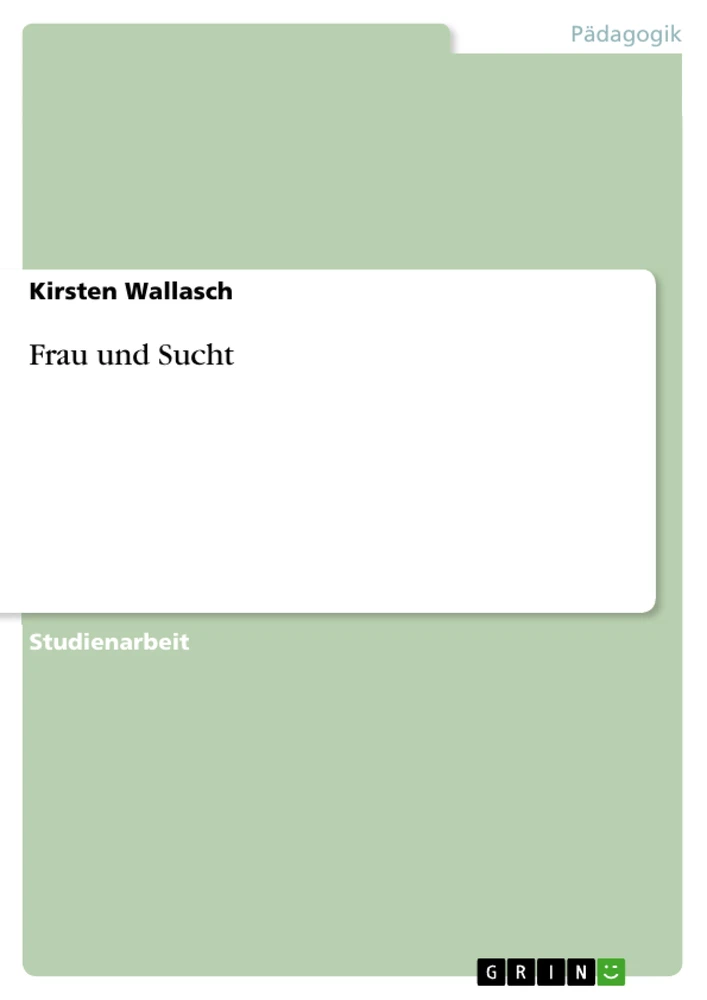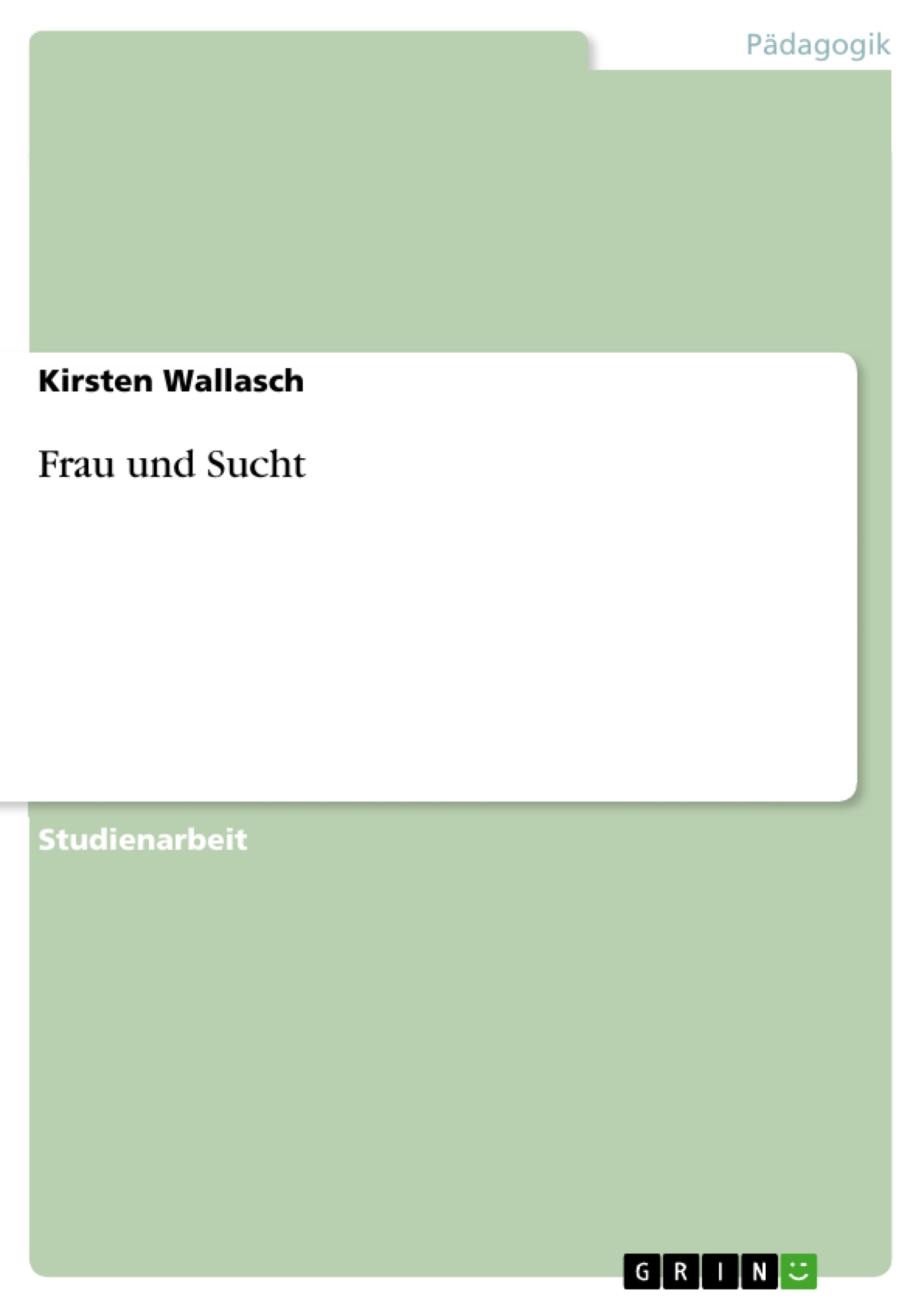Der Gebrauch von Drogen gehört seit je her zur Kultur des Menschen. Schon unsere Vorfahren zur Zeit des Paläolithikums kannten die berauschenden Wirkungen diverser psychotroper Pflanzen und machten sie sich in ihren magischmedizinischen Ritualen zu nutze. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte und Jahrtausende erweiterte sich stets das Spektrum der Drogen, die konsumiert wurden, ebenso wie der Kreis der Menschen, die sie gebrauchten. War ihr Verzehr in alten Gesellschaften und Zivilisationen oft nur Priestern oder Heilern zu rituellen Zwecken vorenthalten, so wurde ihr Verbrauch, auch zum Genuss, in späteren Epochen selbst für niedere Schichten möglich. Manche Drogen „schafften“ es bis in die heutige Zeit sogar zum Alltagsgetränk, wie zum Beispiel Alkohol in Form von Bier und Wein, wie auch Tee, Kaffee und Kakao. Und wenn auch schon im ausgehenden Mittelalter besonders die Kirche vor „Völlerei und Trunksucht“ (und das wohl eher zum Erlangen des Seelenheils, als zum Erhalt der Gesundheit) warnte, so entstand das landläufige Bewusstsein für die Risiken übermäßigen oder unkontrollierten Konsumierens von Alkohol und anderen berauschenden Substanzen erst später. Denn erst im 16./17. Jahrhundert, während der ersten europäischen „Drogenkrise“, wurde der maßlose Gebrauch von Alkohol gesellschaftlich problematisiert und auch der Konsum der neu eingeführten Genussmittel wie Tabak, Kakao und Kaffee wurde erstmals gesetzlich zu regulieren versucht. Ein „Sucht- bzw. Krankheitskonzept“ (für Alkohol) wurde allerdings erst im 18./19.Jahhundert entwickelt. Seit dem beschäftigen sich immer mehr wissenschaftliche Disziplinen, wie die Medizin, die Psychologie, die Soziologie und nicht zuletzt die Sozialwissenschaften (SozialarbeiterInnnen und SozialpädagogInnen), mit der Problematik der Suchtentstehung, ihrer Prävention, der Behandlung bzw. Heilung und gesellschaftliche Integrierung von (ehemals) Süchtigen. Dabei wurde allerdings all zu lang der Fokus auf süchtige Männer gelegt. „Erst seit Beginn der achtziger Jahre [des 20. Jahrhunderts] hat das Thema „Frauen und Sucht“ zunehmend an Bedeutung gewonnen - insbesondere dadurch, dass sich weibliche Forscher und Praktiker diesem Thema zuwandten und die spezifischen Voraussetzungen der Suchtentstehung und -verläufe bei Frauen aufdeckten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Abhängigkeit
- Sucht
- Unterschiedliches Suchtverhalten bei Frau und Mann
- Gesellschaftliche Ursachen für die Suchtentwicklung und Rolle der Frau aus sozialwissenschaftlicher Sicht
- Gibt es Unterschiede in der Behandlung von Mann und Frau?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Thema „Frauen und Sucht“ und widmet sich den spezifischen Aspekten des Suchtverhaltens bei Frauen im Vergleich zu Männern. Ziel ist es, die Ursachen und Hintergründe der Suchtentwicklung bei Frauen aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten. Darüber hinaus werden die Unterschiede im Suchtverhalten zwischen den Geschlechtern analysiert und die Frage nach möglichen Unterschieden in der Behandlung von männlichen und weiblichen Süchtigen beleuchtet.
- Begriffsdefinition von Abhängigkeit und Sucht
- Unterschiedliches Suchtverhalten bei Frauen und Männern
- Gesellschaftliche Ursachen für die Suchtentwicklung bei Frauen
- Rolle der Frau aus sozialwissenschaftlicher Sicht
- Unterschiede in der Behandlung von männlichen und weiblichen Süchtigen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Geschichte des Drogenkonsums und der Entwicklung des Bewusstseins für die Risiken von Sucht. Sie stellt fest, dass der Fokus in der Suchtforschung lange Zeit auf süchtigen Männern lag. Erst seit den 1980er Jahren gewinnen die spezifischen Voraussetzungen der Suchtentstehung und -verläufe bei Frauen zunehmend an Bedeutung.
Begriffsdefinitionen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Definitionen von Abhängigkeit und Sucht, wobei die Unterschiede zwischen beiden Begriffen hervorgehoben werden. Abhängigkeit wird als ein Zustand beschrieben, in dem ein Objekt, eine Beziehung oder eine Gewohnheit benötigt wird, um die eigene Existenz oder das eigene Wohlbefinden nicht zu gefährden. Sucht hingegen wird als ein krankhaftes Verlangen nach einer bestimmten Erfahrung verstanden, das alle anderen Werte und Aktivitäten des Individuums in den Hintergrund drängt.
Unterschiedliches Suchtverhalten bei Frau und Mann
Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Suchtverhaltensmuster von Frauen und Männern. Es wird deutlich, dass Frauen lange Zeit einem soziokulturellen Schutz gegen Suchtentwicklungen unterlagen. Die Veränderung des Frauenbildes im Zuge der Frauenbewegung hat jedoch dazu geführt, dass der Konsum von Drogen und die Suchtentwicklung bei Frauen zunehmend in den Fokus rücken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Kernthemen Suchtentwicklung, Abhängigkeit, Suchtverhalten, gesellschaftliche Ursachen, Frauenrolle, sozialwissenschaftliche Perspektive, Unterschiede in der Behandlung von Mann und Frau.
Häufig gestellte Fragen
Unterscheidet sich das Suchtverhalten von Frauen und Männern?
Ja, Frauen unterliegen oft anderen soziokulturellen Einflüssen und zeigen spezifische Voraussetzungen bei der Entstehung und dem Verlauf von Abhängigkeiten.
Was ist der Unterschied zwischen Sucht und Abhängigkeit?
Abhängigkeit ist ein Zustand der Notwendigkeit eines Objekts für das Wohlbefinden, während Sucht als krankhaftes Verlangen definiert wird, das alle anderen Werte verdrängt.
Welche gesellschaftlichen Ursachen gibt es für Sucht bei Frauen?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Frau aus sozialwissenschaftlicher Sicht, einschließlich veränderter Rollenbilder und spezifischer Belastungen in der Gesellschaft.
Warum wurde das Thema "Frau und Sucht" lange vernachlässigt?
In der Forschung lag der Fokus jahrzehntelang fast ausschließlich auf süchtigen Männern; erst seit den 1980er Jahren rückten geschlechtsspezifische Aspekte in den Fokus.
Gibt es Unterschiede in der Behandlung von Mann und Frau?
Die Ausarbeitung untersucht, inwiefern Therapiekonzepte auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Geschlechter angepasst werden müssen.
- Citation du texte
- Kirsten Wallasch (Auteur), 2006, Frau und Sucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59797