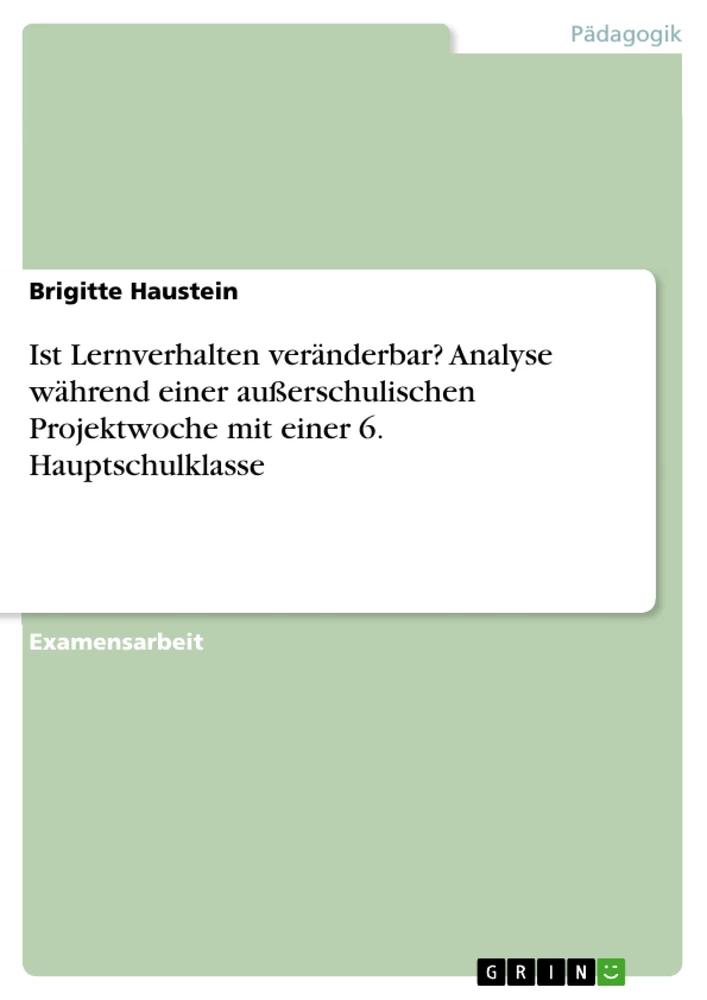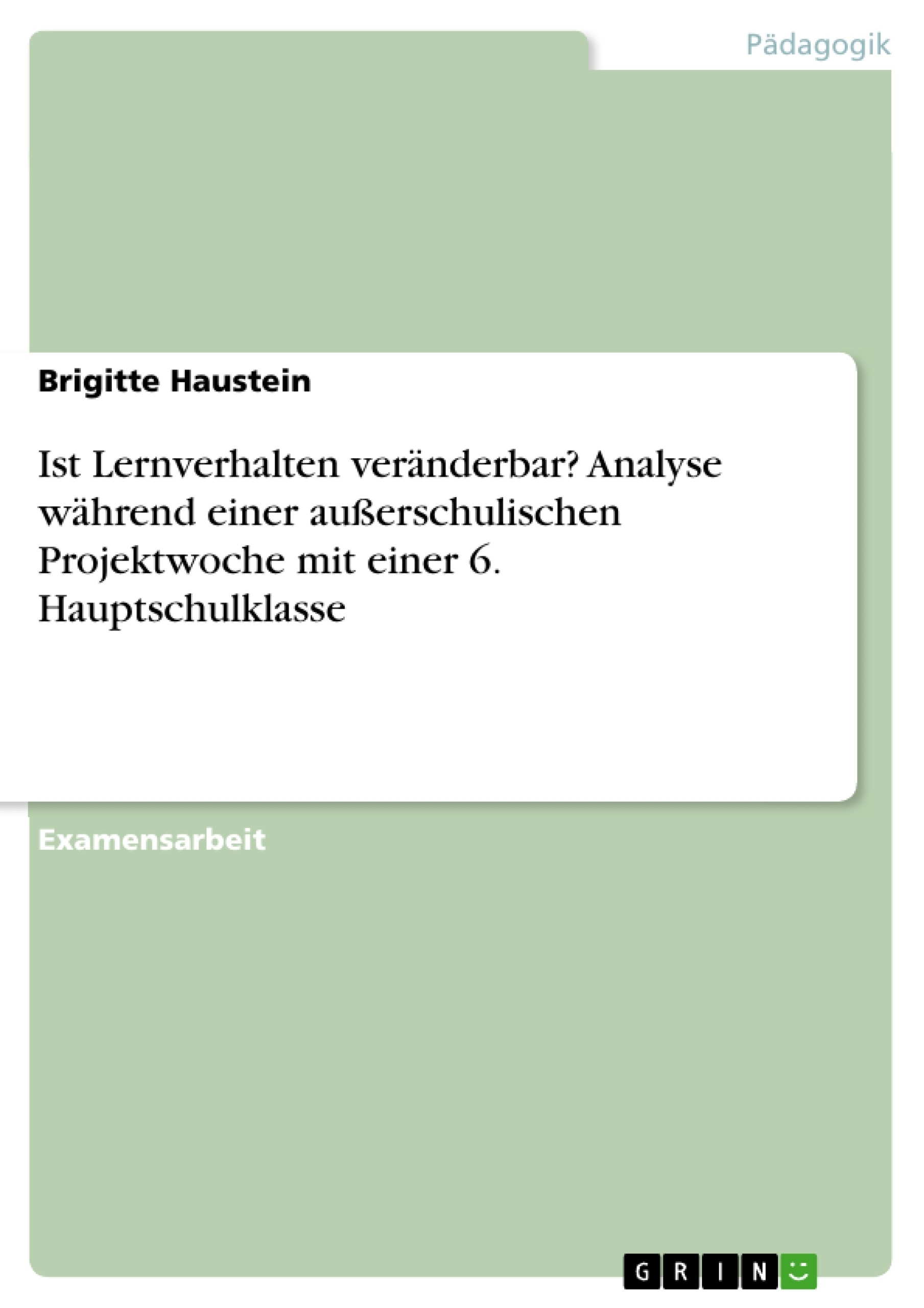Seit September 2003 unterrichte ich an der ###-Schule in ### die Fächer Mathematik, Biologie, Chemie und Wahlpflichtunterricht. Auffallend ist der große Anteil der Leistungsverweigerer. Infolgedessen verlassen in jedem Jahrgang einige Schüler nach der 7. oder 8. Klasse ohne Hauptschulabschluss die Schule. In der derzeitigen Klasse 6a unterrichte ich seit der 5. Klasse die Fächer Mathematik und Chemie (insgesamt 5-stündig). Der Reiz einer neuen Schule ließ bei den Schülern bereits in der 5. Klasse nach und sehr bald haben sich trotz vielfältiger Bemühungen der Lehrerinnen und Lehrer, dem entgegenzuwirken, bei einem großen Teil der Schüler dem Lernen nicht förderliche Verhaltensweisen herauskristallisiert. Die Situation verschärfte sich noch dadurch, dass zu Schuljahresbeginn die Klasse um drei Wiederholer auf 29 Mädchen und Jungen vergrößert wurde. Im Rahmen einer Aktionsforschung in der Eingangsphase der Ausbildung am Studienseminar Kleve habe ich im März 2004 Ursachen für Verzögerungen des Unterrichtsgeschehens in dieser Klasse aufgezeichnet (s. Anlage 1). Die meisten Ursachen für die Beeinträchtigungen des Unterrichtsablaufs und mithin auch des Lernerfolgs vieler Schüler liegen im Lernverhalten der Schüler. Aber ist Lernverhalten eine konstante Größe, oder lässt es sich unter geeigneten Bedingungen zumindest partiell beeinflussen? Welche Bereiche im Lernverhalten sind veränderbar? Gibt es allgemeine Gesetzmäßigkeiten, oder reagieren Schüler individuell? Welche Faktoren begünstigen ein positives Lernverhalten? Handlungsorientierter Unterricht wird sozialisationstheoretisch als „Reaktion auf gravierende Veränderungen in den Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen heute“ und lerntheoretisch als „Konsequenz aus grundlegenden Ergebnissen der modernen Lernforschung“ gesehen (GUDJONS 1997a, S. 111). Schließlich sieht GUDJONS handlungsorientierten Unterricht als „Versuch einer Antwort auf die herbe Kritik einer modernen Schule: Trennung von Schule und Leben, Verkopfung des Unterrichts, Entfremdung und fehlende Sinnhaftigkeit der Lernprozesse, Motivationsverlust, Schulfrust, Lehrerdominanz…“. Der Idealtypus handlungsorientierten Lernens ist nach BÖNSCH (1998) die Projektarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Ausgangssituation und Fragestellung
- Lernverhalten und Lerngruppe
- Lernverhalten - Begriff
- Lernverhalten der Schüler der Klasse 6a im Schulalltag
- Projektwoche
- Projektthema „Wildgänse am Niederrhein“ – Kurzinformation
- Legitimation
- Der Projektbegriff in der pädagogischen Literatur
- Darstellung der Projektwoche
- Charakterisierung
- Zeittafel
- Abfolge der Projekteinheiten
- Beschreibung ausgewählter Projekteinheiten
- Organisationsablauf
- Untersuchungsmethoden
- Unstrukturierte Beobachtungen an der Gesamtgruppe
- Strukturierte Beobachtungen an ausgewählten Schülern
- Einfache Programmreflexion
- Abschließende Reflexion über die Projektwoche im Vergleich zum Schulalltag
- Soziometrie
- Ergebnisse
- Unstrukturierte Beobachtungen an der Gesamtgruppe
- Strukturierte Beobachtungen an ausgewählten Schülern
- Einfache Programmreflexion
- Abschließende Reflexion über die Projektwoche im Vergleich zum Schulalltag
- Diskussion
- Variabilität im Lernverhalten
- Das Lernverhalten beeinflussende Faktoren
- Möglichkeiten und Grenzen im Schulalltag
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderbarkeit von Lernverhalten anhand einer außerschulischen Projektwoche mit einer 6. Hauptschulklasse. Die Studie analysiert, inwieweit sich das Lernverhalten der Schüler während dieser Woche im Vergleich zum Schulalltag verändert und welche Faktoren diese Veränderung beeinflussen.
- Analyse des Lernverhaltens von Hauptschülern
- Wirkung einer Projektwoche auf das Lernverhalten
- Identifikation lernverhaltenbeeinflussender Faktoren
- Vergleich von Lernverhalten in schulischem und außerschulischem Kontext
- Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Ausgangssituation und Fragestellung: Die Arbeit beginnt mit der Beschreibung der Ausgangssituation und der Forschungsfrage, die sich mit der Veränderbarkeit von Lernverhalten beschäftigt. Die Autorin erläutert den Kontext ihrer Untersuchung und begründet die Wahl der Methode, eine außerschulische Projektwoche mit einer 6. Hauptschulklasse zu analysieren. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert, die sich mit dem Einfluss der Projektwoche auf das Lernverhalten der Schüler auseinandersetzt.
Lernverhalten und Lerngruppe: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Lernverhalten“ und beschreibt das Lernverhalten der Schüler der Klasse 6a im Schulalltag. Es bietet einen Einblick in die Ausgangssituation der Lerngruppe und dient als Grundlage für den Vergleich mit dem Lernverhalten während der Projektwoche. Die Charakteristika der Schüler und ihrer Lernmuster werden detailliert dargestellt, um den späteren Vergleich zu ermöglichen. Die bereits bestehende Dynamik innerhalb der Klasse wird beschrieben, um den Einfluss der Projektwoche besser bewerten zu können.
Projektwoche: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Projektwoche zum Thema „Wildgänse am Niederrhein“. Es umfasst die didaktische Konzeption, die methodischen Ansätze, die inhaltliche Gestaltung und den organisatorischen Ablauf. Die Legitimation der gewählten Methode wird erläutert und in den Kontext pädagogischer Literatur eingeordnet. Es werden ausgewählte Projekteinheiten genauer beschrieben, um den Lernprozess während der Projektwoche zu illustrieren. Der Kapitel beinhaltet eine Zeittafel und eine Darstellung der Abfolge der einzelnen Projekteinheiten.
Untersuchungsmethoden: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Methoden, die zur Untersuchung des Lernverhaltens eingesetzt wurden. Es beschreibt die unstrukturierten und strukturierten Beobachtungen, die Programmreflexion und die Soziometrie. Die Wahl der Methoden wird begründet und ihre Eignung für die Beantwortung der Forschungsfrage erläutert. Der methodische Ansatz wird detailliert dargelegt, um die Validität und Reliabilität der Ergebnisse zu gewährleisten.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, basierend auf den im vorherigen Kapitel beschriebenen Methoden. Es werden die Ergebnisse der Beobachtungen, der Programmreflexion und der Soziometrie dargestellt und interpretiert. Die Daten werden übersichtlich präsentiert, um einen klaren Einblick in die Veränderungen des Lernverhaltens während der Projektwoche zu ermöglichen. Der Vergleich zum Schulalltag wird hier deutlich.
Diskussion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie diskutiert und interpretiert. Die Variabilität im Lernverhalten wird analysiert, und es werden Faktoren identifiziert, die das Lernverhalten beeinflusst haben. Die Autorin diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Schulalltag. Die Diskussion konzentriert sich auf die Interpretation der Ergebnisse im Lichte der Forschungsliteratur und der pädagogischen Praxis.
Schlüsselwörter
Lernverhalten, Projektwoche, Hauptschüler, außerschulischer Lernort, Beobachtung, Programmreflexion, Veränderbarkeit, Motivation, Gruppenarbeit, Wildgänse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Veränderbarkeit des Lernverhaltens durch eine Projektwoche
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie sich das Lernverhalten von Schülern einer 6. Hauptschulklasse während einer außerschulischen Projektwoche im Vergleich zum regulären Schulalltag verändert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Einflussfaktoren dieser Veränderung und der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Schulalltag.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie nutzt verschiedene Methoden zur Datenerhebung und -analyse: unstrukturierte und strukturierte Beobachtungen der Schüler, eine einfache Programmreflexion, eine abschließende Reflexion über die Projektwoche im Vergleich zum Schulalltag und Soziometrie. Diese Methoden ermöglichen eine umfassende Erfassung des Lernverhaltens in beiden Kontexten.
Was war das Thema der Projektwoche?
Die Projektwoche behandelte das Thema „Wildgänse am Niederrhein“. Die Arbeit beschreibt detailliert die didaktische Konzeption, die methodischen Ansätze, die inhaltliche Gestaltung und den organisatorischen Ablauf der Projektwoche.
Welche konkreten Fragestellungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das Lernverhalten von Hauptschülern, die Wirkung der Projektwoche auf das Lernverhalten, lernverhaltenbeeinflussende Faktoren, den Vergleich des Lernverhaltens im schulischen und außerschulischen Kontext und die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Schulalltag.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Ausgangssituation und Fragestellung, Lernverhalten und Lerngruppe, Projektwoche, Untersuchungsmethoden, Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Untersuchung, beginnend mit der Forschungsfrage und endend mit einer umfassenden Diskussion der Ergebnisse.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Lernverhalten, Projektwoche, Hauptschüler, außerschulischer Lernort, Beobachtung, Programmreflexion, Veränderbarkeit, Motivation, Gruppenarbeit und Wildgänse.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Beobachtungen, der Programmreflexion und der Soziometrie. Diese Ergebnisse werden interpretiert und im Hinblick auf die Variabilität im Lernverhalten und die lernverhaltenbeeinflussenden Faktoren diskutiert. Ein Vergleich zum Lernverhalten im Schulalltag wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Diskussion analysiert die Variabilität des Lernverhaltens, identifiziert Einflussfaktoren und bewertet die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Schulalltag. Die Schlussfolgerungen berücksichtigen die Ergebnisse im Kontext der pädagogischen Literatur und Praxis.
Wo finde ich eine detaillierte Beschreibung der Projektwoche?
Eine detaillierte Beschreibung der Projektwoche, inklusive Zeittafel, Abfolge der Projekteinheiten und Beschreibung ausgewählter Einheiten, findet sich im entsprechenden Kapitel der Arbeit.
Wie wird der Begriff „Lernverhalten“ definiert?
Der Begriff „Lernverhalten“ wird im Kapitel „Lernverhalten und Lerngruppe“ definiert und im Kontext der Untersuchung erläutert. Die Definition bildet die Grundlage für die Analyse des Lernverhaltens der Schüler.
- Citation du texte
- Brigitte Haustein (Auteur), 2005, Ist Lernverhalten veränderbar? Analyse während einer außerschulischen Projektwoche mit einer 6. Hauptschulklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59702