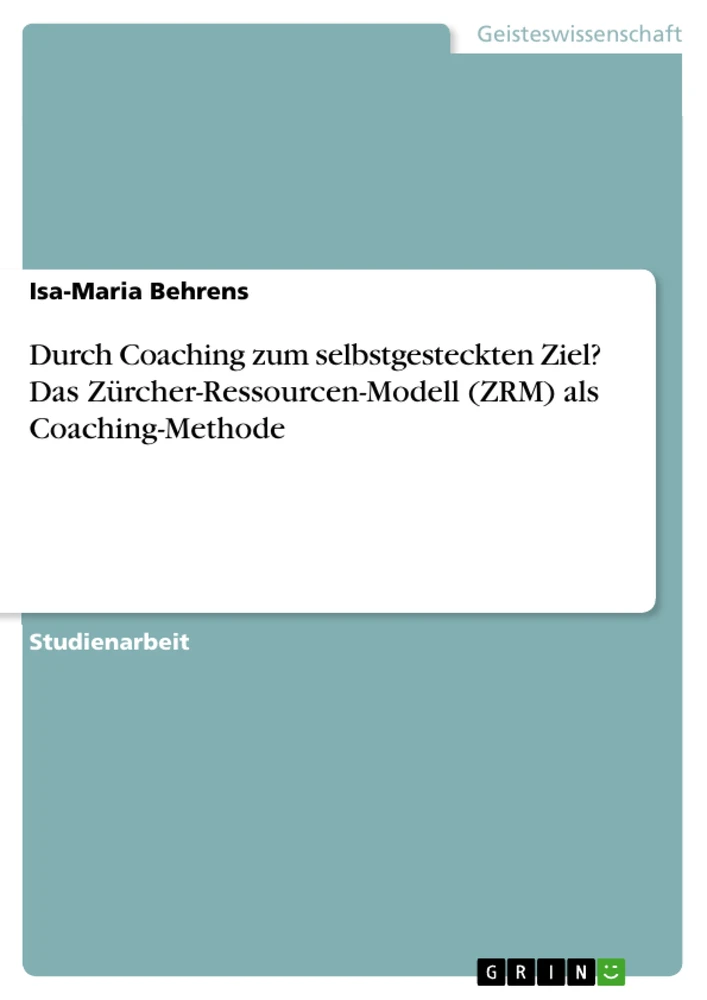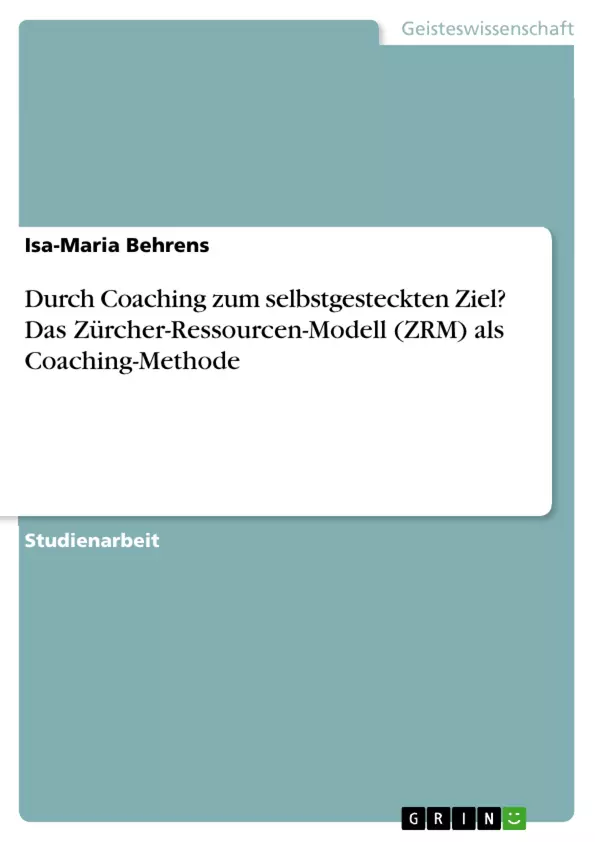Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) als Coaching-Methode. Konkret wird folgende Fragestellung untersucht: Wie unterstützt das ZRM Individuen dabei selbstbestimmte Ziele zu entwickeln und umzusetzen?
Dafür werden zunächst die theoretischen Grundlagen des ZRMs vorgestellt. Es zeigt sich, dass das ZRM einerseits auf einer erweiterten Variante des Rubikonmodells und andererseits auf der Persönlichkeits-System-Interaktionen- (PSI) Theorie basiert. Im Anschluss daran wird anhand der fünf Phasen des ZRMs der Ablauf der Coaching-Methode illustriert. Es kann konstatiert werden, dass das ZRM darauf abzielt, den Coaching-Teilnehmern Hilfestellung zu liefern, sich ihrer (un)bewussten Bedürfnisse bewusst zu werden. Das ZRM unterstützt diesen Prozess durch den Einsatz geeigneter Methoden (z.B. Ideenkorb, Ressourcenpool). Eine zentrale Rolle im ZRM spielt die sogenannte „Überquerung des Rubikons“. Hierbei geht es darum, das bewusst gewordene Bedürfnis (Motiv beziehungsweise linkes Rubikonufer) im nächsten Schritt zur Intention (rechtes Rubikonufer) zu transformieren. Sobald der Rubikon erfolgreich überquert wurde, verfolgt das ZRM das Ziel den Coaching-Teilnehmern dabei zu helfen, die erarbeiteten Ziele im Alltag umzusetzen.
Im Anschluss an die Darstellung des Ablaufs des ZRMs folgt eine kritische Würdigung der Erkenntnisse. Dabei wird einerseits thematisiert, dass sich das ZRM insbesondere durch die Selbstbestimmtheit der Teilnehmerziele auszeichnet, aber andererseits nicht dem Anspruch einer Therapie genügt. Ein abschließendes Fazit rundet die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen des ZRMs
- 2.1 Somatische Marker und Ressourcenaktivierung im ZRM
- 2.2 Die fünf Phasen des ZRMs
- 3. Diskussion
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) als Coaching-Methode und befasst sich mit der Frage, wie es Individuen dabei unterstützt, selbstbestimmte Ziele zu entwickeln und umzusetzen. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen des ZRM und beleuchtet seine Anwendung in der Praxis.
- Theoretische Grundlagen des ZRM, insbesondere das Rubikonmodell und die Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI)-Theorie
- Die fünf Phasen des ZRM und deren Anwendung im Coaching-Prozess
- Die Rolle von Ressourcenaktivierung und Selbstbestimmung im ZRM
- Die praktische Anwendung des ZRM und die Bedeutung von "Überquerung des Rubikons"
- Kritische Betrachtung der Stärken und Grenzen des ZRM als Coaching-Methode
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) als Coaching-Methode ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit vor.
- Theoretische Grundlagen des ZRMs: Dieses Kapitel untersucht die theoretischen Grundlagen des ZRM, wobei insbesondere die Verbindung zum Rubikonmodell und zur Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI)-Theorie erläutert wird.
- Die fünf Phasen des ZRMs: Dieses Kapitel beschreibt die fünf Phasen des ZRM und zeigt anhand von Beispielen auf, wie die Methode in der Praxis angewendet wird.
Schlüsselwörter
Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), Coaching-Methode, Rubikonmodell, Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI), Ressourcenaktivierung, Selbstbestimmung, Zielentwicklung, Zielumsetzung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)?
Das ZRM ist eine psychoedukative Coaching-Methode zur Selbstmanagement-Förderung, die Erkenntnisse aus Psychoanalyse und Neurowissenschaften verbindet.
Was bedeutet „Überquerung des Rubikons“ im ZRM?
Es beschreibt den Übergang von einem bloßen Wunsch (Motiv) hin zu einer festen Absicht (Intention) und konkreten Handlungsplanung.
Welche Rolle spielen somatische Marker?
Somatische Marker sind Körpergefühle, die im ZRM genutzt werden, um unbewusste Bedürfnisse bewusst zu machen und Ziele emotional zu verankern.
Wie viele Phasen hat der ZRM-Prozess?
Der Prozess ist in fünf Phasen unterteilt, die von der Bedürfnisklärung bis zur Umsetzung und Automatisierung im Alltag führen.
Ist ZRM eine Form der Therapie?
Nein, die Arbeit stellt klar, dass ZRM zwar hohe Standards erfüllt, aber primär eine Coaching-Methode ist und keine klinische Therapie ersetzt.
- Citation du texte
- Isa-Maria Behrens (Auteur), 2019, Durch Coaching zum selbstgesteckten Ziel? Das Zürcher-Ressourcen-Modell (ZRM) als Coaching-Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594827