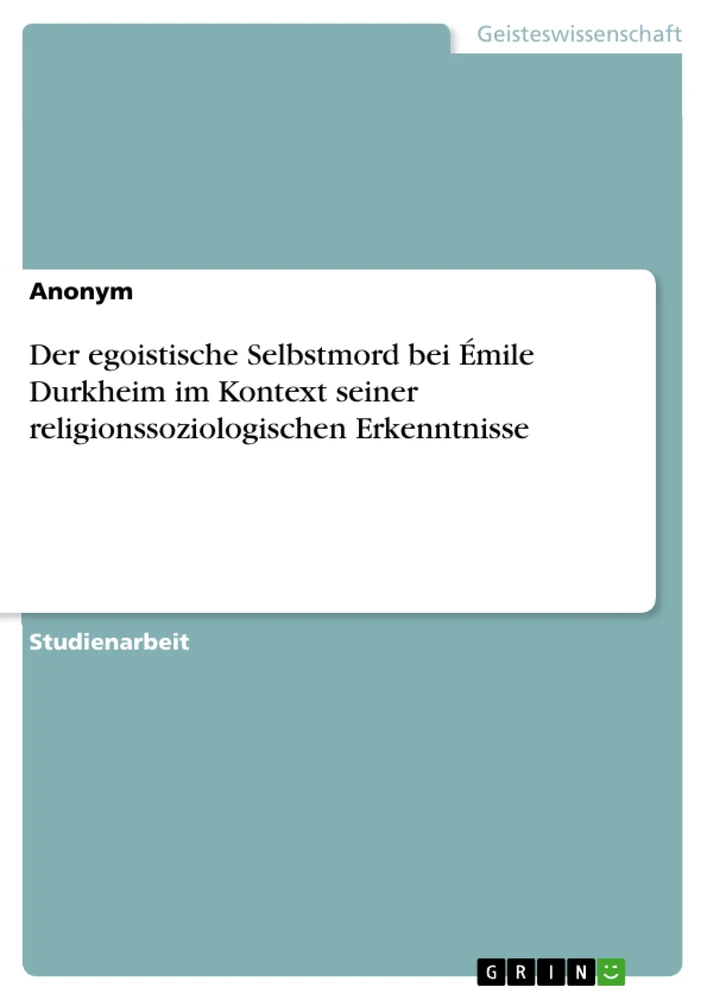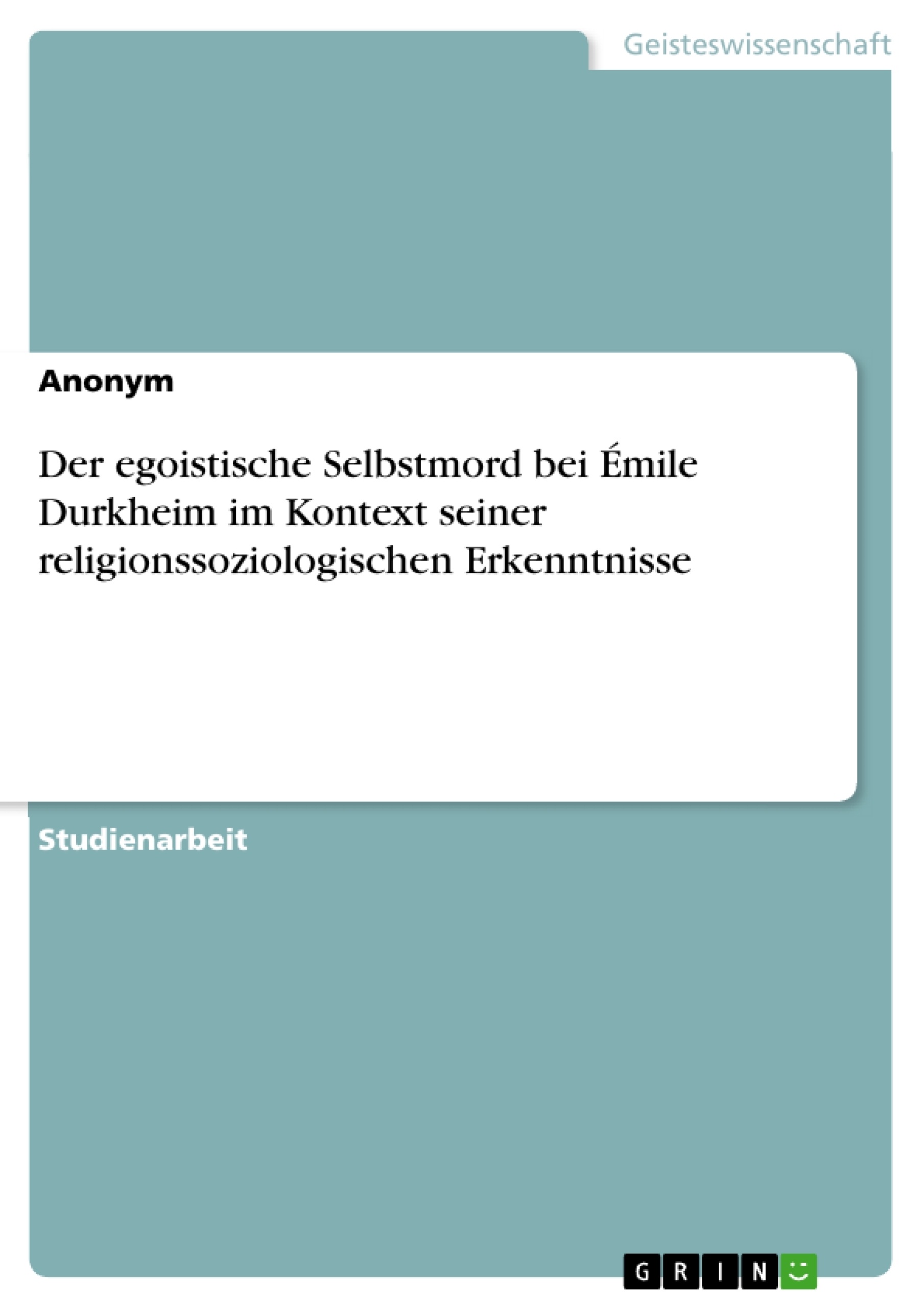Bei der Beschäftigung mit der Religionssoziologie kommt man am Namen Émile Durkheim nicht vorbei. Durkheim etablierte die Soziologie als eigenständige Wissenschaft und spielte für die Entwicklung der religonssoziologischen Forschung eine bedeutende Rolle. In seinem Werk Der Selbstmord nutzte er erstmals soziographische Daten, um soziale Phänomene zu erklären. Seine These zur erhöhten Selbstmordbereitschaft der Protestanten ist bis heute viel diskutiert. Die vorliegende Arbeit setzt diese These in einen Zusammenhang mit Durkheims wichtigsten Schriften und den darin enthaltenen religionssoziologischen Erkenntnissen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1) Émile Durkheims Leben und Werk
- 2) Die Religionssoziologie bei Émile Durkheim
- Die Integrationsthese
- Der Religionsbegriff
- 3) Die elementaren Formen des religiösen Lebens
- Die Efferveszenstheorie
- 4) Über soziale Arbeitsteilung
- 5) Der Selbstmord
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Religionssoziologie von Émile Durkheim, einem der wichtigsten Vertreter der Soziologie im 19. Jahrhundert. Ziel ist es, Durkheims These zur erhöhten Selbstmordbereitschaft von Protestanten im Kontext seiner religionssoziologischen Erkenntnisse zu analysieren.
- Emile Durkheims Leben und Werk
- Die Religionssoziologie bei Durkheim, inklusive der Integrationsthese und des Religionsbegriffs
- Die elementaren Formen des religiösen Lebens und die Efferveszenstheorie
- Durkheims Theorie der sozialen Arbeitsteilung und die daraus resultierende Anomie
- Durkheims Analyse des Selbstmords und dessen Verbindung zu religiösen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt Émile Durkheim als zentralen Denker der Religionssoziologie vor und legt die Grundzüge der Arbeit dar, die seine These zur Selbstmordrate von Protestanten im Kontext seiner Schriften untersucht.
Das erste Kapitel bietet einen kurzen Einblick in Durkheims Leben und Werk. Es werden seine wichtigsten Schriften, wie "Über soziale Arbeitsteilung", "Die Regeln der soziologischen Methode" und "Der Selbstmord", vorgestellt und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Soziologie hervorgehoben.
Kapitel zwei analysiert Durkheims Religionssoziologie, indem es seine Integrationsthese, die die Trennung von Sakralem und Profanem beschreibt, beleuchtet. Weiterhin wird Durkheims funktionalistischer Religionsbegriff, der den Ritus als zentralen Bestandteil der Religion begreift, erläutert.
Im dritten Kapitel werden Durkheims "Elementaren Formen des religiösen Lebens" kritisch betrachtet. Es wird die Efferveszenstheorie, die die Entstehung von religiösen Riten und deren Auswirkungen auf die menschliche Efferveszens beschreibt, näher beleuchtet.
Kapitel vier behandelt Durkheims "Über soziale Arbeitsteilung", in der er den Übergang von einer mechanischen zu einer organischen Gesellschaft skizziert. Dieses Werk führt das Konzept der Anomie ein, das im fünften Kapitel im Zusammenhang mit Durkheims Analyse des Selbstmords diskutiert wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Religionssoziologie, Émile Durkheim, Selbstmord, Integrationsthese, Religionsbegriff, Ritus, Efferveszenz, soziale Arbeitsteilung, Anomie, Protestantismus, Katholizismus.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Der egoistische Selbstmord bei Émile Durkheim im Kontext seiner religionssoziologischen Erkenntnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594401