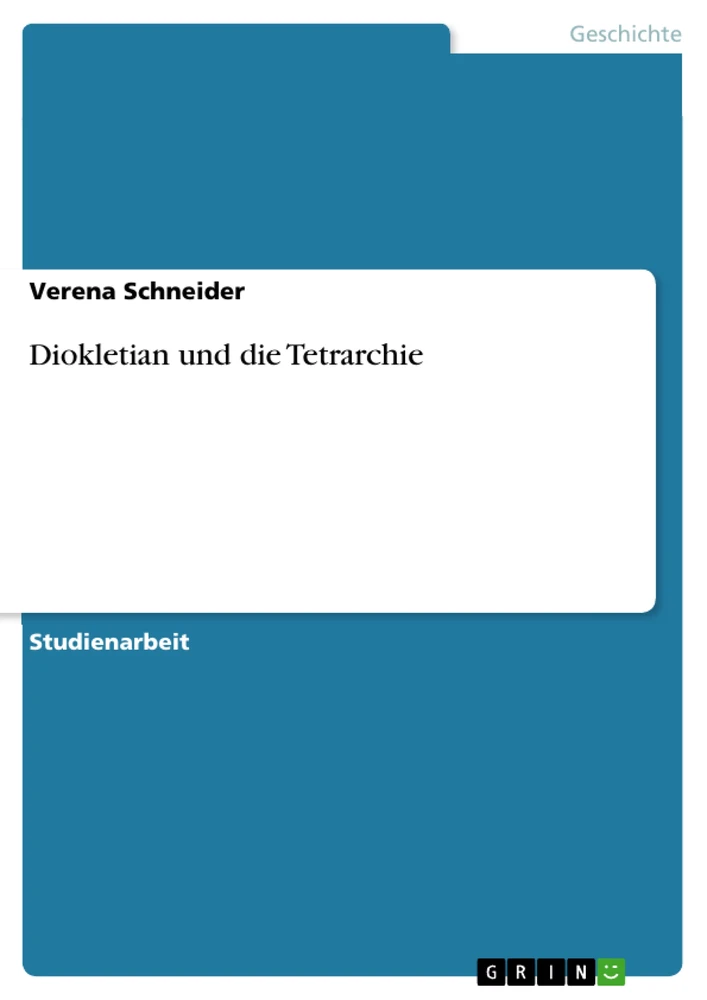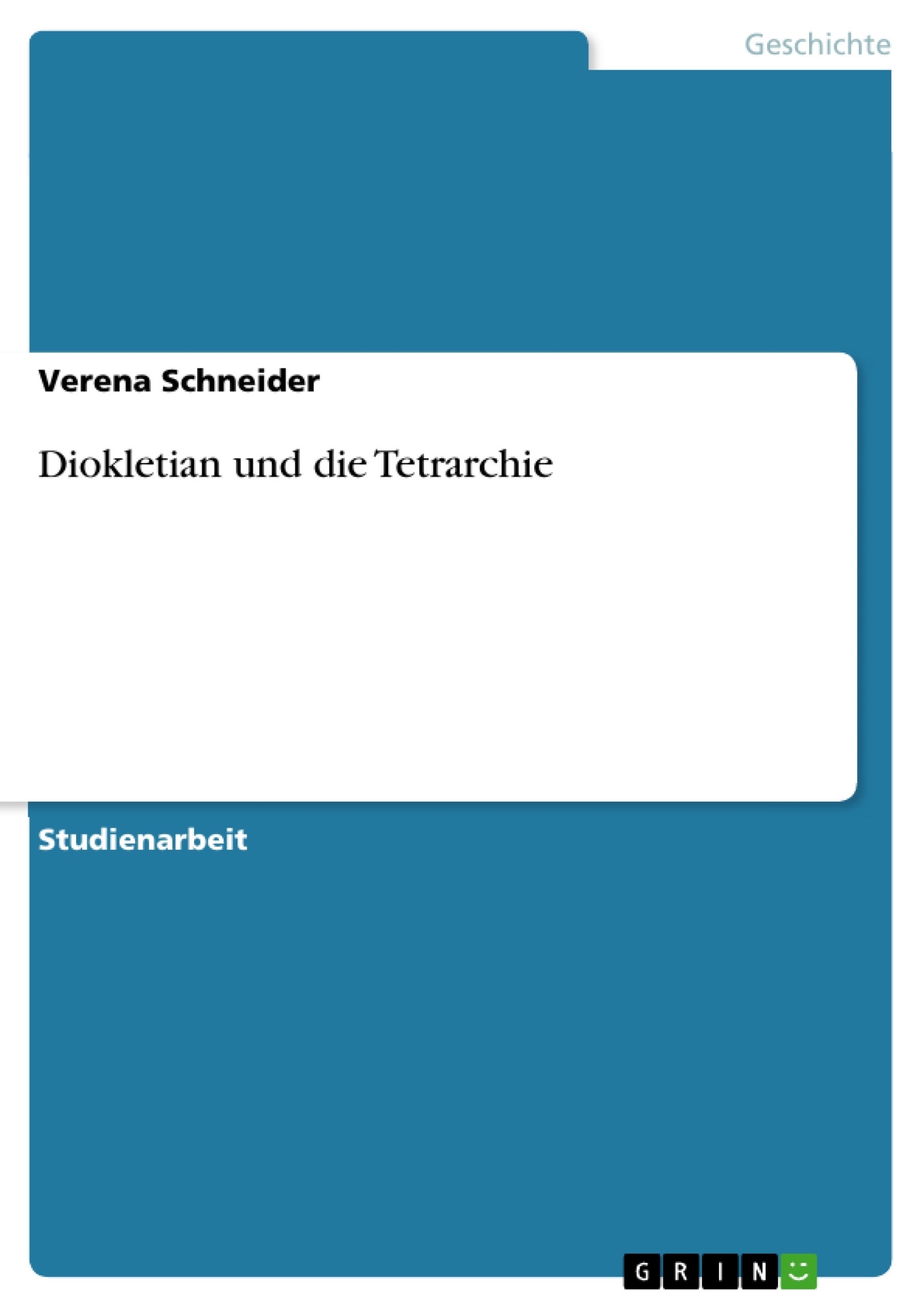Im 3. Jh. herrschte eine charakteristische Instabilität bei der kaiserlichen Herrschaft. Es galt, den ununterbrochenen Usurpationen beizukommen und das Römische Reich wieder zu stabilisieren. Alexander Demandt brachte diese Krise mit einem Satz auf einen Nenner: „Die äußere Bedrängnis des Reiches war zum geringen Teil eine Folge der inneren Krise, zum größten Teil hingegen deren Ursache“.
Niemand wusste, ob der Herrschaftsantritt von Diokletian 284 ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte von Usurpationen und Thronwechsel werden würde oder aus der Instabilität führen konnte. Diokletian stand vor zwei Aufgaben, er musste versuchen die außenpolitische Lage unter Kontrolle zu bringen und die innere Stabilität zu sichern. Er versuchte es mit Hilfe eines neuen Herrschaftssystems – der Tetrarchie. Dabei stellt sich aber die Frage, ob er dieses Konzept zuvor genau durchdacht hatte, oder ob ihn der Zwang der Ereignisse zur Aufteilung der Macht auf vier Kaiser dazu veranlasst hatte.
Der spätantike heidnische Historiker Aurelius Victor betont, dass die concordia (Eintracht) der Tetrarchen, verbunden mit der Anerkennung Diokletians, bemerkenswerte Phänomene in der Geschichte Roms waren. „Am meisten bewies der Zusammenhalt dieser Männer, daß Tüchtigkeit Begabung und Erfahrung in gediegenem Militärdienst […] nahezu genügt.“ Aurelius Victor, berichtet beeinflusst von seiner eigenen Zeit und in der Rückschau eher sachlich anerkennend über Diokletian. Es muss aber erwähnt werden, dass diese Quelle erst lange nach Diokletians Tod verfasst wurde.
Mit Laktanz, einer ganz anderen Quelle, besitzen wir den Bericht eines unmittelbaren Zeitzeugens über wichtige Elemente der tetrarchischen Regierungspraxis. Diese Quelle ist allerdings auch mit Vorsicht zu handhaben, da Laktanz nicht nur ein wohlinformierter Zeitgenosse von Diokletian war, sondern als Christ auch einer seiner schärfsten Kritiker.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe
- Methode
- Forschungsstand
- Diokletian und die Tetrarchie
- Das Herrschaftssystem der Tetrarchie
- Tetrarchie am Beispiel der venezianischen Tetrarchengruppe
- Diokletians Tetrarchie - Neuerung oder Assimilation?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Herrschaftssystem der Tetrarchie, das von Kaiser Diokletian im späten 3. Jahrhundert n. Chr. eingeführt wurde. Sie analysiert die Motive und Herausforderungen, die Diokletian zur Einführung dieses Systems bewogen haben, sowie die Auswirkungen der Tetrarchie auf das Römische Reich.
- Die Krise des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und die Notwendigkeit einer Reform
- Die Einführung der Tetrarchie als Antwort auf die Krise
- Die Organisation und Funktionsweise der Tetrarchie
- Die innen- und außenpolitischen Auswirkungen der Tetrarchie
- Die Bewertung der Tetrarchie als Neuerung oder Assimilation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische und politische Situation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert dar und erläutert die zentrale Rolle der Tetrarchie als Reformversuch. Sie definiert zudem wichtige Begriffe und beschreibt die Methodik der Arbeit.
Kapitel 2 untersucht das Herrschaftssystem der Tetrarchie anhand des Beispiels der venezianischen Tetrarchengruppe. Es analysiert die Organisation und Funktion des Systems sowie die Verteilung der Macht unter den vier Kaisern. Außerdem wird die Frage nach der Rolle der Tetrarchie als Neuerung oder Assimilation beantwortet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der römischen Kaiserzeit, wie Augustus, Caesar, Tetrarchie, Usurpation und Zäsur. Sie untersucht die Auswirkungen der Tetrarchie auf die politische und soziale Ordnung des Römischen Reiches und beleuchtet die innen- und außenpolitischen Herausforderungen, die Diokletian zu seiner Einführung bewogen haben. Die Arbeit analysiert die literarischen Quellen und den Forschungsstand zur Tetrarchie und beleuchtet die Rolle der Tetrarchie als Reformversuch und ihre Bedeutung für die spätrömische Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war das System der Tetrarchie?
Es war eine "Viererkaiserherrschaft", eingeführt von Diokletian, bestehend aus zwei Oberkaisern (Augusti) und zwei Unterkaisern (Caesares).
Warum führte Diokletian die Tetrarchie ein?
Um die Instabilität des 3. Jahrhunderts zu beenden, Usurpationen zu verhindern und die Verteidigung des riesigen Reiches an mehreren Fronten zu sichern.
Wer waren die ersten Tetrarchen?
Die ersten Augusti waren Diokletian und Maximian; ihre Caesares waren Galerius und Constantius Chlorus.
Was symbolisiert die venezianische Tetrarchengruppe?
Die Skulpturengruppe zeigt die Einigkeit (concordia) und gegenseitige Unterstützung der vier Herrscher durch ihre brüderliche Umarmung.
War die Tetrarchie eine geplante Neuerung?
Es ist umstritten, ob es ein fertiges Konzept war oder ob Diokletian durch den Zwang der Ereignisse schrittweise zur Machtaufteilung gedrängt wurde.
- Citar trabajo
- Verena Schneider (Autor), 2019, Diokletian und die Tetrarchie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593991